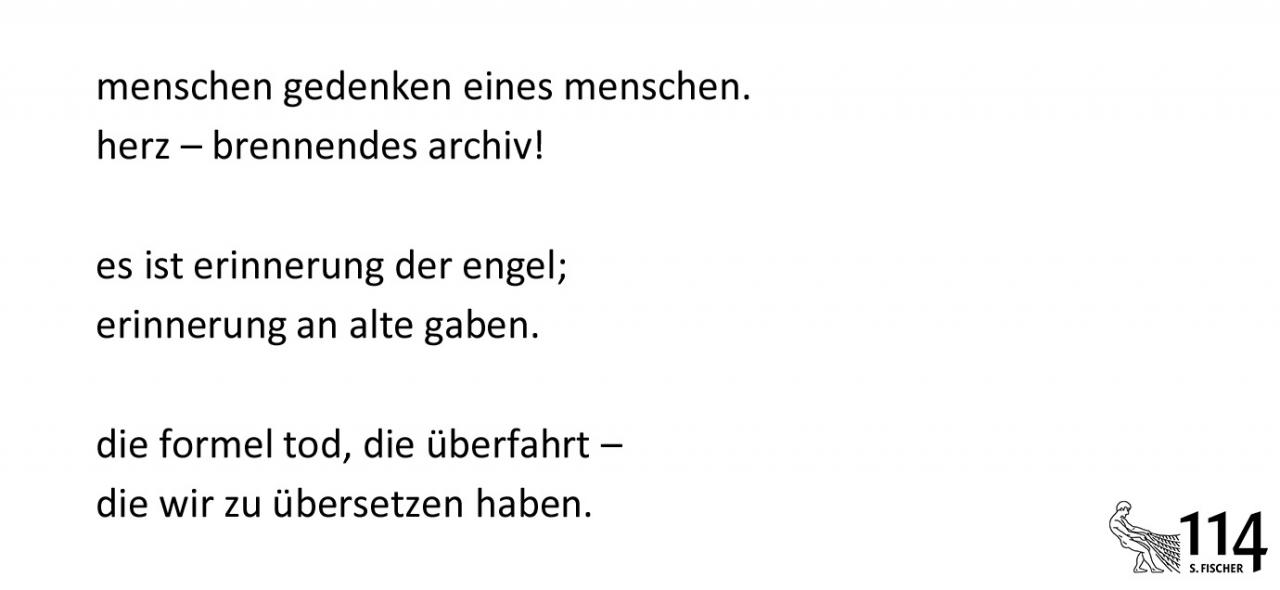
Kommentare
Schön, das hier zu lesen. Von Klings Gedicht nehme ich an, dass noch meine Töchter es lesen und von den sechs Zeilen berührt und erschüttert sein werden. „Wie der Hauptmann von Köpenick sagte: ,So weit wär'n ma jekomm‘!“ – Zitat mit Rückenknuffen. Irre die untergehobene Dreifachwiederholung Menschen – Erinnerung – Über..., fein auch der unsichtbare, unhörbare Reim auf Archiv. Schlief? Tief? Brief? „Dufte Jugendklubatmosphäre hier!“ Zitat, breites Lächeln.
„herz – brennendes Archiv“: das Herz, als der Sitz der Trauer, wird sich jäh seiner Aufgabe bewußt. Der Gedankenstrich steht für die Plötzlichkeit der Ein-Sicht, und markiert sie als unumstößlich. Auch der Sprung von den Menschen zu den Engeln zwischen Strophe I und II ist mehr als ein Gedankensprung. Grammatisch nicht zu klären, ob es Erinnerungen von oder Erinnerungen "an" Engel sind, im Fortstehlen genauso geübt wie im Überbringen. Oder ob die Engelszungen des Pfingstwunders hier mitsprechen. Wie aber bezieht sich das Archiv auf die Engel, wie wird von den „Gaben" auf die "Formel Tod“ geschlossen? Bezeichnen die Gaben geheimnisvolle Fähigkeiten, das poetische Sprechen, das mit seinen Gaben „herabkommt“, gar die Inspiration? Und welches Subjekt hat man sich hinter dem „es ist“ vorzustellen, das Herz, das Archiv oder das Erinnern an sich? Alles das zusammengenommen vermutlich.
Archive sind Statthalter der Erinnerung, sorgsam zusammengestellte, weitgehend „objektiv“ gehaltene Informationsspeicher mit Option zur Rekonstruktion. Erinnerungsstütze da, wo die Erinnerung aussetzt oder stirbt. Mittel, um die bestätigte Geschichte verfügbar zu halten oder auf Abruf wach zu machen. Geschichte, die an Lebensgeschichten grenzt, manchmal selbst von unvermittelt hereinbrechender Realität überrumpelt wird, wie beim Einsturz des Kölner Stadtarchivs, das der Autor dieses Gedichts nicht mehr erlebte. Wo ehedem Erinnerungen geborgen waren, sind sie nun aus den Trümmern zu bergen: „Für die Restaurierung wird derzeit ein Zeitbedarf von rund 30 Jahren veranschlagt.“ (Wikipedia)
Nicht zuletzt solche Erschütterungen geben Anlaß, allen externen Speichern zu mißtrauen und sich auf das Herz zu besinnen, das (Metropolis!) in seiner Vermittlungstätigkeit geschätzt wird. Marcel Beyer hatte die Poetik des Freundes ja überhaupt zwischen „Herz“ und „Haltung“ verortet und auf das Hirn aus guten Gründen sozusagen verzichtet. „das brennende archiv" gibt ihm recht.
Wenn Literatur sich entschließt, persönliches Eingedenken zu registrieren oder Geschichte zu archivieren (nicht umsonst wird das Wort auch synonym mit „abhaken“ gebraucht), so tut sie es anders als die Archivare und Chronisten. Sie muß sich zwischen Fakt und Fiktion, Nachricht und Gerücht, Befund und Gefühl bewähren, aber nicht entscheiden. Sie sollte entflammbar bleiben wie das Herz, ohne dessen Zutun „Gedächtnisspeicher" und „Schädelmagie“ ziemlich armselig dastünden. Kaltgemacht werden wir ohnehin, warum also das Material kalthalten? Dann schon lieber mit Herzblut arbeiten, eine Art Kraftstoff brauen, der vielleicht noch gebraucht werden kann.
Zum unfaßbaren Schrecken, der jede Todesnachricht umgibt, gehört das Nachdenken über den in Jahren des Lernens, Erlebens und Empfindens zusammengetragenen intellektuell-sinnlichen Inhalt eines Lebens, der nun mit einem Mal suspendiert sein soll. Eine ganze Welt, so wie sie ihm begegnet ist und mit ihm lebte, geht mit dem Toten unter. Da tritt das bewahrende Gedächtnis des Mitmenschen auf den Plan; aber was tun, um die Erinnerung vor der Auflösung zu schützen? Um sie in eine andere Qualität, eine andere Dimension zu überführen, muß der Dichter bereit sein, sich auf das dünne Eis des ästhetischen Scheins zu begeben.
Ein kleines Prosastück von Brigitte Kronauer, „Untrost und Glück“, läßt zwei Ansichten des Todes in Person zweier Trauernder miteinander streiten: Kommt es dem einen so vor, also ob „der Tod ein Kläffen“ sei, "kurz, der meisterlich glatte Schnitt, der die Welt trennt von einer Zwillingswelt“, nimmt der andere eine Art atmosphärische Durchlässigkeit und „verwandelte Anwesenheit" an, in der das „Wirken und Vibrieren der Gestorbenen (…) als feinste Partikel alles“ durchzieht. In „das brennende archiv“, scheint mir, korrigiert sich diese Dichotomie zu einer dritten Ansicht, die auf einer aktiven Durchdringungs- und Übersetzungsleistung beruht und besteht.
Die Überfahrt übersetzen – das klingt erst einmal wie eine tautologische Verbrämung des mythologischen Bilds vom Fährmann, der die Seele über den Fluß geleitet. Erst, wenn der Tod nicht mehr das Ergebnis, sondern die Anwendung der Formel ist, gewinnt das Bild Prägnanz. Grammatisch plausibel wäre vielleicht auch, die „formel tod“ als ein weiteres Objekt der Erinnerung zu deuten: erinnerung an… /die formel tod.." Dem Tod als „formel“ entspräche dann die „gabe“ als „aufgabe“. Diese Aufgabe, "unendlich" wie die des Übersetzers, wendet den Schrecken der Endlichkeit in eine Unendlichkeit des Verwandelns. Übersetzen ist Sterben lernen? Ja! Je früher wir damit anfangen, desto besser.






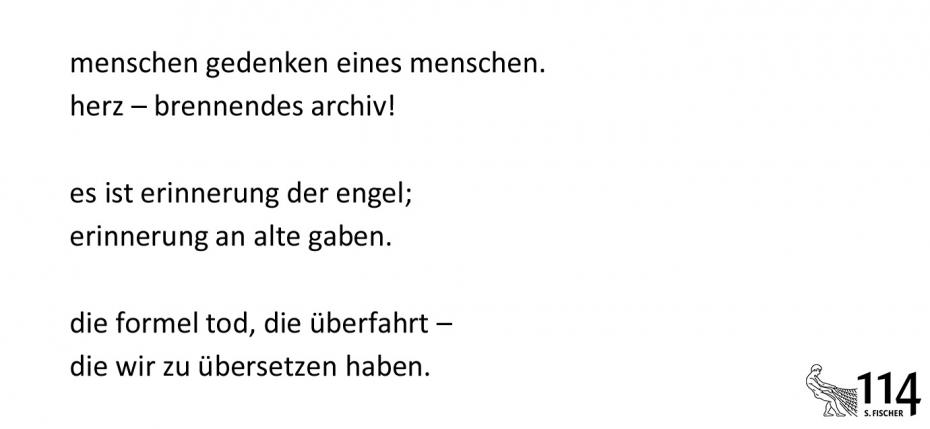
 © S. Fischer Verlag GmbH /
© S. Fischer Verlag GmbH /