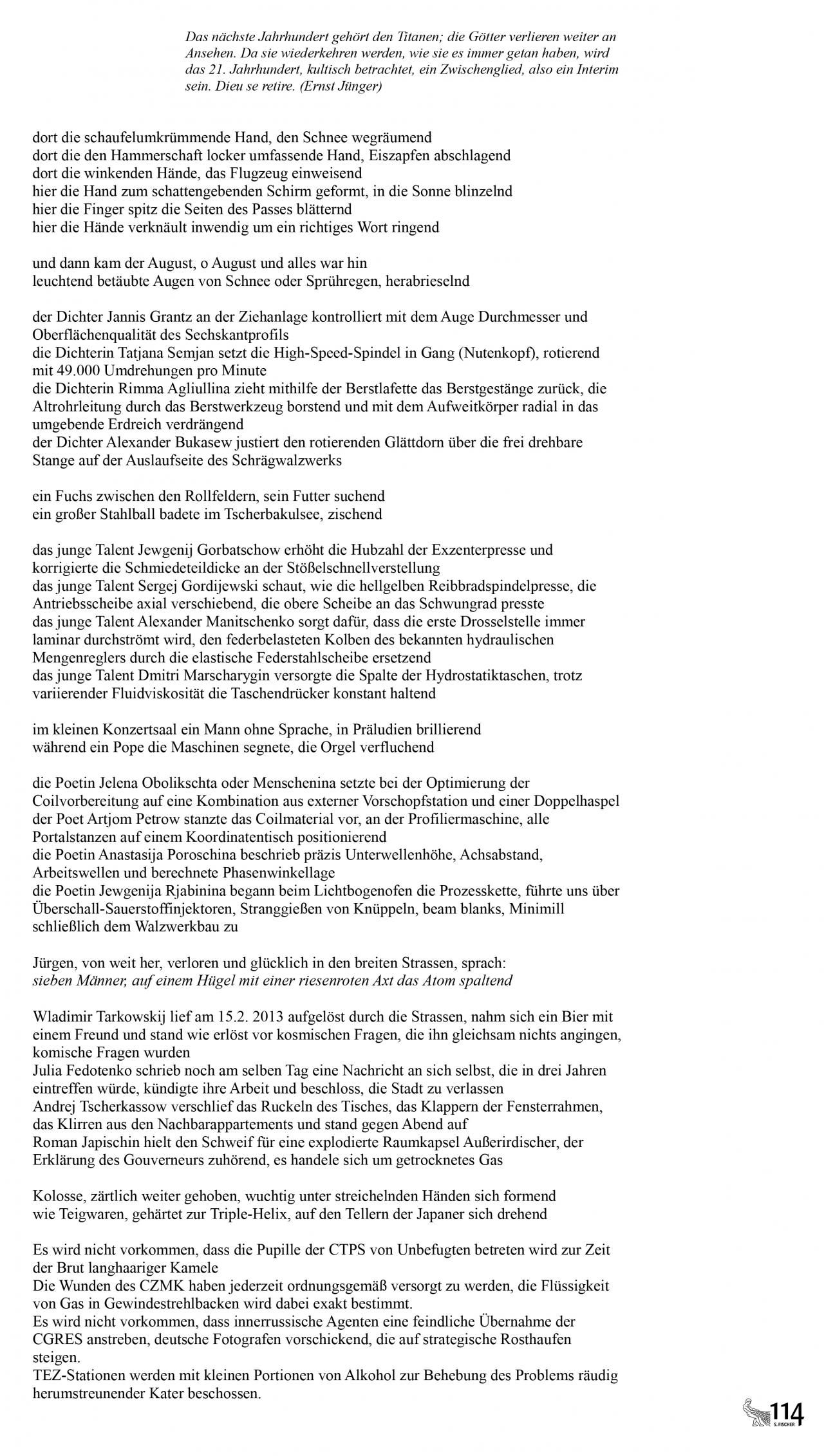
Kommentare
dieses Gedicht ist mir ERHOLUNG von all der Innerlichkeit. macht mich dankbar.
Das geht mir genau so ... mir gefällt die enorme Fremdheit, mit der das Gedicht hier im Zufallskontext steht, die Verweigerung von Poetisiererei, seine Geheimnislosigkeit, die eher Glanz erzeugt als die Geheimnisbemühung ... Ratlosigkeit ist ein guter Eintieg, steht man vorm Gedicht, ein Noch-nicht-wissen, was man damit machen kann ...
Woran machst Du Innerlichkeit fest? An ihrer Veräußerung? Was bedeutet dir Gegenteil, Erholung?
vielleicht ist Innerlichkeit auch ein falsches Wort. Ich meine so eine Gefühligkeit, die ins "schlecht Abstrakte" treibt. (ums mal mit Hegel zu sagen)
Gefühligkeit; von der, so es sie geben mag, ich nicht sicher wäre, ob sie generell ist (oben schriebst du "all der", das klang sehr über den Kamm…). Aber da wäre im Einzelfall zu schauen; gibt es solche und solche? Die Trennung Innen und Außen behagte mir nur nicht – um mit Hegel zu sprechen: wer die Grenze zieht, muss sie bereits überschritten haben, sinngemäß.
das ist eh klar. mir geht es aber um eine Tendenz, aus der dieser Text sehr deutlich herausfällt. Andere tun das natürlich auch, zum Beispiel die zwei Wiegenlieder. Das schlecht Abstrakte, das ich meine, ist, dass in der Innerlichkeit sich die Besonderheit verliert. Auf der Empfindungsebene sind wir uns ähnlicher, als einige wahrhaben wollen.
Vielleicht begreif ich noch nicht ganz, was Du mit Innerlichkeit; Gefühligkeit usf. meinst. In obigem Gedicht z.B. entsteht für mich bereits anfangs durch das dreifache "dort" und "hier" eindeutig eine Sprechhaltung, die von einem beobachtenden Wesen, einem Empfindsamen ausgeht. Ohne diesen ließe sich "hier" und "dort" gar nicht verorten. Dieser Sprechende ist für mich nicht aufgelöst; der bleibt ja präsent, m.E..
An diesem Gedicht geht mir auf, was mich an vielen anderen stört. Gedichte sind (auch) Erkenntnismaschinen. Sie sprechen über sich, aber damit auch über andere und Anderes. Sie geben sich zu erkennen und werfen Licht. Früher nannte man das Aufklärung.
Ah, mein Lieblingstext von allen hier. Mit Bitterfeld Ernst gemacht – es so heimlich gerettet und offen gesprengt.
Wie hätte dieser Text sagen wir 1987 an der Freundschafts-Wandzeitung meiner POS gewirkt, bzw. was? Abriss und Zerriss vermutlich, im besten Fall Verriss – die Argumente in letzterem würden mich erbauen, lieber Jan – wäre Dir vlt. eine nüchtern-heroisch-dialektische Kritik im alten Stile möglich? Und wer weiß, vlt. würde gar ein Lob dabei herauskommen? Vor einem solchen waren ja auch die besten Dichter nicht immer sicher.
lieber Steffen, ich meine schon zu wissen, was die Kulturfunktionäre unseres Herkunftslandes an diesem Text kritisieren würden. Letztlich ging es doch der protestantisch-kommunistische Doktrin darum, dass der Dichter die Arbeit verherrlich und nicht verrichtet. Was ihn dem Arbeiter letztlich im Zustand der Entfremdung angleicht. Hier wird der fernöstliche (chinesische-maoistische) Weg beschritten, der knapp an Bitterfeld vorbei führt. Der Text aber verhält sich rhythmisch europäisch. Er unerläuft sich also auch in dieser Hinsicht. Dass da nichts ist, woran man sich halten kann, erhält haltbaren Ausdruck. Hegelsche Ironie? Gibt es das? Das Gedicht als Apotheose der Postbürgerlichen Gesellschaft.
ein wenig erinnert das Gedicht übrigens auch an einige Arbeiten des englischen Dichters Andrew Duncan, den ich wärmstens empfehle.
lesen, während ich schon wieder gar keine Zeit mehr habe, längst hätte ich alles zuklappen müssen, wegklicken, immer noch nicht geduscht, da platzt in der Zimmerwärme eine Raumzone stampfender, beißender Kälte auf, Millionen gefrorener Quadratkilometer, in denen die Evolutionsreihen der Industriesaurier ihre Knochen verstreut haben, dem lauwarmen Digitalhirn nicht fassbar, und plötzlich eine Gier, mich dieser eisigen Weite auszusetzen, der realen Monotonie und ihren unentrinnbaren Lebensläufen, ich reiße die Balkontür auf, sibirischer Wind, gefühlte Frostnähe, na, immerhin –
Mag ich sehr: das Spröde-technizistische der Sprache, fast futuristisch kantig, die maschinell-gleichförmigen Abläufe auch als formale Grundstruktur. Die Beschreibung der Arbeitsschritte simuliert Präzision (liefert sie vielleicht auch...), bleibt bei mir aber fast referenzlos, ein Rauschen an vordefiniertem Handeln. Zur Zeit der Sowjetunion war Tscheljabinsk ein wichtiger Industriestandort, im 2. Weltkrieg Panzerproduktionsort, sagt mir Wikipedia. Und in die Abläufe hinein, ins Gewerkel, das seltene Ereignis (auch mit Widerhall in der Sprache): der Meteorit von Tscheljabinsk (https://de.wikipedia.org/wiki/Meteor_von_Tscheljabinsk), die kosmischen Fragen im Schweif und die Tradition kündender Dichtung, prophetischer Poesie. Welchen Widerhall kann die Wiederkunft des Göttlichen in denjenigen Zwischengliedmenschen haben, die Titanenmaschinen huldigen (müssen)? Auch in den Dichtern? Eher nicht Semele-Motiv, niemand erblindet, wird wahnsinnig, löst sich auf. Wie die Cross Cuts in Katastrophenfilmen kurz vor der Apokalypse: einer hat eine erlösende Ahnung, aber die damit aufgeworfenen Fragen gehen ihn nichts an, eine ändert ihr Leben, ein anderer verschläft, andere suchen Erklärungen. Dennoch verglimmt der Meteorit, die Kolosse werden zärtlich weiter gehoben, die monoton-genaue Taktung schlägt wieder an, die Wunden werden ordnungsgemäß versorgt. Die Götter ziehen sich zurück, aber gehen sie auch in Rente, oder feuern sie weiter, immer öfter, gleichmäßiger, vernichtender? Der Text funktioniert super bei mir, löst Neugier aus auf seine Vielschichten, seine Bezüge, seinen Hintergrund, öffnet mir seinen Raum.
Unter den Kommentaren hat mir dieser Satz gefallen: „Dass da nichts ist, woran man sich halten kann, erhält haltbaren Ausdruck.“ Das Un-gehaltene bestätigt sich schon grammatisch in dieser wiederholten Verlaufsform, einem ständiges Zeigen-Auf, das eben kein Aufzeigen ist, vielmehr ein Aufzeichnen von Ereignissen aus dem Möglichkeitssinn heraus. Lauter blinkende Hinweise auf etwas, was immer anderswo stattfindet. Alle arbeiten wie wild, aber alle sind auf verlorenem Posten. Das Singuläre tritt abwechselnd vor und zurück, und das Typische kann auch das sein, was nur einmal registriert wird. Aus lauter peripheren Befunden filtert sich ein Bild. So funktioniert es ja auch bei Montageromanen à la Berlin Alexanderplatz, wo das Objektive und anscheinend wahllos Zusammenzitierte manchmal so erschütternd rüberkommt, so unverhofft treffend, aber eben nur vor dem Hintergrund der Geschichte, die man gelesen hat. Als käme es erst allmählich zu einer Belegung der Worte mit Welt. Als wäre das Neutrale und Unpersönliche nur dazu da, das Subjektive und Besondere vorzubereiten. Als wäre das Unscheinbare die größte Sehenswürdigkeit. Daher würde ich schon meinen, daß es, nicht nur hier, ohne die Rückbindung an ein Ich schnell kippen kann, bloß steht nirgendwo geschrieben, welches Ich das denn sei und zu welchem Zeitpunkt es sich zeigt. Die Möglichkeit, dieses Moment aufzuschieben, ist solchen Texten vielleicht inhärent. Doch es schadet nicht, wenn es vorgesehen ist, sonst wäre das Ganze doch eine sehr männliche Angelegenheit, ein Sich-Aufgeilen an zweckentfremdeter technizistischer Exaktheit. So ist es aber doch nicht, denn die losen Enden setzen auch etwas in Gang, eben durch das, was sie suspendieren. Und was, wenn es („beam blanks, Minimill“) innerhalb der Mechanik mikroskopischer Ereignisse im Zahnradbereich plötzlich asemantisch wird, fast zum Lautgedicht tendiert? Auch eine Art Listenwitz: Das aus der Reihe fallende Unverständliche als das, woran sich Verstehen entzündet. Zumindest für den Laien.






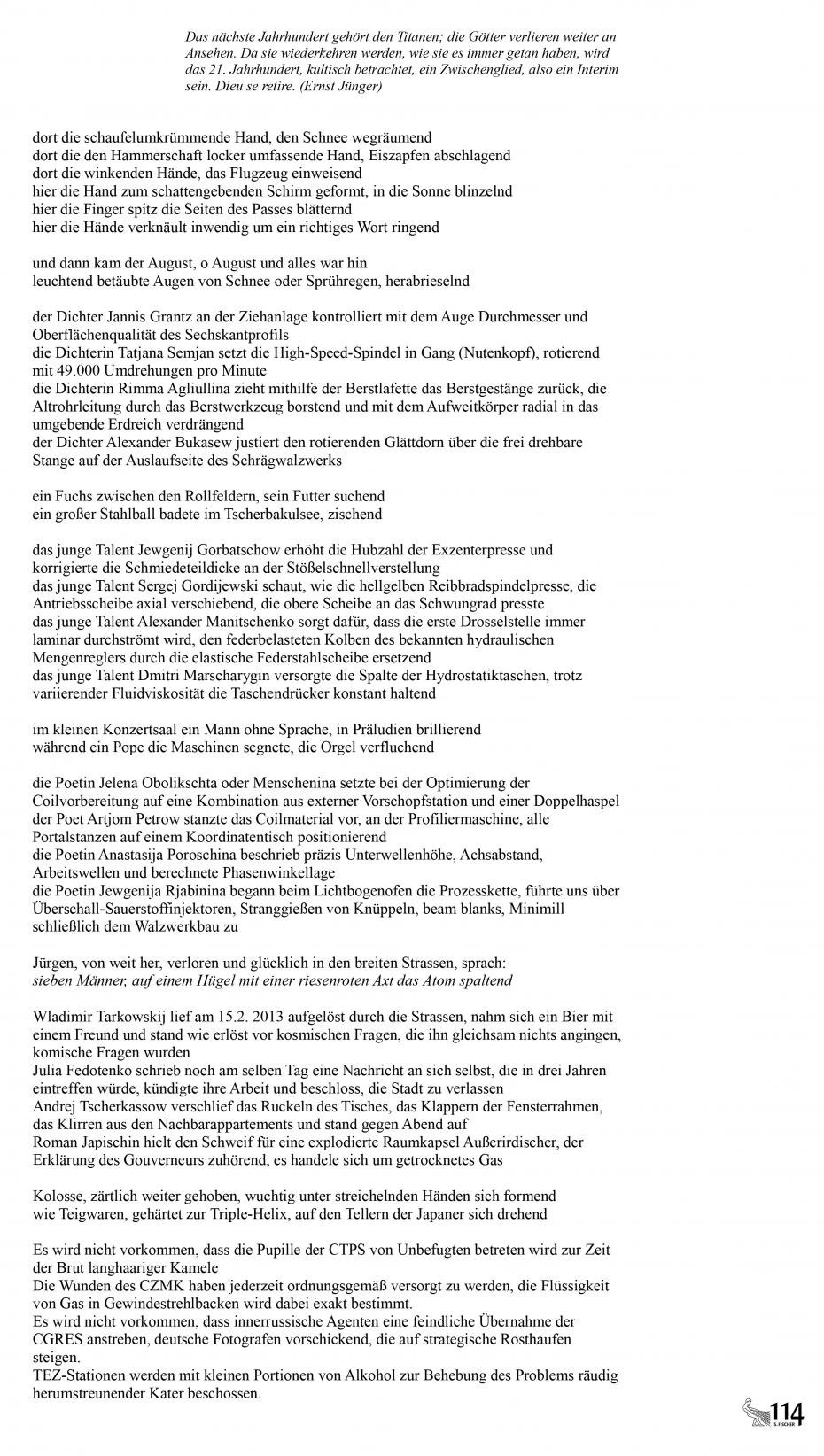
 © S. Fischer Verlag GmbH /
© S. Fischer Verlag GmbH /