Ritter Verlag
Klagenfurt-Wien 2000
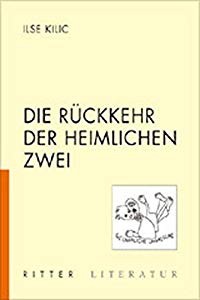 Ilse Kilic, Autorin, Verlegerin, Musikerin, Filmerin, ist uns als harte Sprach(be)arbeiterin bekannt. Aus der Freiheit dieser Position leistet sie sich seit einiger Zeit, auf eine andere – von ihren sonstigen Elaboraten sehr differente, auch entspanntere Sprachmelodie – einzugehen.
Ilse Kilic, Autorin, Verlegerin, Musikerin, Filmerin, ist uns als harte Sprach(be)arbeiterin bekannt. Aus der Freiheit dieser Position leistet sie sich seit einiger Zeit, auf eine andere – von ihren sonstigen Elaboraten sehr differente, auch entspanntere Sprachmelodie – einzugehen.
„Die Rückkehr der heimlichen zwei“ lautet das Fortsetzungsbuch zu „Als ich einmal zwei war“. Mehr oder weniger direkt übernommen wird das erzählende ICH, Personen und Figuren wie auch der Lebenskontext aus dem ersten Band.
Was vom Titel her einen gestandenen Jugendkrimi verspricht oder aber eine weitere „Autobiografie“ erwarten läßt, entpuppt sich sehr bald als Textgebilde, welches in seiner Struktur einer Zwiebel gleicht und dessen stilistische Homogenität im Hauptteil, von einem „Widmungstext „, einem „Eingang“ und einem „Ausgang“ – formal unterschiedlich – eingerahmt wird. Als „Eingang“ fungiert ein quasi analytischer Metatext, der sich mit der psychologischen Beschaffenheit von „Druck- und Ergänzungszwillingen“ auseinandersetzt.
Dazwischen begibt sich die Autorin in liebevoller Annäherung auf die Spuren eines federleichten, hochsensiblen, mitunter sehr ängstlichen ICHs und vollzieht im Laufe des Buches den unablässigen Grenzgang zwischen Tagbewußtsein und Traumbewußtsein, zwischen dieser und jener „Wirklichkeit“.
Wir treffen auf Motive, Bilder, die uns aus anderen, älteren Quellen bekannt sind, wie etwa das Lächeln der Edamerkatze aus „Alice im Wunderland“ von Lewis Carroll.
Reime werden angedeutet, etwa wenn in einer von der einohrigen Begleiterin erzählten Geschichte Ilse Bilse anklingt ; ein Rätselspruch findet auch seinen Platz, diesmal mit direkter Quellenangabe.
Einen gedanklichen wie formalen Höhepunkt erfährt die Erzählung von der Wiederbegegnung der Protagonistin mit ihrer Zwillingsschwester, vom Abtausch beider Identitäten und den damit verbundenen Abenteuern, als die Autorin fast symbolisch das Zwiebelschalengebilde entblättert. Das achtmalige Erwachen vom Erwachen soll letztlich zu keiner Klarheit der Selbsterkenntnis führen.
Denn: Die Zeit hiefür fehlt und der Weg, der nur ein Ziel kennt, läuft ohne Unterlaß!
Petra Ganglbauer
 Im Spannungsfeld von Wissensansammlung und Weltgemisch – dicht, grell, überlaut, einerseits –, und der unwiderruflichen Einsamkeit individueller Existenz andererseits, bewegen sich die Ab-Schnitte in Bettina Balàkas Roman.
Im Spannungsfeld von Wissensansammlung und Weltgemisch – dicht, grell, überlaut, einerseits –, und der unwiderruflichen Einsamkeit individueller Existenz andererseits, bewegen sich die Ab-Schnitte in Bettina Balàkas Roman. Lisa Spalt nimmt die Sprache ernst. Und dieses Ernstnehmen bedeutet eine Art des Sprachspiels, ein Sprachspiel jenseits der tagtäglichen Sprachspiele, die uns nicht zum Bewußtsein kommen. Spiel soll hier nicht als Gegensatz zum Ernst stehen, sondern als dessen Erweiterung, Einübung und Ergänzung. Dieses Sprachspiel besteht darin, auf eine Art in Sprach-Fallen zu tappen, die diese als Fallen (Falten?) deutlich werden läßt, als angelegte Bedeutungen in der Sprache, die im alltäglichen Sprechen nicht zur Geltung kommen. Es ist das geheime Leben, das den Wörtern und Sätzen innewohnt und das hier plötzlich unter der Spaltlampe sichtbar wird. Doppeltrichter nennt der Verleger Christian Steinbacher dieses irritierende Phänomen, wie sich während des Lesens die Bedeutung des Satzes ändert, ein kleines Verschieben, ablenken, ein gelenkiges Scharnier genügt und schon steht der Satz anders da, als wir ihn erwartet haben. So offenbart sich der Spalt’sche Doppeltrichter als ein Wurmloch, durchaus vergleichbar jenen Wurmlöchern, durch die etwa die (T)Raumschiffe Enterprise oder Voyager in weit entfernte Galaxien halb gezogen und halb aus eigenem Antrieb gelangen. Die Leserin empfindet beim Durchqueren eines Spalt’schen Wurmlochs eine tiefe und lustvolle Irritation – ebenfalls vergleichbar den Star Trek Reisenden, die zunächst kaum fassen, was ihnen widerfährt und die genau durch diese (Aus)Dehnung ihres Fassungsvermögens in einen Zustand neuer Erkenntnis gelangen.
Lisa Spalt nimmt die Sprache ernst. Und dieses Ernstnehmen bedeutet eine Art des Sprachspiels, ein Sprachspiel jenseits der tagtäglichen Sprachspiele, die uns nicht zum Bewußtsein kommen. Spiel soll hier nicht als Gegensatz zum Ernst stehen, sondern als dessen Erweiterung, Einübung und Ergänzung. Dieses Sprachspiel besteht darin, auf eine Art in Sprach-Fallen zu tappen, die diese als Fallen (Falten?) deutlich werden läßt, als angelegte Bedeutungen in der Sprache, die im alltäglichen Sprechen nicht zur Geltung kommen. Es ist das geheime Leben, das den Wörtern und Sätzen innewohnt und das hier plötzlich unter der Spaltlampe sichtbar wird. Doppeltrichter nennt der Verleger Christian Steinbacher dieses irritierende Phänomen, wie sich während des Lesens die Bedeutung des Satzes ändert, ein kleines Verschieben, ablenken, ein gelenkiges Scharnier genügt und schon steht der Satz anders da, als wir ihn erwartet haben. So offenbart sich der Spalt’sche Doppeltrichter als ein Wurmloch, durchaus vergleichbar jenen Wurmlöchern, durch die etwa die (T)Raumschiffe Enterprise oder Voyager in weit entfernte Galaxien halb gezogen und halb aus eigenem Antrieb gelangen. Die Leserin empfindet beim Durchqueren eines Spalt’schen Wurmlochs eine tiefe und lustvolle Irritation – ebenfalls vergleichbar den Star Trek Reisenden, die zunächst kaum fassen, was ihnen widerfährt und die genau durch diese (Aus)Dehnung ihres Fassungsvermögens in einen Zustand neuer Erkenntnis gelangen.