Roman
Kremayr & Scheriau
Wien 2020

Souverän und mit unnachahmlicher Kraft nähert sich Barbara Rieger, die mit „Bis ans Ende, Marie“ erfolgreich debütierte, den Themen Magersucht und Bulimie.
Schon der Einstieg in das formal gelungen aufbereitete Buch erzeugt einen regelrechten Sog, indem er schon zu Beginn aus der „Zukunft“ (Gegenwart) gesehen, jene Entwicklung zusammenführt, die schließlich das ganze Buch umfasst, bis Anna am Ende des Romans wieder „dorthin“ gelangt – ins Hier und Jetzt, sich und ihren Körper spürt, ihren Bauch, jedoch unter anderen Umständen als zuvor.
Der Kreis schließt sich also, der Erzählrahmen gibt den aufwühlenden inhaltlichen und sprachlichen Sequenzen Kontur, bis das Ende, bis der Anfang klar gesetzt sind.
Die pubertierende Anna schlittert zunehmend in eine seelische Diffusion und Zerrissenheit, die sich in Form von äußersten Turbulenzen ihres Körpers äußert: In Form eines zwanghaften Essverhaltens, zwischen Fressattacken und dem Wunsch zu „kotzen“. Barbara Rieger findet dafür einen beinahe phänomenologischen Zugang, indem wir, die LeserInnen uns gemeinsam mit Anna zusehends hineinbewegen müssen (!) in ihre Körperzustände, ja, mitgezogen werden von den unkontrollierbaren Verhaltensmustern, indem wir unbewussten Prozessen beiwohnen und dabei beinahe in ihren Körper schlüpfen, in ihre gesamte Gefühlswelt. Und die ist durchsetzt von Selbstzweifel, Hassgefühlen, zartem, zerbrechlichen Hoffnungsschimmer und dem Wunsch, alles, alles – sich selbst mithin – loszuwerden.
Eingespannt zwischen der kühlen, hilflosen Ordnungsliebe und dem schablonenhaften Verhalten ihrer Mutter, die die Vereinsamung ihrer Tochter nicht erkennt, und der Absenz ihres Vaters, dessen Namen (um nicht zu sagen Existenz) sie erst viel später und mit viel Nachdruck, der Mutter abringt, wird Anna vom Leben herumgeschleudert; sie reagiert hochsensibel (und zugleich wie unter einer Glasglocke) und letztlich zwanghaft auf alles und jedes, um nach schrecklich schmerzhaften Entwicklungsschüben, ihr Leben in den Griff zu bekommen: hinter ihr liegen dann enttäuschende und belastende Beziehungen, ein nicht erfüllendes aber dennoch stattfindendes Treffen mit ihrem Vater, die zahlreichen Besuche bei der Therapeutin und der unausgesetzte Kampf mit sich, gegen sich, schließlich für sich selbst.
Ein äußerst gelungener Balanceakt, der offenlegt, dass auch ein sich in weiten Teilen, wenn auch variantenreich wiederholender Prozess einer Suchtentwicklung spannend und packend bis zur letzten Seite aufbereitet sein kann.
Ein Buch, dass nicht nur freizügig offenlegt, sondern auch Hoffnung zu geben vermag, dort, wo sie gebraucht wird.
Anna ist stark.
Petra Ganglbauer

 Udo Kawasser, unter vielem anderem Autor und Initiator der Poesiegalerie in Wien, legt nun seinen dritten Band der Wasser-Trilogie vor.
Udo Kawasser, unter vielem anderem Autor und Initiator der Poesiegalerie in Wien, legt nun seinen dritten Band der Wasser-Trilogie vor.

 Gertraud Klemm ist eine Meisterin des Hervorkehrens von (trotz der scheinbaren Aufgeschlossenheit unserer Gesellschaft) nach wie vor tabuisierten Themen.
Gertraud Klemm ist eine Meisterin des Hervorkehrens von (trotz der scheinbaren Aufgeschlossenheit unserer Gesellschaft) nach wie vor tabuisierten Themen.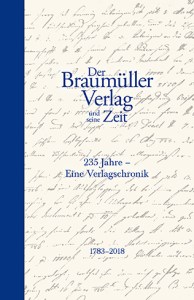 Es ist viel die Rede von Literatur, es ist oft die Rede von Autorinnen und Autoren bzw. deren Werken, was jedoch Seltenheitswert hat, ist die Auseinandersetzung mit einer Verlagsexistenz über 235 Jahre:
Es ist viel die Rede von Literatur, es ist oft die Rede von Autorinnen und Autoren bzw. deren Werken, was jedoch Seltenheitswert hat, ist die Auseinandersetzung mit einer Verlagsexistenz über 235 Jahre: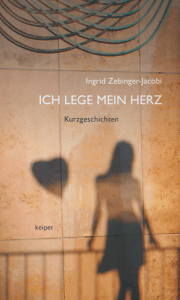
 Eine phänomenologische Zusammenschau bietet dieser Essayband, – konzise (Über /) Wirklichkeitssetzungen, die die Interdependenz von Blick und Objekt, von Ich und Welt verdeutlichen.
Eine phänomenologische Zusammenschau bietet dieser Essayband, – konzise (Über /) Wirklichkeitssetzungen, die die Interdependenz von Blick und Objekt, von Ich und Welt verdeutlichen. Erika Kronabitter arbeitet seit Jahren konsequent im Kontext verschiedener literarischer Gattungen, mehr noch, sie unternimmt Quergänge, Übergänge, Grenzüberschreitungen und setzt ihre Bücher auch immer wieder konzeptuell um.
Erika Kronabitter arbeitet seit Jahren konsequent im Kontext verschiedener literarischer Gattungen, mehr noch, sie unternimmt Quergänge, Übergänge, Grenzüberschreitungen und setzt ihre Bücher auch immer wieder konzeptuell um.