edition chARTS
Wien 2001
 Anknüpfungen, Fort- und Weiterschreibungen sind gestattet, das Voraus- und Mitgedachte als Implikation, als eine Art der tätigen Wahrnehmung oder aber der gründlichen Vermutung, die zugleich weit aus dem eigenen Gesichtskreis führt.
Anknüpfungen, Fort- und Weiterschreibungen sind gestattet, das Voraus- und Mitgedachte als Implikation, als eine Art der tätigen Wahrnehmung oder aber der gründlichen Vermutung, die zugleich weit aus dem eigenen Gesichtskreis führt.
Dies alles läßt sich bestens an, um sich mit Christine Hubers textuellem „Vorgehen“ auseinanderzusetzen.
Diese Methode verändert auch die Position der Leserin, die ihrerseits manisch zwischen dem Versuch, das Ent-sprechende zu benennen und jenem, das Nichtgelesene für sich hörbar zu machen, hin und hereilt.
Aus dem unmittelbar Erlesenen werden sehr individuelle Teile nachvollziehbar, versprühen sich im Augenblick poetisch, bleiben aber mit einem dahinter-, davor-, darüber- oder darunterliegenden Textkorpus verwoben.
So nimmt Unfertiges, belebt durch die Mitarbeit der Leser, Gestalt an.
Texte als Übergänge, Scharniere, Drehmomente sind das.
Anläufe, Vorgänge, Verlauf, Über- und Beschreibungen, allesamt sehr rhythmisch, konsequent, knapp.
Heterogen in Gattung und Gestalt, eine Zeichnung von Konturen, eine Verdeutlichung von Ein- und Anrissen, Knüpfstellen, Verdichtungsstellen, eine Andeutung von Netzen.
Unwillkürlich stellt sich das Verlangen nach der akustischen Komponente ein.
Ich möchte die Texte hören.
Petra Ganglbauer
 Fliegender (Gedanken-) Wechsel, unterschiedliche Perspektiven in einem eigentlich sehr streng gestalteten Band:
Fliegender (Gedanken-) Wechsel, unterschiedliche Perspektiven in einem eigentlich sehr streng gestalteten Band: „Wenn sie mich sehen ich bin ein Ungeheuer der Einsamkeiten es sieht den Menschen zum ersten Mal und flieht nicht die Forscher bringen die Haut in ihrem Gepäck heim…“ heißt es bei Samuel Beckett in „Wie es ist“.
„Wenn sie mich sehen ich bin ein Ungeheuer der Einsamkeiten es sieht den Menschen zum ersten Mal und flieht nicht die Forscher bringen die Haut in ihrem Gepäck heim…“ heißt es bei Samuel Beckett in „Wie es ist“.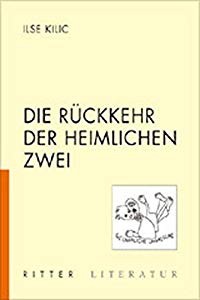 Ilse Kilic, Autorin, Verlegerin, Musikerin, Filmerin, ist uns als harte Sprach(be)arbeiterin bekannt. Aus der Freiheit dieser Position leistet sie sich seit einiger Zeit, auf eine andere – von ihren sonstigen Elaboraten sehr differente, auch entspanntere Sprachmelodie – einzugehen.
Ilse Kilic, Autorin, Verlegerin, Musikerin, Filmerin, ist uns als harte Sprach(be)arbeiterin bekannt. Aus der Freiheit dieser Position leistet sie sich seit einiger Zeit, auf eine andere – von ihren sonstigen Elaboraten sehr differente, auch entspanntere Sprachmelodie – einzugehen. Lisa Spalt nimmt die Sprache ernst. Und dieses Ernstnehmen bedeutet eine Art des Sprachspiels, ein Sprachspiel jenseits der tagtäglichen Sprachspiele, die uns nicht zum Bewußtsein kommen. Spiel soll hier nicht als Gegensatz zum Ernst stehen, sondern als dessen Erweiterung, Einübung und Ergänzung. Dieses Sprachspiel besteht darin, auf eine Art in Sprach-Fallen zu tappen, die diese als Fallen (Falten?) deutlich werden läßt, als angelegte Bedeutungen in der Sprache, die im alltäglichen Sprechen nicht zur Geltung kommen. Es ist das geheime Leben, das den Wörtern und Sätzen innewohnt und das hier plötzlich unter der Spaltlampe sichtbar wird. Doppeltrichter nennt der Verleger Christian Steinbacher dieses irritierende Phänomen, wie sich während des Lesens die Bedeutung des Satzes ändert, ein kleines Verschieben, ablenken, ein gelenkiges Scharnier genügt und schon steht der Satz anders da, als wir ihn erwartet haben. So offenbart sich der Spalt’sche Doppeltrichter als ein Wurmloch, durchaus vergleichbar jenen Wurmlöchern, durch die etwa die (T)Raumschiffe Enterprise oder Voyager in weit entfernte Galaxien halb gezogen und halb aus eigenem Antrieb gelangen. Die Leserin empfindet beim Durchqueren eines Spalt’schen Wurmlochs eine tiefe und lustvolle Irritation – ebenfalls vergleichbar den Star Trek Reisenden, die zunächst kaum fassen, was ihnen widerfährt und die genau durch diese (Aus)Dehnung ihres Fassungsvermögens in einen Zustand neuer Erkenntnis gelangen.
Lisa Spalt nimmt die Sprache ernst. Und dieses Ernstnehmen bedeutet eine Art des Sprachspiels, ein Sprachspiel jenseits der tagtäglichen Sprachspiele, die uns nicht zum Bewußtsein kommen. Spiel soll hier nicht als Gegensatz zum Ernst stehen, sondern als dessen Erweiterung, Einübung und Ergänzung. Dieses Sprachspiel besteht darin, auf eine Art in Sprach-Fallen zu tappen, die diese als Fallen (Falten?) deutlich werden läßt, als angelegte Bedeutungen in der Sprache, die im alltäglichen Sprechen nicht zur Geltung kommen. Es ist das geheime Leben, das den Wörtern und Sätzen innewohnt und das hier plötzlich unter der Spaltlampe sichtbar wird. Doppeltrichter nennt der Verleger Christian Steinbacher dieses irritierende Phänomen, wie sich während des Lesens die Bedeutung des Satzes ändert, ein kleines Verschieben, ablenken, ein gelenkiges Scharnier genügt und schon steht der Satz anders da, als wir ihn erwartet haben. So offenbart sich der Spalt’sche Doppeltrichter als ein Wurmloch, durchaus vergleichbar jenen Wurmlöchern, durch die etwa die (T)Raumschiffe Enterprise oder Voyager in weit entfernte Galaxien halb gezogen und halb aus eigenem Antrieb gelangen. Die Leserin empfindet beim Durchqueren eines Spalt’schen Wurmlochs eine tiefe und lustvolle Irritation – ebenfalls vergleichbar den Star Trek Reisenden, die zunächst kaum fassen, was ihnen widerfährt und die genau durch diese (Aus)Dehnung ihres Fassungsvermögens in einen Zustand neuer Erkenntnis gelangen.