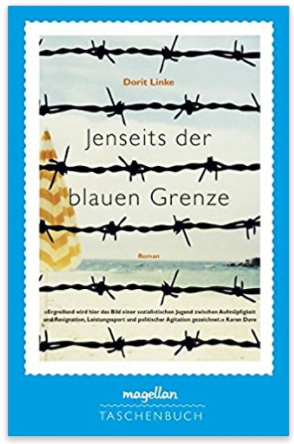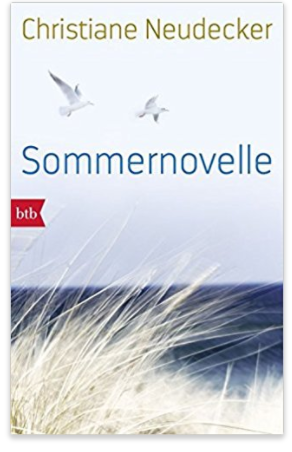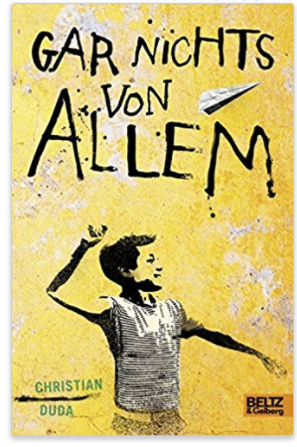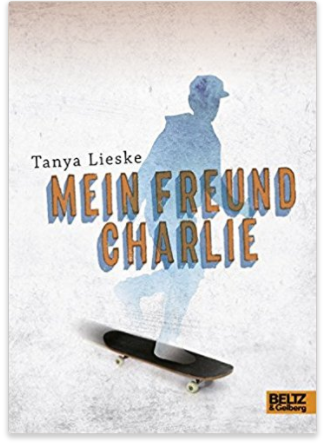.
Am 13. März darf ich am Literarischen Colloquium Berlin sieben aktuelle Jugendbücher meiner Wahl vorstellen, denen ich ein internationales Publikum wünsche. 35 Übersetzer*innen aus 29 Ländern hören zu.
Seit 2009 lese und mag ich Jugendbücher: Ich schreibe einen Roman über Teenager, „Zimmer voller Freunde“, und war unsicher, sobald Agent*innen etc. fragten, ob das Young-Adult-Literatur sei. Kann ich aus YA-Literatur für mein Erzählen, Schreiben lernen? Soll mein Buch in dieser Ecke der Buchhandlung liegen? Ich las YA – um mich zu positionieren und, weil mir die Sparte schnell ans Herz wuchs.
.
„Jugendbuch“ in Deutschland heißt meist:
ein Buch, geschrieben für Leser*innen ab ca. 10.
Auf dem US-Markt wird zwischen „Middle Grade Novels“ und „Young Adult“ unterschieden: Bücher für Tweens (10 bis ca. 12) und dunklere, anspruchsvollere, komplexere Bücher für Teenager auf der High School. Der deutsche Jugendbuchmarkt scheint mir, insgesamt, auf Jüngere fixiert: Ich finde kaum ein Buch, das explizit erst ab 14 bis 16 empfohlen wird, über 300 Seiten hat oder sich, im Young-Adult-Stil, bemüht, ein Problem-Thema besonders tief und intensiv zu bearbeiten.
.
Young-Adult-Literatur, die ich mag:
- …hat meist eine Hauptfigur, der wir möglichst nahe kommen sollen. Oft als Ich-Erzähler*in.
- Die Figur kann sehr eigen sein in Sprache oder Verhalten; sie kann unsympathisch sein oder ein komplexes Krankheitsbild, einen komplizierten Background etc. haben. Doch Ziel ist fast immer, dass wir der Figur und ihren Problemen so nah wie möglich kommen. Die Welt aus ihren Augen sehen.
- Oft gibt es EIN zentrales Thema im Buch, z.B. „Loslassen“, „Vertrauen fassen“, „zu sich selbst Stehen“ etc., und alle Figuren, alle Subplots etc. behandeln Facetten und Aspekte dieses zentralen Themas.
- (Mein Roman hat drei Hauptfiguren, ein halbes Dutzend Perspektiven, Sprünge. YA-Leser*innen wären irritiert, wie viel Distanz durch solche Wechsel entsteht: Um die YA-Zielgruppe anzusprechen, müsste ich mich viel entschiedener, empathischer auf die Seite einer oder zweier Figuren stellen.)
.
Deutschsprachige Jugendbücher sind weniger normiert als US-Titel.
Leider haben sie dafür oft auch weniger Formgefühl: Sie sind amorpher, labbriger erzählt. Ich frage mich oft: „Autor*in? Wie viele Jugendbücher hast DU bisher gelesen? Was genau tust du da, für wen?“ Die Bücher sind kürzer. Und: meist jünger, optimistischer, harmloser. Sprachlich und psychologisch weniger komplex.
.
Zwei Probleme bei meiner Auswahl: Auch, weil viele der erfolgreichsten Klassiker auf dem deutschen Markt Märchen- und Fantasy-Elemente enthielten, gibt es aktuell eine Flut von Prinzessinnen-, Elfen- und Zauber-Romanen, meist „nur für Mädchen“. Sowie irrsinnig viele Jugend-Dystopien, die ich als schwache Kopie von „Hunger Games“ etc. lese. Beides: oft sexistisch, abgedroschen, klischiert.
Mir fehlen männliche Autoren, die ausschließlich Jugendbücher schreiben: Ich finde Jugend-Krimis von Krimi-Autoren, Jugend-Sci-Fi von Sci-Fi-Autoren, Jugend-Thriller von Thriller-Autoren. Die Jugendbücher dieser Männer kommen mir oft vor wie Nebenbei- oder Light-Projekte. Mein Erfahrungswert: Je hauptberuflicher, desto ambitionierter und intelligenter ist das Jugendbuch..
.
Sieben Favoriten, die ich gern übersetzt sähe:
.
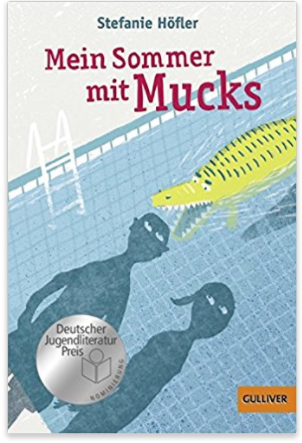
STEFANIE HÖFLER, „Mein Sommer mit Mucks“
- Jugendbuch ab ca. 11 | Ich-Erzählerin ist ca. 12
- Mädchen trifft einen exzentrischen Jungen im Schwimmbad; sie werden Vertraute.
- Beltz & Gelberg, 140 Seiten, 2015
- Perlentaucher, Goodreads, Amazon
„Zonja besitzt eine unbezwingbare Neugier, weshalb die meisten in ihrer Klasse sie für eine Spinnerin halten. Egal. Zonja mit Z liebt es, im Schwimmbad Leute zu beobachten und Statistiken aufzustellen, und so fischt sie an diesem Tag einen Jungen – grüne Badehose, dünn wie eine junge Birke, abstehende Ohren – aus dem Wasser, weil der nicht schwimmen kann. Seltsam. Sie spielen Scrabble, beobachten den Sternenhimmel und essen viele Pfannkuchen – eigentlich ist Mucks der erste Mensch seit Jahren, der ihr Freund werden könnte. Doch irgendwas stimmt überhaupt nicht mit ihm, und es dauert diesen einen Sommer, bis sie weiß, warum er im Regen tanzt und was es mit den blauen Flecken und dem Pfefferspray auf sich hat.“ [Klappentext, ungekürzt]
.
Ein pubertäres, idealistisches Mädchen im Stil von Lisa Simpson (talentiert, aufgeweckt, doch ziemliche Scheuklappen) mit harmonischen Eltern, liebevoller Oma, hübschem Garten etc… in einer nicht-sehr-großen, wohlhabenden (süddeutschen?) Stadt. Ein introvertierter, aber liebenswerter Junge aus einfachen Verhältnissen, dessen Vertrauen sie gewinnt. Ein Handlungsraum und Tonfall, in dem auch kleine Schritte (nachts die Sterne beobachten; den Mut fassen, an einem fremden Wohnblock in einer „schlechten“ Nachbarschaft zu klingeln usw.) angemessen dramatisch erzählt werden:
„Mein Sommer mit Mucks“ ist das schönste, wärmste, liebevollste, zugänglichste Jugendbuch, das ich seit Jahren las. Genug Tiefgang und eine intelligente Grundfrage – Wie weit kann man gehen, um jemandem zu helfen, der sagt, er brauche keine Hilfe? – um sich als Schullektüre zu empfehlen. Und so frei von Zeit-, Medien- und Gegenwarts-Bezügen, dass es in jeder Sprache funktioniert und für fast jede Altersgruppe: Stefanie Höfler hätte das Buch auch 1996 schreiben können, oder spielen lassen.
Als Autorin macht sie mir das eher unsympathisch – weil für mich Social Media, Serien, Kino etc. zu Jugend und Alltag gehören. Und, Grundproblem: Fehlen Jugendbücher mit dem Plot (A) „Bürgerliches Mädchen mit idyllischem Umfeld hat kurz Sorgen, wegen einem sozial schwachen Jungen“? Oder (B) „sozial schwacher Junge kennt nur häusliche Gewalt, Armut und Frauenhass“? (B) wäre mutiger. Und ginge tiefer.
Schwächen:
- Betuliche, altbackene Sprache… die zwar zur sehr behütet aufwachsenden Erzählerin passt, doch auf mich arg saturiert, provinziell, bieder, tantig wirkt: Stefanie Höfler ist eine irrsinnig sympathische Erzählerin. Als Stilistin finde ich sie gestrig.
- Wenige Illustrationen – die der Geschichte nichts vermitteln/hinzufügen.
- Plot und Figuren sind großartig universell, zeitlos. Das heißt auch: Der spezifische Handlungsort, die Zeit etc. bleiben vage. Das Buch aus dieser Auswahl, dem Gegenwärtigkeit & „Sense of Place“ am egalsten sind, und das am wenigsten über Deutschland erzählt.
.
STEFANIE HÖFLER, „Tanz der Tiefseequalle“
- Jugendbuch ab ca. 12 | Ich-Erzähler und Ich-Erzählerin sind ca. 12
- angepasstes Mädchen traut sich nicht, freundlich zu einem übergewichtigen (und: exzentrisch-schrullig-selbstverliebten) Jungen zu sein.
- Beltz & Gelberg, 190 Seiten, 2017
- Perlentaucher, Goodreads, Amazon
„Manchmal ist es diese eine Sekunde, die alles entscheidet: Niko, der ziemlich dick ist und sich oft in Parallelwelten träumt, rettet die schöne Sera vor einer Grapschattacke. Sera fordert Niko daraufhin zum Tanzen auf, was verrückt ist und so aufregend anders, wie alles, was in den nächsten Tagen passiert. Vielleicht ist es der Beginn einer Freundschaft von zweien, die gegensätzlicher nicht sein könnten – aber im entscheidenden Moment mutig über ihren Schatten springen.“ [Klappentext, ungekürzt]
.
Niko ist für mich eine Kunstfigur: ein optimistischer, tagträumender, onkelig-altklug-distanzierter Nerd, der davon träumt, mit schrulligen Erfindungen den Alltag aller Menschen zu verbessern. In altkluger, künstlicher Sprache schreibt er über Klassenkameradin Sera – die er langsam aus der Reserve lockt und von der er hofft, sie sei anders als die vielen oberflächlichen Kinder, die ihn mobben.
Auch Sera ist Ich-Erzähler: In jedem zweiten Kapitel wägt sie ab, was es für ihren Status auf dem Schulhof bedeutet, wenn sie mit einem Außenseiter lacht und Zeit verbringt. Auf einer Klassenfahrt versucht Sera, für Niko Flagge zu zeigen – doch alles geht schief, und die beiden trampen, getrennt von ihrer Klasse, nach Hause.
Schwächen:
- Sera ist ein Archetyp, den ich in der Schulzeit oft sah – doch kaum kenne, verstehe: ein Mädchen, das nicht auffallen will. Nicht als Pathologie oder große Charakterschwäche. Sondern einfach, weil das leichter ist. Was widerfährt so vielen Mädchen ab ca. 12, bis/dass sie glauben, es sei lebenswichtig, unter dem Radar zu bleiben? Ich hätte mir von Höfler mehr Tiefgang, bessere Antworten gewünscht.
- Nikos schrullige und altbackene Sprache passt gut zu Höflers eigenem, meist biederem Stil. An zu vielen Stellen aber klingt Niko komplett artifiziell. Ein Junge voller Selbsthass wäre mir lieber gewesen als jemand, dessen drollige Exzentrik deutlich mehr Raum nimmt als die… Body Issues.
- Niko ist großherzig, charmant und entspannt. Tatsächlich aber tragen die meisten gemobbten Jungs den Hass, den sie erfahren, an z.B. die Mädchen, in die sie sich erfolglos verlieben, weiter: Ich kann mir eine MENGE ca. 14jähiger Arschloch-Jungs vorstellen, die das Buch lesen, sich sagen „Auch ich wurde von einer dummen Fotze in die Friendzone gesteckt. Dabei bin ich so ein netter Kerl!“ Niko ist für mich eine Ausnahme, eine Fiktion.
.
ANKE STELLING, „Erna und die drei Wahrheiten“
- Jugendbuch ab ca. 11 | Ich-Erzählerin ist 11
- Soll Erna einen scheußlichen Mitschüler verpetzen, unter dem alle leiden? Alle in der Gemeinschaftsschule mahnen: Nein – nimm bitte immer Rücksicht!
- cbj, 240 Seiten, 2017
- Perlentaucher, LovelyBooks, Amazon
„Warum steckt in „Gemeinschaft“ auch „gemein“? Solche Fragen interessieren Erna Majewski, 11. Sie besucht eine Gemeinschaftsschule und lebt, wie ihre Freundinnen Liv und Rosalie, im gemeinschaftlichen Wohnprojekt. Dass das ganze Gemeinschaftsgetue ungerecht und sogar verlogen sein kann, erleben Erna und ihre Freundinnen, als nach dem Schulfasching jemand mutwillig die Klos ruiniert hat: Weil der Täter sich nicht meldet, sollen jetzt alle dafür büßen. So eine Gemeinheit! Liv lässt das kalt, aber Erna ermittelt. Und sie findet heraus, was passiert ist. Aber soll sie es auch verraten? Schließlich gibt es laut einem Sprichwort drei Wahrheiten – deine, meine und die Wahrheit. Und wer kann die schon ertragen?“ [Klappentext, ungekürzt]
.
2015 war Anke Stellings (Erwachsenen-)Roman „Bodentiefe Fenster“ auf der Longlist des deutschen Buchpreis‘: Eine Ich-Erzählerin mit Kindern und lapidarem Ehemann, zunehmend verzweifelt in einem Gemeinschaftswohnprojekt im Prenzlauer Berg. Linke Idealisten und Kreative, die sich Eigentumswohnungen bauten; doch deren Freundschaften während endloser Öko-, Achtsamkeits-, Bio-Debatten im Plenum starben. Ich mochte das Buch… doch wurde beim Lesen müde: Ist das Satire? Rollenprosa einer irr zergrübelten, analytischen, gehemmten Mutter – privilegiert und trotzdem prekär? Die Grübel-Ich-Erzählerin war so unentschieden, stellte ihre Gefühle so schnell in Frage, relativierte jeden Gedanken… Der Roman verlor Schwung. Jeden Gedanken mit einem Gegen-Gedanken zu kontern und dabei immer schneller zu pendeln… das wurde, gegen Ende, freudlos und zerquält. Ohne, dass ich noch sagen konnte: „Klug hinterfragt!“
„Erna und die drei Wahrheiten“ spielt im selben Milieu. Mit einer elfjährigen Hauptfigur, genauso zergrübelt, fragend, nervös. Aber: Das Jugendbuch ist kürzer, spitzer, schärfer, witziger und zieht sich, anders als „Bodentiefe Fenster“, nicht ständig selbst durch Über-Analysieren den Boden unter den Füßen fort.
Ein oft brillanter Ton, der die maximal unbequemen Fragen in den witzigsten Momenten stellt – kindgerecht, doch für jedes Alter empfehlenswert. Den Erwachsenen aus „Bodentiefe Fenster“ wollte ich zurufen: Trennt euch! Zieht aus! Tut irgendwas und zieht es durch! Ihr habt alle Möglichkeiten!“ Erna, 11, hat keine Optionen. Das macht ihr Buch so dringlich, intensiv, klug. Ein Tonfall wie in den besten „Peanuts“-Strips: melancholisch, clever… und trotzdem irr süffig, lebenslustig, leicht!
Schwächen:
- Erna liebt seltene Worte, hat immer ein etymologisches Wörterbuch dabei. Das ist, im Rahmen des Buchs, okay. Doch mich langweilt, dass DREI von sieben Kinder-Ich-Erzähler*innen hier auf der Liste seltene Worte sammeln, über die Schönheit von Vokabeln philosophieren. Ein Bildungsbürger-Kinderbuch-Klischee – das nochmal doppelt nervt, falls Figur und Autor dann auch noch Youtube, Whatsapp usw. ostentativ egal sind. [Erna schimpft immerhin, dass sie kein eigenes Tablet hat; und sie mag schlechte High-School-Filme.]
- Ein abruptes Ende. Ich glaube, Ratlosigkeit und ein gewisses Sich-Abfinden sind Stellings Markenzeichen: Über Probleme mit klarer Lösung schreibt sie erst gar nicht.
- Erna hat die zweit-dicksten Oberschenkel der Stufe. Ich mochte, dass das recht spät im Buch zum Thema wird – weil Erna selbst ihren Körper mag, nur unter den abschätzigen Kommentaren leidet. Doch wenn der Verlag Erna zeichnen lässt, will ich beim Blick aufs Buch-Titelbild bitte nicht denken: „schlaksiges, dünnes Mädchen“.
.
DORIT LINKE, „Jenseits der blauen Grenze“
- Jugendbuch ab ca. 13 | Ich-Erzählerin ist ca. 12 bis 16 (Rückblenden) / 17 oder 18 (Flucht)
- Hanna und Andreas aus Rostock schwimmen über die Ostsee – weil sie in der DDR keine Zukunft sehen.
- Magellan, 304 Seiten (TB), 2014
- Goodreads, Amazon
- Link zu geschichtlichen Hintergrund: „Die Ostsee – eine gefährliche Fluchtroute“
„Die DDR im August 1989: Hanna und Andreas sind ins Visier der Staatsmacht geraten und müssen ihre Zukunftspläne von Studium und Wunschberuf aufgeben. Stattdessen sehen sie sich Willkür, Misstrauen und Repressalien ausgesetzt. Ihre einzige Chance auf ein selbstbestimmtes Leben liegt in der Flucht über die Ostsee. Fünfzig Kilometer Wasser trennen sie von der Freiheit – und nur ein dünnes, verbindendes Seil um ihr Handgelenk rettet sie vor der absoluten Einsamkeit …
‚Ergreifend wird hier das Bild einer sozialistischen Jugend zwischen Aufmüpfigkeit und Resignation, Leistungssport und politischer Agitation gezeichnet. Hanna und ihre Freunde finden mit sicherem Instinkt die Brüche im System. Dorit Linke hat die Charaktere glaubwürdig und berührend gezeichnet und eine untergegangene Welt dem Vergessen entrissen.‘ Karen Duve“ [Klappentext, ungekürzt]
.
Hanna, Andreas (…und der alberne, naive, eindimensionale „Sachsen-Jensi“) hadern seit der ca. 7. Klase mit gehässigen Lehrern, Drill, angepassten Kameraden. Jensi hat West-Verwandtschaft: Er darf nach Hamburg ausreisen. Andreas wird vom Vater geschlagen. Er rebelliert, landet im Jugendwerkhof und versucht, sich umzubringen. Ich-Erzählerin Hanna hat einen depressiven/umnachteten Vater. Eine Mutter, die sich nur wünscht, dass Hanna Zöpfe und Röcke trägt. Und einen renitenten Opa, der jedes Schulfest und jede Feier mit staats- und frauenfeindlichen Sprüchen sprengen will. Nach einem Scherz von Opas wird Hanna und Andreas das Abitur verwehrt – und Andreas beschließt, im Neoprenanzug ca. 50 Kilometer in den Westen zu schwimmen. Hanna, die als Sportlerin aussortiert wurde, trainiert in der Schwimmhalle. Auch, weil sie glaubt, dass Andreas unvorbereitet und schwach ist, und ohne sie sterben wird.
Alle ca. 8 Seiten wechselt das Buch von Rückblenden aus der Schulzeit (oft: schleppend, mit recht durchschaubaren Figurenkonflikten) zur Gegenwart: toll recherchierte, dramatische Survival-Action auf der Ostsee, blendend geschrieben. Hanna spricht und entscheidet extrem pragmatisch: Ich musste an „Hunger Games“ denken – denn wie Katniss liebt auch Hanna ihren Survival-Partner… doch hält ihn für leichtsinnig, zu weich, einen Klotz am Bein.
Eine sehr erwachsene, oft rhythmische Sprache. Eine Autorin, die ihr Milieu *sehr* genau kennt. Ein actionreiches, beklemmendes, oft erwachsen-unsentimentales Buch – ambitioniert, literarisch auf hohem Niveau. Passt auf den US-Markt, wo Action-Historien-Titel wie „Code Name Verity“ zu YA-Bestsellern wurden.
Schwächen:
- Unmengen an DDR-Jargon? Das öffnet eine fremde Welt. Dass sich Vieles erst im Kontext erschloss? Kein Problem. Doch ich hatte den Eindruck, dass besonders in den dialog-intensiven Rückblenden auf jeder Seite fünf bis acht Idiome, Sprüche, Floskeln, Markennamen etc. aus der DDR gehäuft wurden. Als würde die Autorin eine Liste abarbeiten. Auf Kosten des Erzählfluss‘.
- Am störendsten: Sachsen-Jensi und Opa erzählen gern Witze, manchmal drei oder vier am Stück. Auf 300 Seiten gibt’s 40, 50 (?) sehr zeit-spezifische Ost-Kalauer. Alle wären lost in translation. Mich haben sie beim Lesen gebremst: Sie nervten, in ihrer Monotonie.
- „Sachsen-Jensi“ ist wie eine noch dümmere, feigere, faulere Version von Ron aus „Harry Potter“: eine eindimensionale Figur mit dümmlichen Slapstick-Problemen wie zu kleiner / zu großer / gerissener / hässlicher Kleidung.
- Eine Übersetzung bräuchte Fußnoten, ein ausführliches Glossar – oder viele ergänzende Halbsätze wie „Wir gingen in den Intershop, wo man nur mit Fremdwährung einkaufen konnte.„
.
CHRISTIANE NEUDECKER, „Sommernovelle“
- Literatur, hätte mir ab ca. 14 gefallen | Ich-Erzählerin ist 15
- 1989: Zwei Freundinnen aus Süddeutschland machen ein Praktikum auf einer Vogel-Beobachtungsstation an der Nordspitze von Sylt.
- Luchterhand, 160 Seiten, 2015
- Perlentaucher, Goodreads, Amazon
- detaillierte Nacherzählung der Handlung, Dieter Wunderlich
„Ein Sommer, wie es ihn nur in der Kindheit oder Jugend gibt: In den Ferien arbeiten zwei 15-jährige Schülerinnen auf einer Vogelstation direkt am Meer. Sie streifen über die Nordsee-Insel und lauschen den Trillergesängen der Austernfischer, zählen Silbermöwen am Himmel und führen Kurgäste durch das schillernde Watt.
Pfingsten 1989: Lotte und Panda wollen die Welt verändern. Es ist die Zeit kurz vor der Wende, in der es für Jugendliche in der BRD vor allem Nord und Süd gab, nicht aber Ost und West. Deutschland liegt noch im Schatten der Wolke von Tschernobyl und jedes Gewitter bringt sauren Regen. Die beiden Freundinnen sind sich einig: Sie wollen handeln. Gemeinsam mit einer bunt zusammengewürfelten Truppe aus Rentnern und Studenten leisten sie ökologischen Dienst in einer skurrilen Vogelstation. Da ist etwa Hiller, der vogelbesessene Pensionär, der Panda in sein Herz schließt und ihr beibringt, das Meer zu deuten und den Himmel zu lesen. Lotte nähert sich dem attraktiven Julian an, der sie für erwachsener hält, als sie tatsächlich ist.“ [Klappentext, gekürzt]
.
Ich hasse, wenn Zyniker Kinder- und Jugendliteratur als Schwundstufe, Light-Version von E-Literatur begreifen. Ich zweifle, dass es einfacher, leichter ist, ein gutes Jugendbuch zu schreiben – und halte Jugendbuchautor*innen nicht für verkrachte Autor*innen zweiter Klasse. Trotzdem kann ich in Jugendbüchern – besonders bei Ich-Erzähler*innen gibt – besser mit Figuren leben, die nicht alles zu Ende denken. Ich las „Sommernovelle“ 2015… und fand das Buch zu harmlos, kurz, plätschernd unentschieden: Christiane Neudecker findet einen liebenswerten Ton. Schafft eine überzeugende Atmosphäre und eine Erzählerin, die man gern begleitet. Besonders tief, dramatisch, hässlich, verstörend oder klug-verdichtet sind die melancholischen Sommer- und Insel-Anekdoten nicht.
Doch übersetzt, und als Jugendbuch vermarktet? Die Ich-Erzählerin kommt mir nah (perfekt bei Jugendbüchern!), funktioniert als Einladung, Identifikationsfläche… doch ist trotzdem so charmant prototypisch-nostalgisch-spezifisch fürs 80er-Jahre-Bürgertum, dass z.B. eine etwas versnobte 40jährige Kanadierin, die sich für übersetzte Literatur interessiert, *sehr* viel wieder erkennen und mögen wird.
Ähnlich gelungen finde ich hier im Buch Sylt: Eine Kulisse, harmlos und einladend genug, dass das Buch als Sommer-, Strandlektüre und Middle-Brow-Novel funktioniert. Doch detailliert und fachkundig genug beschrieben, dass jeder sagen wird: „In diesem sehr deutschen Buch über Deutschland wurde mir eine attraktive deutsche Ecke in schöner Sprache einladend beschrieben.“
Überzeugendes, charmantes, publikumswirksames Zeit- und Lokalkolorit!
Schwächen:
- Ich glaube, je mehr man denkt „Das hier will allergrößte Literatur sein“, desto enttäuschter ist man von diesem sanften, lapidaren Buch.
- „Sommernovelle“ handelt von Jugendlichen, die nicht wissen, wie viel sie erwarten dürfen. Fast alle Erwartungen werden enttäuscht. Deshalb wirkt das Buch etwas… antiklimatisch.
- (Aber: meine Lieblings-Jugendserie, „Willkommen im Leben“/“My so-called Life“, hat das selbe Grundthema. Ich finde tröstend, wenn Jugendliteratur, statt künstlicher Dramatik, zum Thema macht, wie wenig oft passiert.)
.
CHRISTIAN DUDA, „Gar nichts von allem“
- Jugendbuch ab ca. 10 | Ich-Erzähler ist 11
- Der Vater schlägt. Die Mutter vertuscht und entschuldigt. In einem Tagebuch wird Magdi die eigene Machtlosigkeit bewusst.
- Beltz & Gelberg, 140 Seiten, 2017
- Perlentaucher, Amazon
„Der 11jährige Magdi ist glühender Fan des Boxers Mohammed Ali. Denn Ali ist stark, fair und einfach unbesiegbar. Ganz anders als Vater. Der buckelt nach oben und tritt nach unten. Unten, da stehen Magdi und seine drei Geschwister. Und Mutter. Was den arabischen Vater und die deutsche Mutter eint, ist der Wille, »gebührliche« Kinder großzuziehen. Bloß nicht unangenehm auffallen! Deshalb müssen Magdi und seine Geschwister besser sein als die anderen. Und wenn sie nicht besser sind, dann hilft Vater nach.“ [Klappentext, ungekürzt]
.
Ein Tick zu kurz, zu schlicht. Doch dafür: Das Buch hier in meiner Auswahl, das ich jedem noch-so-lesefaulen Elfjährigen in die Hand drücken will. Zugänglich, pointiert und mit zwei, drei markanten Gedanken, Szenen oder Witzen pro Seite. Duda nutzt Sarkasmus, um einem 11jährigen in hoffnungsloser Lage Stimme, Agency, Mut, Spielraum zu zeigen: Im Schreiben versteht Magdi die Dynamiken seines (oft unerträglichen) Alltags.
Ob „Gar nichts von allem“ gefällt/gelingt, hängt an den eigenen Maßstäben: Alles könnte tiefer greifen. Viel länger sein! Geschwister, Nebenfiguren bleiben kaum genutzt. Dass Magdis Mutter als Enablerin / Vertuscherin genauso gefährlich ist wie der gewalttätige Vater, deprimiert mich. Realistisch, dass die Familie in ihrer Dynamik bleibt. Doch schade, dass (außer: Tagebuch-Führen) für keines der Kinder eine Lösung sichtbar wird: Magdi wünscht sich, dass sein Vater stirbt. Ein Wunsch, auch für uns Leser deprimierend verständlich.
Lieblingsstelle: Eine Fußballmanschaft gewinnt ein wichtiges Spiel. Die autoritäre, böse Lehrerin steht auf dem Hof und schreit völlig enthemmt „Sieg! Sieg!“, „als hätte sie das schon mal irgendwo geübt.“ ❤
Schwächen:
- Hier im Buch ist das Meta-Gewäsch über den Zauber der Sprache und die empowernde Macht des Schreibens am stärksten: Magdi ist ein scharfsinniger, gewitzter Ich-Erzähler, genießt das Tagebuchschreiben sichtlich, wird als Figur plausibel. Doch fünf, sechs „XY ist SO ein verrücktes Wort, wenn man genauer darüber nachdenkt…!“-Passagen hätte ich streichen lassen.
- Kleine Illustrationen, die aussehen wie Schmierereien und Tintenkleckse eines nervösen Elfjährigen: Sie passen gut ins Buch – doch fügen dem Text nichts hinzu, und die Motive sind nicht originell.
- Das Buch spielt Mitte der 70er in einer Industriestadt (Ruhrgebiet?); der Klappentext rückt Mohammed Ali in den Mittelpunkt. Tatsächlich sind Plot und Milieu nicht besonders detailliert / zeitspezifisch. Ein halbes Dutzend recht verständlicher, doch nicht sehr origineller Popkultur-Anspielungen werden in einem witzigen, charmanten Glossar kurz erklärt.
- Rezensent Hartmut el Kurdi „rechnet dem Autor hoch an, dass dieser die Probleme nie ethnisiert oder kulturalisiert und die Durchschnittlichkeit einer multikulturellen Identität ebenso thematisiert wie deren Besonderheit. Nicht zuletzt lobt El Kurdi den „authentischen“ Erzählton dieses lesenswerten Buches“. Ich stimme zu. Warne aber: Über den Alltag muslimischer Familien in Deutschland erfährt man hier deshalb eben… relativ wenig.
.
TANYA LIESKE, „Mein Freund Charlie“
- Jugendbuch ab ca. 11 | Ich-Erzähler ist 12 oder 13
- Ein Sommer in Düsseldorf, damit Niks‘ Vater auf dem Bau Geld machen kann. Niks, allein in der Wohnung, wird in den Bandenkrieg der russischen Nachbarn verwickelt.
- Beltz & Gelberg, 170 Seiten, 2017
- Perlentaucher, Bücherkinder, Amazon
„Niks lernt Charlie kennen, als er mit seinem Vater Mahris für mehrere Wochen von Riga nach Deutschland kommt. Während Mahris Arbeit sucht, streunen die Jungen durch die Stadt und Charlie zeigt Niks, was er besonders gut kann: sich unsichtbar machen. Egal, ob in einer Menschenmenge oder in einem Geschäft, manchmal ist Charlie einfach weg. Oft sind dann auch Portemonnaies, Skateboards oder anderes Zeugs verschwunden. Niks ist fasziniert von Charlies Talent.“ [Klappentext, ungekürzt]
.
Das schwächste Buch dieser Auswahl: Ich freue mich, dass eine deutschsprachige Autorin versucht, die Stimme eines jungen Letten einzunehmen. Psychologisch klappt das gut – für mich handelt Niks nachvollziehbar und authentisch. Stilistisch, sprachlich klappt es kaum: Tanya Lieske benutzt viele Floskeln und Sprachbilder aus den ca. 60ern. Das Buch klingt IRRSINNIG altbacken [aber: genau solche Dinge kann eine gute Übersetzung ja ausbügeln/ausgleichen].
Drei Viertel des Romans glücken für mich: Niks, allein in einer deprimierenden Mietwohnung, lernt von seiner Zufallsbekanntschaft Charlie die Kunst des Taschendiebstahls, doch muss dann für dessen Familie in ein Hehler-Haus klettern, damit Charlies russische Hehler-Familie ihre Rivalen, zwei deutsche Hehler-Brüder, bestehlen können. Viel Action. Eine vernünftige, gewinnende Hauptfigur – und ihr liebevoller, hilflos optimistischer Vater: ein Duo, eine Familiendynamik, die mir sehr gefiel!
Leider läuft alles auf einen Klimax hinaus, in dem Figuren entführt werden, Schüsse im Mietshaus fallen, verkleidete Männer Lassos (!) in einer Sozialwohnung schleudern etc. – ein Finale, in dem sich Abgründe auftun, die dann aber – völlig misslungen! – binnen zwei, drei Seiten geklärt sind. Wenn Lieske erklärt, dass eine ganze Mietskaserne den Atem anhält, gafft, die Helden beobachtet… DANN in einer kleinen Wohnung ein Schuss fällt… doch nie jemand nachschaut, nachfragt, die Polizei ruft etc. …bin ich raus.
Schwächen:
- Freund Charlie hat kaum Persönlichkeit, Tiefe, Kontur.
- Seine Verwandten/Geschwister bleiben noch blasser: ein Buch ohne nennenswerte Frauenfiguren.
- Lieske bedankt sich bei einer Kommissarin, die „viel weiß über Bandenkriminilität, Wohnungseinbrüche und Kinder, die in diesem Milieu aufwachsen. Die Wirklichkeit ist um etliches düsterer, als in meinem Roman dargestellt.“ Ich wünschte, der Roman hätte sich näher an dieser Wirklichkeit orientiert, statt…
- …die Geiselnahme zu beenden, indem Niks‘ reicher Onkel aus Amerika maskiert ins Zimmer stürmt und mit Zirkus-Tricks und Lassos zwei Hehler überrumpelt. Auch, dass Niks‘ nicht wusste, dass sein Vater und Onkel im Zirkus erwachsen wurden, schien mir aufgesetzt/hanebüchen.
- Lieske bedankt sich bei einer lettischen Autorin, die ihr viel über Lettland erklärte, und den Jugendkrimi „Spelés Meistars“ schrieb. Im Roman ist „Spelés Meistars“ Niks‘ Lieblingsbuch, wird oft erwähnt – doch an keiner Stelle erfahren wir, worum es geht oder, was das Buch besonders, wichtig macht für Niks. Das wirkt für mich wie… albernes Product-Placement. Oder: eine schlecht durchdachte Gefälligkeit unter Kolleginnen.
- Nachdem wir über 150 Seiten sahen, dass Mahris ein liebevoller, doch finanziell / lebenspraktisch oft inkompetenter Vater ist, sich kaum über Wasser halten kann… eröffnet er einen Zauber- und Artistik-Shop in Riga und wird damit mühelos erfolgreich? Ein Ende, das allem, was zuvor gezeigt wurde über Nöte, Pragmatismus, schmutzige Kompromisse… ins Gesicht spuckt.
.
.