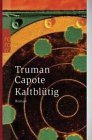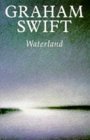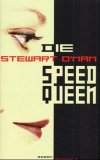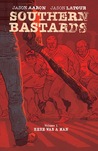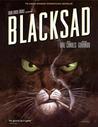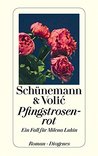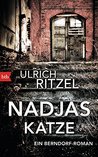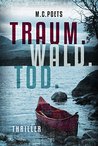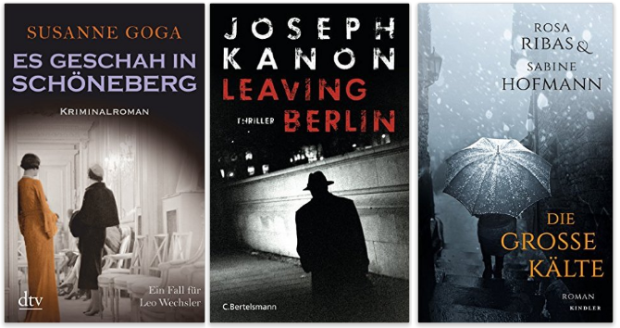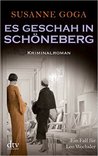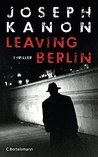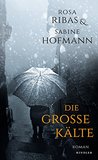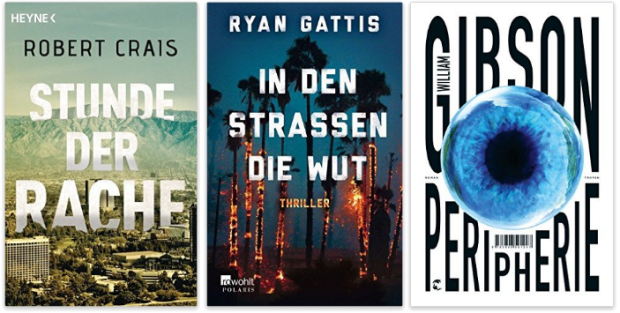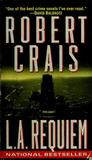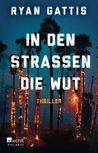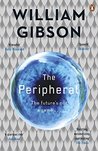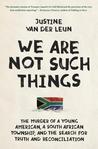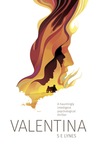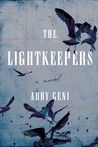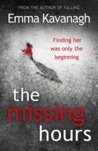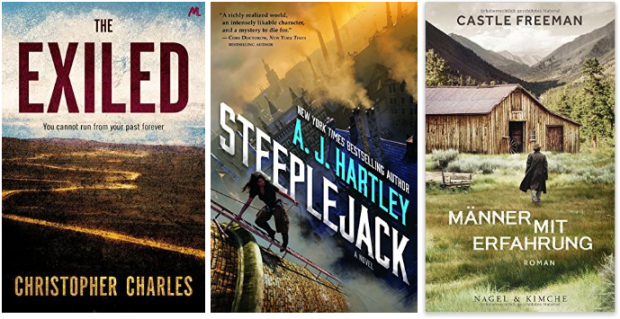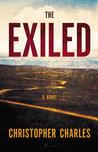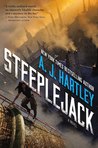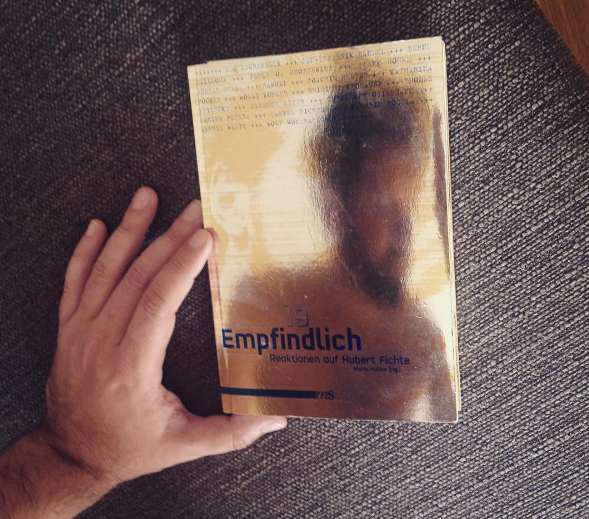Masha Gessen und Ricardo Domeneck beim Empfindlichkeiten-Festival, LCB, 16.07.2016, Berlin. Foto: Tobias Bohm
.
– Artikel in der taz (Stephan Hochgesand)
– Audio-Feature bei WDR 5 (Jenni Zylka)
– ausführlicher Blogpost (Englisch) von Übersetzerin/Bloggerin Katy Derbyshire
– wurstig-desinteressierter Blogpost von Joachim Bessing
– Fotos (Instagram)
– Eröffnungsrede & Interview mit Thorsten Dönges (Künstlerische Leitung)
– Interview mit Samanta Gorzelniak (Künstlerische Leitung)
– Interview mit Ronny Matthes (Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für „Empfindlichkeiten“
– kurz vorgestellt: die literarischen Texte der Autor*innen
– ausführliche Zitate: die persönlichen Statements/Texte der Autor*innen
– drei Diskussionsrunden, Tag 2
– drei Diskussionsrunden, Tag 3
– Mainstream- oder Nischen-Veranstaltung? Blick aufs Publikum
.
Vom 14. bis 16. Juli 2016 lud das Literarische Colloquium Berlin über 30 Schriftsteller*innen ein, öffentlich über Homosexualitäten in der Literatur und ihr eigenes Selbstverständnis als queere Schreibende zu sprechen: ein Literaturfestival mit Lesungen, Vorträgen, Panels, Performances und Konzerten.
„Empfindlichkeiten“!
Ich begleitete das Festival als Blogger, sammelte Stimmen, führte Interviews, schrieb Texte und bereitete Inhalte und Momente für Facebook, Twitter und Instagram auf. Katy Derbyshire schreibt: „The best place at the moment to find out what happened is the #Empfindlichkeiten tag at Stefan Mesch’s blog. Stefan was slogging away to document the panel discussions and events, posting interviews with writers and participants, and generally giving a really good impression of the festival. Great work!“ Vielen Dank!
.
Zum Abschluss, heute: mein Fazit als Literaturkritiker/Journalist.
Lose Notizen & Gedanken zu drei Tagen Festival – den Stärken, dem Potenzial und den Problemen.
.
01_Angenehm kurze literarische Lesungen: An zwei von drei Festival-Abenden wurde Prosa/Lyrik vorgetragen, je 11 bis 15 Autor*innen, zwei Stunden und länger. Das wird hastig, fürchtete ich; zumal bei nicht-deutsch- oder nicht-englischsprachigen Autor*innen nach einer Passage im Original auch noch die englische Übersetzung nachgereicht wurde; gelesen von Katy Derbyshire oder Cameron Mathews. Tatsächlich aber hatte ich großen Spaß, in ungewohnt schneller Folge 11, 12, 15 Kurzlesungen zu hören – entschieden mehr, als 30, 50 Minuten Zuhör-Zeit mit einer einzigen Stimme/Text verbringen zu müssen: Die guten Texte waren Appetizer, machten Lust. Und was mir nichts gab, war nach zehn Minuten vorbei. Gern wieder!
.
02_Marlen Pelny las holprig. Gunther Geltinger stolperte immer wieder über seine Sätze. Raziel Reid las im leiernd-melodiösen, auf mich zu affektiert wirkenden Tonfall, in dem fast alle nordamerikanischen Männer Prosa vortragen: ein schlaffer Singsang. Aber: Marlen Pelny gab danach ein Konzert. Geltinger war schlau, wach, ein Gewinn fürs Festival. Und Reid sagte im Diskussionspanel viel Kluges. Ich mag, wenn Autor*innen auf Festivals mehr als einen Auftritt haben, mehr als eine Rolle spielen. Nicht jede*r kann alles. Doch jede*r hatte bei „Empfindlichkeiten“ Chancen, einen schlechten Eindruck oder ein schwächeren Text auszugleichen.
.
03_Ich mochte, wie leidenschaftlich und präsent Thorsten Dönges durch die Tage führte: Er wirkte nie gehetzt oder aufgeregt – doch jede Geste machte klar, wie sehr ihm diese Begegnungen am Herzen liegen. Mit-Kuratorin Samanta Gorzelniak schien mir sehr aufmerksam, alert, eine gute Zuhörerin/Gastgeberin… ich wünschte nur, sie hätte öffentlicher gesprochen, moderiert, sich selbst mehr Raum als Expertin genommen. Und: Ich denke, die Kellner*innen und das Catering, die LCB-Belegschaft und die Technik sind zum Großteil heterosexuell. An keiner Stelle aber hatte ich den Eindruck, dass jemand amüsiert, exotisierend, von oben herab auf Autor*innen und Publikum blickt: „Huch. Heute haben wir vielleicht Leute hier bei uns im Haus… interessant!“ o.ä.
.

Ahmed Sami Özbudak. Foto: Tobias Bohm
.
04_Es gab sechs große Diskussionsrunden – je vier bis sechs Auto*rinnen, dazu Moderation, ca. 70 bis 90 Minuten, je zweimal zum Stichwort „Körper“, „Maske“, „Schrift“. Die drei Begriffe waren zentral für Hubert Fichte, dessen „Geschichte der Empfindlichkeit“ auch für den Namen des Festivals Pate stand. Doch besonders bei „Maske“ führte das zu mürben Grundsatzdebatten um Begrifflichkeiten, Definitionen. Autor*innen, Akademiker*innen legen oft jedes Wort auf die Goldwaage. Fünf, sechs von ihnen einen Begriff wie „Maske“ vorzusetzen, muss in Geschwafel enden. Das nächste Mal vielleicht lieber… eine offen formulierte Frage, als Motto/Leitbegriff der Runde?
.
05_Meine beiden Lieblingspanels hatten nur vier Autor*innen (Freitag: „Körper“ mit Perihan Magden, Roland Spahr, Antje Rávic Strubel, Michal Witkowski; Samstag: „Körper“ mit Niviaq Korneliussen, Masha Gessen, Izabela Morska und Ricardo Domeneck; Zusammenfassung hier und hier). Gessen war so wortkarg, dass ich in 70 Minuten nur drei Menschen (plus Moderator) kennen lernen musste – viel schöner als die Sechser-Runden, auf denen jeder Gast zwei Sätze spuckt, dann wieder Statist*in bleibt, ohne Zeit für Wortwechsel, Dialoge, längere Gedanken. Mir gefällt, dass das Festival fast allen vorlesenden Autor*innen auch einen Platz in Diskussionspanels bot. Doch die Zusammensetzungen schienen beliebig, die Panels überfüllt, und viele Gäste gingen unter/blieben blass.
.
06_Großartig, während der sechs Panels immer neu zu sehen: Abdella Taia, Angela Steidele, Saleem Haddad hören den Kolleg*innen interessiert, respektvoll zu, im Publikum und melden sich später mit kurzen Kommentaren, Fragen. [Auch Joachim Helfer, Kristof Magnusson und Hilary McCollum sah ich dauernd – sie kommentierten nur weniger.]
.
07_Es waren deutlich mehr Männer als Frauen geladen – und einige Autor*innen blieben lange still. Besonders von Suzana Tratnik und Sookee hörte ich auf Panels fast nichts (Sookee war später, beim Vortragen/Rappen, toll). Masha Gessen, für mich der stärkste journalistische/literarische Text im Vorfeld, wirkte lustlos. (Bei den Männern gingen für mich Ahmet Sami Özbudak und Jayrome C. Robinet etwas unter.) Falls es ein Folge-Festival geben wird: mehr Frauen – und unbedingt Bedingungen schaffen, in denen sie mehr/länger sprechen können und wollen.
.

Hilary McCollum. Foto: Tobias Bohm
.
08_Unter den Besucher*innen gab es kaum Teenager. Kaum Studierende. Ich sah keine englischsprachigen (Nur-) Besucher*innen (…obwohl fast jeder Satz auf Englisch gesprochen wurde). Auch Frauen 50+ – sonst: auf Lesungen das Gros des Publikums – fehlten. Interessant, dass ich (auch abends) keine schwulen/lesbischen Zärtlichkeiten und Public Displays of Affection sah. Nur zwei (ältere) heterosexuelle Pärchen, die sich küssten und streichelten.
.
09_2008 war ich Mitglied der Künstlerischen Leitung von PROSANOVA. Es gibt keine perfekten Festival-Autor*innen – man wägt beim Einladen immer ab: Wer schreibt toll? Wer ist bekannt? Wer kann über seine Arbeit gut öffentlich sprechen? Wer ist nett? Wer ist Geheimtipp/Entdeckung? Und dann: Bitte auch eine große Bandbreite, Diversity, ausgewogenes Geschlechterverhältnis, interessante Unterschiede. „Empfindlichkeiten“ löste, balancierte das recht gut – alles in allem.
..
10_Mein Musikgeschmack ist recht eng/einseitig – deshalb ließen mich die vier, fünf Konzerte im Lauf des Festivals recht kalt. Aber: sehr gut, dass es sie gab! Genau wie das Orakel/Puppenspiel, der Auftritt der Drag Queen und, besonders, Künstlerin Martina Minette Dreier, die wie eine Gerichtszeichnerin Gäste und Besucher*innen skizzierte, portraitierte. Ich war lange in Toronto und mag Drag-Queens, die energisch, bitchy, dramatisch performen, moderieren oder lipsynchen. Das eher pointenlose Zwischenspiel der Drag Queen Oszillar am Eröffnungsabend erschien mir schlaff/lapidar – und drittklassig. Gern wieder Drag-Acts. Doch das geht besser!
.
11_Ich kenne nur Festivals, bei denen zehn bis fünfzig Mitarbeiter*innen hochnervös in einem Festivalbüro jonglieren, schwitzen, kämpfen. „Empfindlichkeiten“ hatte einen entspannten Büchertisch, solides Catering, jederzeit ansprechbare Gastgeber. Sympathisch, dass LCB-Leiter Florian Höllerer am Samstag noch bis Mitternacht Equipment und Bühnenteile durch den Garten schob/trug – doch selbst dabei schien niemand zu schwitzen: Das Festival war… fast surreal professionell. Hotels, Flüge, teilweise Dolmetscher*innen… Autor*innen, tagelang betreut – und ich sah nichts stocken, missglücken. Respekt!
.

Marlen Pelnys Band Zuckerclub. Foto: Tobias Bohm
.
12_Hubert Fichte gehört zu meinen Lieblingsautoren: 2007 las ich fünf seiner autobiografische Romane. Trotzdem irritiert mich, dass er (nur) auf den ersten Blick absurd zentral fürs Festival wirkte: Er ist auf dem Begrüßungsbanner abgebildet, der Programmtext besteht aus einem sehr langen Zitat, der Festivalname verweist auf die „Geschichte der Empfindlichkeit“. Während des Festivals spielte Fichte dann kaum eine Rolle: Viele Autor*innen, besonders aus dem Ausland, kannten ihn nicht oder wollten nichts über ihn sagen; die Ausstellung der Leonore-Mau-Fotos wirkte recht nebensächlich (…liegt sicher auch am Internet: zehn, fünfzehn großformatige Fotos, das hat für mich seit Google, Tumblr wenig Schauwert); und ich verstehe, dass Fichte ein wichtiger Gast am LCB war, 1963 – aber dann vielleicht doch lieber: ein Expertenvortrag von Roland Spahr; ein ausführlicher Flyer zu den Fotos; eine Website mit allen LCB-relevanten Zitaten/Passagen aus Fichtes „Die zweite Schuld“. Und: Kathrin Röggla ist in meinen Top 10 der angenehmsten, menschlich tollsten Auto*rinnen – doch ihre Fichte-Rede am Eröffnungsabend hat mich (…als jemand, der Fichte halbwegs kennt, sehr mag) überfordert: Ich konnte Röggla erst folgen, als ich die Rede nochmal schriftlich vor mir hatte. Ich höre Röggla gern frei sprechen. Ihre Texte lese ich mit Leuchtstift, Textmarker. Doch wenn sie eigene Texte laut verliest, bleibt für mich nie viel hängen.
.
13_Ich bin nicht sicher, ob die nicht-deutschen Autor*innen verstanden, wie das LCB funktioniert, was es auszeichnet usw., und so sehr ich mich freue, dass „Empfindlichkeiten“ ein öffentliches Festival war, keine geschlossene Tagung, frage ich mich: Braucht es genauere Fragen oder Aufgabenstellungen, eine Vorbesprechung, ein Briefing? Masha Gessen z.B. hatte offenbar erwartet, mehrere Tage lang Textarbeit/-exegese mit Kolleg*innen zu machen – und schien teilnahmslos oder enttäuscht.
.
14_Toll, dass es einen Reader gab mit literarischen Texten (das meiste: in englischer Übersetzung), zum Blättern und Nachlesen. Bei vielen dieser Texte hatte ich das Gefühl, Autor*innen haben ihre lesbischste/schwulste Passage eingereicht, nicht die erzählerisch beste – doch das Lesen, Entdecken machte Spaß. VIEL besser aber fand ich die persönlichen Statements/Poetiktexte, die fast alle Gäste im Vorfeld des Festivals zusammentrugen. Ich las das als digitales .doc – und glaube, öffentliche Reader oder eine Online-Version wären fürs Publikum ein großer Gewinn gewesen [eine Blog-Version ist in Planung, und auch in „Sprache im technischen Zeitalter“ werden die Statements noch einmal verlegt]. Sehr gut: Der Tagesspiegel/Queerspiegel druckte einige Essays im Rahmen der Festival-Berichterstattung. Saleem Haddads Text gehört zu den klügsten und für ein breites Publikum relevantesten – und ich bin froh, dass er so prominent in einer Tageszeitung erschien.
.
14b_Mich irritiert, dass Niviaq Korneliussen in Diskussionen wortgleich die selben Sätze sagte, die sie im Statement / Essay formuliert hatte. Sie wirkte sympathisch, souverän – doch ich unterschätze oft, wie ungern viele Autor*innen einfach losreden, öffentlich frei erzählen. Wie macht man schreibenden Gästen klar: Alles kann – nichts muss?
.

Cameron Mathews. Foto: Tobias Bohm
.
15_Gut, dass auf Facebook zu „Empfindlichkeiten“ eingeladen wurde: Ich hatte das Festival online recht früh auf dem Schirm und wurde immer wieder daran erinnert, wie viele Kolleg*innen und Bekannte kommen wollen. Die Infos auf der LCB-Website aber waren mir zu knapp und leidenschaftslos: keine Autor*inneninfos und -Fotos, kein Text über Ausrichtung und Stellenwert/Größenordnung/Zielgruppe des Festivals. Gab es auf dem Festival selbst nochmal ein längeres Programmheft – oder nur die Flyer? Falls nicht: Wer erklärt mir im Vorfeld des Festivals, wer Robert Gillett oder Mario Fortunato sind – und warum ich mich auf sie freuen soll?
.
16_Ich wünsche mir Expert*innen für lesbische Literatur, ich wünsche mir Buchtipps, Fundstücke, Begeisterung: Ich habe lesbische Lieblingsautorinnen (z.B. meine Lieblings-Jugendbuchautorin, A.S. King), aber bin kaum anglophil und konnte mit Virginia Woolfs „Orlando“ nichts anfangen. Der schwule Kanon ist dichter: Menschen verweisen auf Wilde oder Henry James oder Walt Whitman oder Marcel Proust. Doch fünfmal auf dem Festival zu hören: „Lesbische Liebe und lesbische Literatur bleiben unsichtbar – mit Ausnahme von… nehmen wir mal… als Beispiel: ‚Orlando‘.“ deprimiert mich. „Orlando“ als Allzweckwaffe, ewig einzige Referenz – das kann nicht alles sein!
.
17_Drei Gäste, die mir Mühe machten: Izabela Morska riss die Augen panisch auf und sprach viel zu schnell – bei mir kam nichts an, akustisch/inhaltlich, nie. Als sie am Abschlussabend einen Text vorlas – langsamer, verständlich – war ich ratlos: Ich weiß nicht, warum sie zwei Tage durch Sätze und Assoziationen rast, mit ängstlichem Blick, nervös und wirr. Und: Moderator Joey Hanson schien mir sympathisch – doch er benutzt Uptalk/Upspeak. Zum Ende jedes Satzes hob die Stimme, als stellte er… eine Frage? Das ist irrsinnig… anstrengend? Denn damit wirkt er… läppisch und… unvorbereitet? Er stellte die Bücher und Autor*innen in lustlosen, kurzen Floskel-Sätzen vor, als hätte er Zusammenfassungen aus Wikipedia kopiert. Und fragte ständig auf der Bühne nach, ob er einen Namen richtig ausspricht. Bitte: Lieber vorher fragen! Denn jeder Satz wirkte unsicher, uninformiert… und super-gleichgültig den Texten und Schreibenden gegenüber.
.
18_Ich will nie wieder in einem Raum mit dem Poeten sein, der für die flachsten Gedanken zehn Minuten Redezeit braucht – doch jedes Mal genervt die Augen rollt, alles Interesse verliert, wenn jemand anderes spricht. Egoman. Rücksichtslos. Selbstverliebt.
.
19_Eine Freundin, die oft auf Festivals eingeladen wird, muss sich gelegentlich zwingen, interessiert, dankbar, demütig zu wirken: „Für die Veranstalter ist ihr Event das Größte. Aber manchmal muss ich direkt danach zum Bahnhof weiter – habe einfach keine Zeit, mich einzuarbeiten.“ Viele Autor*innen waren sehr präsent, respektvoll, interessiert: Luisgé Martin… obwohl er ohne Übersetzerin wenig verstand. Ricardo Domeneck… der auf Facebook oft polemisch misanthrop klingt, doch das ganze Festival über herzlich und geistreich wirkte. Edouard Louis… kritisch, aber ohne Allüren. Die Moderator*innen stellten fast nur weiche, freundliche Fragen. Niemand aus dem Publikum wollte sich mit Besserwisserei oder Polemik profilieren. Ich fand EINEN Gast unerträglich. Und zwei, drei weitere Autor*innen eher saturiert, gelangweilt. Doch überraschend viele Beteiligte hatten grandios großen Respekt vor dem Festival – und voreinander.
.
20_Sollte ich einen längeren Artikel schreiben über die Poetiken und Standpunkte des Festivals, der Text würde von Abdella Taia handeln, Alain Claude Sulzer, Kristof Magnusson und Raziel Reid. Ich sage oft, dass mich klassische Fantasy-Konflikte wie „Herr der Ringe“ deprimieren – weil die Figuren fast nur um Leib und Leben fürchten, fast alle Probleme auf den banalsten untersten Stufen der Maslow-Pyramide bleiben: „Habe ich Essen?“, „Obdach?“, „Sind die Pferde gefüttert?“, „Reicht der Proviant?“ Am Eröffnungsabend hielt Abdella Taia eine (zu) lange Rede über die Entbehrungen, Verluste, den existentiellen Mangel, den er als junger Schwuler in Marokko erleben musste. Erschütternd. Aber: in simplem, recht kunstlosen Englisch und ohne komplexere psychologische Nuancen. Ein trauriger, einfacher Erklär-Text – der mir die Augen öffnet, aber nichts mit meinen eigenen, abstrakteren Baustellen zu tun hat, die viel höher auf der Bedürfnispyramide liegen: privilegiertere Fragestellungen, Selbstverortungen von queeren Thirtysomethings, die nicht um Leib und Leben fürchten. Magnusson und Reid schienen mir am wachsten, interessiertesten an aktuellem queeren Mainstream, an den Konflikten und Bruchstellen von Wohlstandskindern, den medialen Kulturkämpfen um queere Identität: Wonach schwule Männer in Marokko hungern, will ich lesen, aufnehmen, verstehen. Doch schreiben kann ich besser, wonach in meiner Welt gehungert wird. Älteren Autoren wie Sulzer, schien mir, sind solche Nachgeborenen-Diskurse eher fremd: Identity Politics. Queere Jugendbücher. PC. Schwulsein auf Tumblr. Die Strahlkraft glücklicher schwuler Pärchen in einer Sitcom oder Seifenoper. 50 Geschlechts-Optionen bei Facebook. Klingt alles erstmal läppisch – doch ich glaube, wir brauchen Essayist*innen, Erzähler*innen, Kulturbeobachter*innen – die erklären können, warum es große Fässer öffnet.
.

.
zum Blog: Hin und wieder – drei-, viermal pro Jahr – begleite ich eine Lesung, Buchmesse, ein Festival oder andere literarische Events journalistisch, als Blogger. Als-Blogger-Berichten ist eine Sonderrolle, die mir auf Live-Veranstaltungen sehr liegt: Ich spreche auch gerne auf Podien oder moderiere – doch „nur“ im Publikum zu sitzen, ist mir zu passiv. Als Blogger kann ich Interviews führen, Bücher finden/vorstellen und für/mit einer größeren digitalen Öffentlichkeit über Fragen, Programmpunkte und Ideen sprechen – öffentlich, online.
Ich mochte „Empfindlichkeiten“ sehr. Habe drei Tage lang dokumentiert, gesammelt, zugehört. Nach Abschluss, jetzt, will ich noch einmal kritischer Bilanz ziehen: Festivals sind viel aufwändiger, teurer als das Verlegen einzelner Bücher. Doch wenn Buch- und Literatur-Macher Festivals planen, haben sie oft das Gefühl, viel weniger zu erreichen: ein paar höfliche Besucher, dankbare Gäste, wenige Artikel und Blogposts. Ich weiß, wie sehr ich mich selbst als Veranstalter jedes Mal nach Feedback, Texten, Dokumentation sehne. Und nahm mir deshalb vor, für „Empfindlichkeiten“ vor allem mit den eingeladenen Autor*innen und Gästen zu sprechen. Text zu schaffen. Dokumentation. Bleibendes.
Für ein Festival bloggen, das heißt: Ich erhalte eine Aufwandsentschädigung und sehe mich, generell, „im Dienst“ des Festivals. Ich halte fest, was mich interessiert, was mir gefällt und zeige in Texten, Snapshots, sozialen Netzwerken, womit/wobei ich mich wohl fühle und was ich im Programm spannend oder relevant finde. Für Kritik ist Platz. Doch ich bin Journalist, Literaturkritiker – und ein Buch bespreche ich lieber in Zeitungen, oft mit einer gewissen Härte. Und immer: Im Wissen, dass ich das Buch einschätzen kann, verstehe, überblicke. Literaturfestivals kann man schlecht überblicken, völlig verstehen, komplett einschätzen:
Jede*r Besucher*in erlebt andere Programmpunkte, hat andere Begegnungen, viel mehr Bewegungs- und Spielräume als beim Lesen eines Texts. Und: Festivals werden von Menschen gemacht, die MONATE ihres Lebens opfern. Es allen Recht machen wollen. Super-angespannt sind und tausend Bedürfnisse und Ansprüche berücksichtigen, gewichten müssen.
Ich finde es wichtig und legitim, als Privatperson in meinem privaten Blog nach Ende des Festivals öffentlich zu sagen: „Dieser EINE Gast war für mich unerträglich.“
Ich fände es legitim, denselben Satz auf den offiziellen Festivalblog zu stellen, während des Festivals – aber: lieber, wenn ich einer von mehreren Blog-Autor*innen bin, eine von mehreren Stimmen. Und ich verstehe, falls der Gast danach die Festival-Leitung fragt, warum er attackiert wird – auf einer Plattform des Festivals.
Ich finde es auch legitim, als Journalist für eine Zeitung über ein Festival zu richten. Aber: Dann wird aus „Stefan Mesch hasst den Lyriker, der nicht zum Punkt kommt“ schnell „DIE ZEIT attackiert einen Lyriker und das Festival, das ihn eingeladen hat.“ Alles denkbar. Aber: verschiedene Schwerpunkte, verschiedene Rollen.
Bei „Empfindsamkeiten“ war ich sehr gern Blogger.
Das Festival für eine große Zeitung zu erklären und zu filtern, nach den Bedürfnissen, Interessen und dem Wissensstand eines Hetero-Mehrheitspublikums, hätte mir weniger Spaß gemacht.
.

Empfindlichkeiten-Festival, 2. Festivaltag, 16.07.2016, Literarisches Colloquium Berlin. Foto: Tobias Bohm