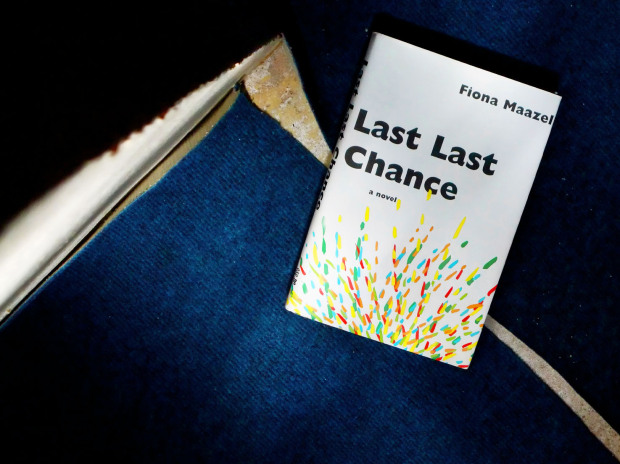Fiona Maazel: “Last last Chance”
Farrar, Straus and Giroux, April 2008
Original: englischsprachig
Roman, 337 Seiten.
.
Der folgende Text ist von 2008:
Ein schnelles, sachliches Gutachten zu Fiona Maazels „Last Last Chance“. Keine Rezension, kein akademisches Essay. Sondern ein nüchterner, kurzer… Gebrauchstext.
Achtung: Spoiler! / Details zum Ende des Buches.
.
Autorin & Themen: Fiona Maazel, geboren 1975 als Tochter des Dirigenten Lorin Maazel, lebt in Brooklyn. Journalistische Arbeiten und Essays für n+1 (2005), Village Voice, Boston Book Review, Salon, Nerve, Yale Review. Bloggerin: http://iferment.blogspot.com/ [bis 2007] und bis 2005 Redakteurin bei der Paris Review.
„Last last Chance“ lässt Lucy Clarke, eine lebensmüde dreißigjährige New Yorkerin, in Ich-Perspektive davon berichten, was mit ihrer Familie und ihren Lebensentwürfen geschieht (Lucy ist schwer drogenabhängig und jobbt in einem koscheren Geflügelmastbetrieb), als eine tödliche Seuche Amerika ins Chaos stürzen lässt: die „Superpest“.
.
Die Exposition: Lucy Clarke ist die rat- und verantwortungslose Tochter der steinreichen, berühmten Hut-Designerin Isifrid Clarke (während des zweiten Weltkriegs aus Norwegen emigriert, selbsternannte Hohepriesterin eines elitären arischen Odin-Kults; Alkoholikerin) und eines bekannten Virologen (Leiter des US-Departments für Seuchenschutz und Erfinder einer neuen, besonders ansteckenden Variante der Pest, von den Medien „Superpest“ genannt).
Der Roman schildert zwölf Monate, während denen die unheilbare „Superpest“ von der West- zur Ostküste vordringt und Tausende Menschen tötet. Die Medien reagieren hysterisch. Die Politiker ratlos. Lucys Umfeld versteckt sich hinter einer zynischen, vernkiffenen Coolness. Lucys Vater hat – schon vor Einsatz der erzählten Handlung – Selbstmord begangen.
Als Ich-Erzählerin reist Lucy im August für ein paar Tage zurück nach Manhattan, um gemeinsam mit einem verwitweten, übergewichtigen Arbeitskollegen – Stanley – die Hochzeit ihrer ältesten und besten Freundin zu besuchen. Lucy quartiert sich im Fifth-Avenue-Appartment ihrer verwitweten Mutter ein, wo auch ihre Großmutter, Agnes, und ihre zwölf Jahre alte Halbschwester, Hannah, leben. Alle drei Generationen sind verstört vom Selbstmord von Lucys Vater im vergangenen Herbst. Und stehen im Mittelpunkt einer medialen Hetzjagd: Lucys Familie hat Amerika die „Superpest“ beschert, übertragbar durch die Luft und in weniger als 24 Stunden tödlich. Ein erster Infizierter wurde in Minnesota unter Quarantäne gestellt.
.
Verlauf der Handlung: Lucy – ständig auf harten Drogen und dauernd im Streit mit den anderen, ebenso angriffslustigen (und benebelten) Frauen der Familie – gesteht sich ein, dass sie keinerlei Perspektiven hat im Leben: Sie weiß nicht, was sie sucht. Sie weiß nicht, was sie werden will. Sie ist noch immer in den Bräutigam verliebt (Eric, Fotograf und Lucys Exfreund). Überlegt, mal wieder eine Therapie zu machen (ihre mittlerweile siebte). Und gibt zu, ihre Zwanziger unter Tranquilizern komplett vergessen zu haben.
Aus Langeweile besucht sie verschiedene Selbsthilfegruppen. Flirtet mit Stanley (selbst ehemaliger Alkoholiker und auf der Suche nach einem Uterus für die gefrorenen Eizellen seiner Frau, verstorben bei einem Autounfall, den Stanley verursacht hat). Und entwickelt zu ihrer verschlossenen, zwölfjährigen Schwester Hannah eine fragile Freundschaft [vergleichbar, auch vom Gewicht innerhalb des Buches, mit dem Verhältnis zwischen Phoebe und Holden in „Fänger im Roggen“]. Immer unter der Prämisse: Die Milch ist verschüttet. Der Ruf ist ruiniert. Ich bin die verantwortungslose, kaputte, selbstsüchtige, scheußliche Generation-X-Klischeefigur. Lucy hasst sich. Hat aber zugleich, als Erzählerin (teilweise das Publikum direkt adressierend) großen Spaß, Erwartungshaltungen zu stören, gespielt cool auf neue Eskalationen zu reagieren, die „Superpest“ für windschiefe, gallige Oneliner zu nutzen.
Lucy und Stanley besuchen Hannah im christlich-antisemitischen Sommercamp. Fahren zu Weihnachten zurück in die Geflügelmast. Und anschließend, im Januar (die „Superpest“ hat eben Kalifornien erreicht, und Oma Agnes ist gerade an Herzversagen gestorben), reist Lucy mit ihrer Mutter in eine Entziehungsklinik in der texanischen Wüste:
Die Seuche befällt Texas. Die Klinik wird zum Waco-artigen Fort. Lucy sucht neue Perspektiven für ihr Leben und hilft nachts, den elektrischen Zaun zu bewachen, der das Heim vor Infizierten schützen soll. Doch bald gibt es auch im Gelände die ersten Toten. Noch bevor die Therapie feste Wirkungen zeigen kann, begreift ihre Lucy, dass ihre Mutter – seit Jahrzehnten auf Kokain – an den Folgen ihrer Sucht sterben wird. Sie begleitet sie (die „Superpest“ ist erstmal eingedämmt) zurück nach New York. Nimmt Abschied. Organisiert eine weitere Beerdigung. Sieht zu, wie ihr alle Menschen in ihrem Leben durch die Finger rinnen und wie sie – als Tochter, Freundin, emotional – NICHTS für sie leisten kann und niemals konnte.
Lucy ist ein wenig masochistisch in ihrer Selbstgeißelung, hat aber, letztendlich, grausam Recht in ihrer Selbsterkenntnis: Sie ist ein nettes Mädchen. Aber komplett nutzlos; für alle!
Resigniert loggt sie sich – kurz, bevor die „Superpest“ plötzlich Manhattan erreicht – bei Ebay ein. Ersteigert eine stillgelegte Raketenabschussbasis. Lädt alle Menschen, die ihr wichtig sind (ihre große Liebe Eric ist mittlerweile an der Pest krepiert; seine Witwe hat gerade sein Kind entbunden) ins Flugzeug. Und plant ein neues Leben – mit den (wenigen) Überlebenden, die ihr noch etwas bedeuten. Abblende.
.
Motive und Besonderheiten: Zentrales Thema des Romans sind ins Leere laufende, verpuffende Gefühle und Anstrengungen. „Vergeudete“ Lebenszeit. „Nutzlose“ Menschlichkeit.
Großmutter Agnes, spirituelles Zentrum der Familie, hat aus der Reinkarnationsleere eine Privatmythologie gesponnen, mit der sie diesen „biografischen non sequiturs“ Sinn verleihen will: Sie glaubt an eine Mischung aus Wiedergeburt, Karma und Vergebung. Und so sprechen in Zwischenkapiteln immer wieder soeben verstorbene Figuren (oder auch: Seelen, die früher jemand anderes waren; ein toter Fötus, ein Wikinger) über die Pest und die aktuellen Ereignisse.
.
Stil: Die Themenfülle des Romans wirkt pastichehaft und grell. Doch Lucy knüpft die vielen, vielen Stränge mit verblüffender Leichtigkeit aneinander, als trockene und sehr wortmächtige Erzählerin. Ein riesiges Vokabular. Eine Fülle schräger, pointierter, grotesker Vergleiche. Schnelle Dialoge, im Stil des popkulturgesättigten Stakkato-Schlagabtauschs der „Gilmore Girls“.
„Last last Chance“ ist frotzelig, pointiert und gut-wrenchingly emotional, in seinem Duktus vergleichbar mit Salinger. Sehr markant. Sehr witzig. Sehr wütend/bitter. Lucy ist eine große, wendige Denkerin. Und Maazel – vom Wirrwarr und dem bunten Durcheinander ihres Plots noch zusätzlich gestützt, bereichert – eine extrem markante neue Stimme [Joshua Ferris vergleich Maazel mit Denis Johnson]
.
Schwierigkeiten: „Last last Chance“ lässt sich gut und schnell vergleichen. Mit der Themenfülle und der „meditativen Tiefe“ von Nicole Krauss [Link, Text von mir]. Der warmen, satten emotionalen Färbung von Filmen wie „Juno“ (eine ätzende Ich-Erzählerin. Und riesige Subtexte über Verletzlichkeiten, Familie, Bruchstellen).
Aber: „Last last Chance“ lässt sich nur sehr sperrig konkret beschreiben: die Liebesgeschichte. Die Familiengeschichte. Die groteske Seuche. Quarterlife-Crisis, Soul-Searching, Schritte aus der Sucht. Maazel hält alle Bälle in der Luft. Doch damit bleibt auch, in der Vermarktung des Romans, eine gewisse Unentschiedenheit.
IST das ein Sucht-Roman? IST das eine Familiengeschichte? Wen will dieses Buch, im Herzen, ansprechen? Beim Lesen wirkt es erstmal einladend und universell und dynamisch. Aber ein deutscher Verlag müsste sich entschieden fragen, welcher Aspekt herausgehoben werden sollte: Ist das eine Groteske? Junge, hippe US-Literatur à Safran Foer? Oder ein Frauen-Ding? Maazel hält sich das sehr offen. Das tut dem Roman sehr gut. Der Leser indes fragt sich öfters mal, was er da eigentlich grade liest (und weiß deshalb auch erst zum Schluss, wie schlüssig/rund das Buch letztendlich ist, thematisch, kompositorisch).
.
Wertung: „Last last Chance“ ist (besonders: durch die grandiose Erzählstimme) eines der markantesten US-Debüts, das ich kenne. Ein kurioses Buch, das viele wohlwollende Pressestimmen nach sich zieht (http://www.lastlastchance.com/, dann auf „What people are saying“), die Leute aber zugleich in einer etwas hilflosen Bewertungsposition zurücklässt: Alle finden’s
- klug
- bunt
- traurig.
Aber ein Familienroman über den Tod, der zugleich Rollenprosa von Wikingern enthält und eine Seuche namens „Superpest“, muss sich halt immer auch gefallen lassen, der „Superpest“-Wikinger- und Hühnermastbetriebs-Roman zu sein. Natürlich ist das, in seiner Abwegigkeit, erstmal sehr spannend. Aber immer auch: gesucht. Gewollt.
Man merkt: In diese 320 Seiten ist JEDES krasse Bild enthalten, JEDER herzzerreißende Moment und JEDE clevere Idee, die Fiona Maazel in den letzten zwei Jahren hatte.
Ein bombastischer Auftritt für eine junge Autorin. Aber: kein sehr eleganter.
Links zu Amazon.de:
- Fiona Maazel – „Last Last Chance“ (Hardcover, Englisch)
- Fiona Maazel – „Last Last Chance“ (Paperback, Englisch)
Moderation [Englisch]: Picador-Gastprofessorin und Schriftstellerin Fiona Maazel im Centraltheater Leipzig, 15. Mai 2012. [Details]
Moderation: Stefan Mesch [Vita / Links]
.
verwandte Links: