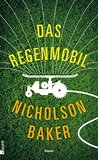.
2005 las ich Nicholson Bakers – eitlen, pompösen, enttäuschend flachen – Holocaust-Roman „Pfeil der Zeit“: Das Leben eines NS-Täters, rückwärts erzählt, beginnend mit seinem Tod in den USA. Ein Buch wie eine Schreibübung: sehr selbstbewusst, gesucht originell… aber mir fehlten Tiefgang und historische Genauigkeit.
Zehn Jahre später las ich drei weitere Bücher von Baker – alle lesenswerter:
.
NICHOLSON BAKER, “Das Regenmobil”
“Paul ist Dichter (mäßig erfolgreich) und vermisst seine Exfreundin Roz, die ihn verlassen hat. Um seinem Leben wieder Sinn zu geben und seinen drohenden Fünfdundfünfzigsten zu vergessen, besorgt er sich eine akustische Gitarre und sattelt auf Pop- und, vor allem, Protestsongs um. Er weiß nicht, was ihm mehr zuwider ist: Amerikas Drohnenkrieg oder Roz’ neuer Freund. Während er auf seinem alten Bauernhof in Maine darüber nachdenkt, erheitern allerlei tröstliche Alltagsvergnügen sein schwankendes Gemüt: sein Traum-Rasensprenger, die Saiten seines Eierschneiders, die einen fast perfekten Mollakkord ergeben, einige Experimente mit Tabak…” [Klappentext, gekürzt]
.
ein kurzes Essay von mir – zum Buch und seinem Vorgänger „Der Anthologist“ (2009):
.
Vergiss Amerika!
Literarische Fehlschläge aus den USA – in Deutschland gefeiert und bestaunt: Nicholson Bakers „Das Regenmobil“ ist überflüssig. Und wunderbar.
.
Für je eine Stunde halten Quäker eine öffentliche, stille Andacht. Zum Ende darf dann jeder Gast, Besucher laut sprechen und persönliche Erlebnisse teilen. Keine Predigt. Sondern scheinbar nebensächliche Anekdoten und Ideen.
Paul Chowder ist der König solcher Nebensächlichkeiten: ein Phrasendrescher, Wirrkopf und Privatgelehrter über 50. In Nicholson Bakers „Das Regenmobil“ will er unter Quäkern zur Ruhe finden. Doch stattdessen kommt er immer weiter ins Quatschen, Fabulieren, Assoziieren. Der literarische Monolog eines Mannes, der Ruhe sucht – und alles niederquasselt. Als Ich-Erzähler und Podcaster stolpert Paul (Single, Lyriker, Hobbymusiker) fast 300 Seiten lang durch faszinierend flexible Gedanken- und Erinnerungspaläste. Oder verirrt sich im schlimmsten, banalsten Stuss.
„Das Regenmobil“ ist ein Zeitroman, so richtungslos verlabert, träge amorph, dass Kritiker Jörg Magenau darin gar nichts Literarisches mehr finden konnte. Noch 2010 wurde Baker in Deutschland für diesen Erzählstil fast durchgängig gelobt. Damals erschien „Der Anthologist“, Bakers erstes Paul-Chowder-Quasselbuch. Einen Sommer lang saß Paul im Vorgängerroman in der Scheune seines Elternhauses. Er hatte eine Sammlung Lieblingsgedichte kuratiert und sollte ein etwa 40 Seiten langes Vorwort nachliefern – über Sinn und Unsinn von Reimen. Weil er keinen roten Faden fand, sich drückte, zog seine Lebensgefährtin Roz aus. „Der Anthologist“ war sperrig, intelligent. Und wurde aus den falschen Gründen gelobt.
„Ich hab dich tanzen sehen / mehr soll mir nicht geschehn / ich musste gleich ’n Gummi erstehn’“, reimt Paul im neuen Roman. Die fertige Lyrik-Anthologie bringt ihm genug Tantiemen, um jahrelang zu träumen, E-Gitarre zu lernen und in Quäker-Andachten, Liedtexten, Songwriting zu dilettieren. „Eine Liebeserklärung an die Poesie“ schwärmten deutsche Kritiker und Lyrikfans bei Buch 1 – obwohl Paul erkennbar wirr, Nicholson Baker klar satirisch erzählt. Buch 2, „Das Regenmobil“, steht prima für sich allein: Es ist weniger Fortsetzung als Variation. Derselbe Schwätzer im selben irrwitzig-doof-originellen Stream-of-Halbdurchdachtem. Nur weniger Spannung, Plot, roter Faden.
Seit 25 Jahren spielt Baker in Romanen und Collagen mit Sinn und Unsinn widersprüchlicher Statements – und immer wieder nehmen ihn Kritiker in Sippenhaft für Aussagen seiner Figuren. „Menschenrauch“, das vielleicht beste Baker-Buch, ordnet Statements von Politikern und Autoren von den 20er Jahren bis 1941. In brillant montierten, widersprüchlichen Zitaten zeigte Pazifist Baker, wie es zu Holocaust, Bombenkrieg, Kampf gegen Zivilbevölkerungen kommen konnte. Quer durchs Buch mahnt Pazifist Gandhi zum Frieden, schickt selbstgerechte Briefe an Churchill und Hitler – so tragisch weltfremd, dass man heulen mag. Gandhi ist in Bakers journalistischer Textcollage, für die er kein Wort erfand oder änderte, die fadenscheinigste Stimme, mit den wackligsten Argumenten.
Weil Patrick Bateman in „American Psycho“ Frauen hasst, wurde Autor Bret Easton Ellis als Frauenhasser boykottiert. Weil der Erzähler in Christian Krachts „Imperium“ den Rassentheorien des Kaiserreichs vertraut, wollte Kritiker Georg Diez in Kracht einen Nazi erkennen. Gilt „Der Anthologist“ unter deutschen Kritikern als lesenswert, weil Baker seinen Paul Chowder dort seitenlang für Lyrik schwärmen lässt? Misslingt Teil 2, „Das Regenmobil“, weil Paul dieses Mal lieber seichte Balladen assoziiert? Verdarben, wie deutsche Kritiker schimpfen, weltfremde Gandhi-Zitate „Menschenrauch“?
Statt Ängste und Gefühle klar auszusprechen, strotzt US-Prosa seit ca. „Der Fänger im Roggen“ vor ambivalenten, vage poetischen Erinnerungsbildern und Anekdoten: Viele Szenen enden mit Figuren, die einen kurzen Natur- oder Straßenmoment aus der Erinnerung beschreiben; statt ihre Probleme anzugehen, erinnern Ich-Erzähler, was sie vor fünf, zehn Jahren träumten, aufschnappten, zufällig sahen. Irgendein Tier, das sich seltsam verhielt. Passanten, deren Geschichte sie rätseln ließ.
Solche scheinbar nebensächlichen Anekdoten brauchen keine feste Aussage, klare Bedeutung. Oft stehen sie vage suggestiv im Raum – wie nach der Quäker-Andacht. „Das Regenmobil“ fädelt fast nur solch unbestimmtes, fast beliebiges Gedankenmaterial aneinander. Ob sich das lohnt, entscheidet die persönliche Toleranz für Abschweifungen: Lieber sieben Stunden durch Wikipedia klicken?
„Man kann es nicht alles einbeziehen“, klagt Paul über seine Lust nach Abschweifung. „Man könnte meinen, ich schreibe ein Gedicht, und es wird alles Gute enthalten und auch alles Schlechte und alles dazwischen – es wird Henry Cabot Lodge, Wolken, Auberginen, Chuck Berry und die neue Geschmacksrichtung der Zahnpasta von Tom’s of Maine, Bantamhähne, Tankstellen, aquamaringrüne Vespas und die Übersalzung von Landstraßen enthalten – aber das funktioniert nicht. Ich hab’s versucht.“
Lange dachte ich, „Das Regenmobil“ sei schlampig übersetzt. Doch auch im Original sind Pauls Sätze frustrierend unsauber: Baker rührt hier absichtlich schwammiges Palaver. Zu allem Überfluss erscheinen Nicht-US- Lesern auch noch jene Bausteine poetisch aufgeladen, latent geheimnisvoll, die für US-Bürger Alltag sind: ein Bantamhahn? Quäker? Tom’s of Maine?
Das Fachwort für krankhaftes Alles-zueinander- in-Beziehung-Setzen ist Apophänie. Mit einem ähnlich übereifrigen Alles-hängt-wohl-irgendwie- zusammen-Konzept gewann Frank Witzel 2015 den deutschen Buchpreis. Figuren und vage Bedeutungskonstrukte, die ans Internet erinnern, persönliche Timelines, nicht-lineare Räume, in denen unterschiedlichste Gedanken, Splitter nebeneinander stehen und sich mit neuen Zweit- und Drittbedeutungen aufladen.
Bitte aber hört auf, Baker jedes Mal als „lesenswert!“ zu umjubeln, wenn er jemanden sagen lässt „Lyrik ist lesenswert!“, aber für einen weltfremden Trottel, wenn er ein weltfremdes oder unsympathisches Zitat zitiert. An dummen Aussagen von Bakers Figuren entlarvt sich kein schlechter Schriftsteller.
An der Kritik an „dummen“ Baker-Sätzen entlarven sich schlechte Kritiker.
Nicholson Baker: Das Regenmobil. Aus dem Amerikanischen von Eike Schönfeld. 298 Seiten, Rowohlt 2015.
.
„Menschenrauch“ las und emfahl ich 2015, zusammen mit einer anderen Textmontage über den zweiten Weltkrieg:
.
HANS MAGNUS ENZENSBERGER (Hg.), “Europa in Trümmern” (Taschenbuch-Titel: “Europa in Ruinen”), Augenzeugenberichte 1944-1948. Reportage-Reader, Deutschland 1990.
.
 Für die Andere Bibliothek sammelte Hans Magnus Enzensberger Reportagen über das Leben in den Städten Europas in der Endphase des zweiten Weltkriegs bis 1948. Literaten, Reporter, Diplomaten berichten (meist aus Ländern, in denen sie nur Besucher sind) über Zerstörung, Wiederaufbau, Unmenschlichkeit und nationale Wunden und Neurosen.
Für die Andere Bibliothek sammelte Hans Magnus Enzensberger Reportagen über das Leben in den Städten Europas in der Endphase des zweiten Weltkriegs bis 1948. Literaten, Reporter, Diplomaten berichten (meist aus Ländern, in denen sie nur Besucher sind) über Zerstörung, Wiederaufbau, Unmenschlichkeit und nationale Wunden und Neurosen.
Eine langsame, packende, abwechslungsreiche Textcollage mit Stig Dagerman, Alfred Döblin, Janet Flanner, Max Frisch, Martha Gellhorn, John Gunther, Norman Lewis, A.J. Liebling, Robert Thompson Pell und Edmund Wilson. [Gellhorn, Dagerman und Janet Flanner sind am besten/eindringlichsten.]
Ausführlicher journalistischer Reader – tolle Auswahl, viel gelernt. Aber: ein paar Beiträge sind eitel, effekthascherisch.
.
NICHOLSON BAKER, “Human Smoke. The Beginnings of World War II, the End of Civilization”, Textcollage (20er Jahre bis 1941), USA 2008.
.
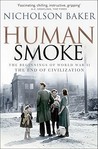 “Europa in Trümmern” ist literarischer: längere Texte, mehr Raum, um Atmosphären, Stimmung festzuhalten. Doch “Human Smoke” riss mich mit: flüssig, kühn und oft überraschend sammelt Baker Textschnipsel, diplomatische und kulturgeschichtliche Anekdoten, Zitate über die politischen, weltanschaulichen und demagogischen Weichen, die in Deutschland, England, den USA, Japan, Italien, Frankreich etc. zwischen den 20er Jahren und 1941 gestellt wurden: ein Mosaik aus Tagebuch- und Presseschnipseln über den Verfall der Zivilsation, totalen Krieg und Holocaust, Waffenhandel, Brandbomen und nationalen Hass. Ich habe unglaublich viel gelernt – und hätte das 500-Seiten-Buch noch genossen, wäre es dreimal so lang.
“Europa in Trümmern” ist literarischer: längere Texte, mehr Raum, um Atmosphären, Stimmung festzuhalten. Doch “Human Smoke” riss mich mit: flüssig, kühn und oft überraschend sammelt Baker Textschnipsel, diplomatische und kulturgeschichtliche Anekdoten, Zitate über die politischen, weltanschaulichen und demagogischen Weichen, die in Deutschland, England, den USA, Japan, Italien, Frankreich etc. zwischen den 20er Jahren und 1941 gestellt wurden: ein Mosaik aus Tagebuch- und Presseschnipseln über den Verfall der Zivilsation, totalen Krieg und Holocaust, Waffenhandel, Brandbomen und nationalen Hass. Ich habe unglaublich viel gelernt – und hätte das 500-Seiten-Buch noch genossen, wäre es dreimal so lang.
Walter Kempowskis WW2-Textcollage “Das Echolot” steht noch ungelesen im Regal: Ich glaube, mir geht es dort zu viel um hilflose kleine Leute und ihre schlichten, kaum politischen Kartoffel-, Tornister- und Bombenkeller-Sorgen. Ich liebe die postmodernen Collageromane von David Markson – doch die Schnipsel sind meist zu kurz, und man braucht zu viele Bildungsbürger-Vorkenntnisse, um Marksons schnelle, oft arrogante Pointen zu verstehen. Bakers Riesen-Textcollage ist die bisher beste Lösung, Mentalitätsgeschichte in Schnipseln zu erzählen: ein Kulturtagebuch der Entmenschlichung. Bittere, faszinierende, oft zynische Häppchen Zeitgeschichte, ideal pointiert, ideal gehaltvoll.
Viele Zusammenhänge, viele Konflikte, die ich zum ersten Mal verstehe. Großer Gewinn, großes, trauriges Lesevergnügen.