.
Wenn ich im Radio spreche, schicke ich Moderator / Moderatorin und der Redaktion meist vorbereitend einen Leitfaden:
Die wichtigsten Links, Stichpunkte, Gedanken und Fragen, die ich bei der Recherche eines Themas fand.
Manchmal sind die Leitfäden knapp. Doch meist sind sie so lang und ausführlich, dass ich sie, mit ein paar Bildern etc., als öffentlichen Blogpost teile.
.
Am Mittwoch war ich Gast beim Abendmagazin „Fazit“ (Deutschlandfunk Kultur), und sprach über Christian Kracht.
Am Freitag war ich Gast bei „Kulturzeit“ (3Sat), weil eine Redakteurin mein „Fazit“-Gespräch gehört hatte und gut fand.
- mein Gespräch bei Deutschlandfunk Kultur [Audio, Link]
- mein Gespräch bei „Kulturzeit“ [Video, Link; beides wird nach einigen Wochen/Monaten depubliziert]
- Deutschlandfunk-Text zum Thema [bleibt; wird nicht gelöscht]
In beiden Fällen gab es – anders als sonst – keine wochenlange Recherche.
…und deshalb keinen ausführlichen Leitfaden.
Trotzdem teile ich heute kurz Links und Notizen zum Thema:
.
Seit 1959 gibt es an der Goethe-Universität Frankfurt halbjährlich / einmal pro Semester Vorlesungsreihen, in denen je ein(e) Schriftsteller*in versucht, Wechselwirkungen von Gegenwart, Werk, Biografie etc. zu zeigen: die Frankfurter Poetik-Vorlesungen.
Ich selbst mag aus den letzten Jahren z.B. Terézia Mora und Andreas Maier (…Monika Maron war furchtbar banal).
Meist werden die Poetik-Vorlesungen auch als Buch veröffentlicht.
.
Gestern – am 15. Mai – hielt Christian Kracht die erste von drei Vorlesungen.
.
Er sprach davon, dass Klaus Theweleit in „Männerfantasien“ fragt, wie der Faschismus Männer in ihrem Selbstbild und Auftreten verformt hat, und zieht Parallelen zum eigenen Werk – das sich meist um sehr grausame, sehr ahnungslose, privilegierte, ästhetisierende Boys / Bubis dreht:
„Ausformungen der menschlichen Erniedrigung, und dann ein gewisser Ästhetizismus“
„Der Akt des Schreibens selbst, die Gewalt, die Erniedrigung, die Grausamkeit, der körperliche Ekel und die fetischisierte, oft verlagerte männliche Sexualität sind Topoi meiner Arbeit, deren ich mir erst jetzt bewusst werde, die aber sozusagen mit der ersten Zeile von ‚Faserland‘ alles bestimmt haben.“
Die FAZ paraphrasiert Kracht: „Auch er selbst weise Eigenschaften auf, die Klaus Theweleit am faschistischen Mann entdeckt habe: hochfunktional, gesichert durch seelische und körperliche Panzer, erworben durch Disziplin.“
.
Der Schweizer Autor, geboren 1966, debütierte 1995 mit „Faserland“ – einem satirischen Roman im Stil von Bret Easton Ellis, in dem ein verwöhnter Ex-Internatsschüler von Sylt bis Zürich reist und dabei a) seine eigenen Defizite und seine Wut darüber, dass ein Freund nichts von ihm will, kaum selbst versteht oder ausdrücken kann und b) eine Art… Schneise der Verwüstung schlägt: aus Hochmut, Langeweile, sozialer Kälte, Dekadenz, Unreife/Armseligkeit/Verdrängung etc.
Fast alle Kracht-Romane haben *irrsinnig* selbstbezogene, tragikomische Figuren, die ihre Privilegien nicht sehen. In „1979“, meinem Lieblings-Kracht-Roman, wird ein schnöseliger schwuler Kunstsammler in ein chinesisches Arbeitslager eingeliefert, ernährt sich nur noch von Maden, die er auf menschlichem Stuhlgang züchtet und sagt: „Na ja – andererseits ist das auch eine Chance, endlich seriously abzunehmen.“
Mit diesem zynischen Tonfall etc. nahm Kracht schon 2001 viel der Menschenfeindlichkeit vorweg, die Lifestyle-Welten heute… oft nah ans Totalitäre rückt: ein Gulag und Instagram, bei Kracht ist das kein sehr weiter Weg.
.
Ende 2017 sollte Prince Andrew ein Taufbecken stiften im Namen eines 2009 verstorbenen kanadischen Paters, Keith Gleed: Gleed war Kaplan an einem Internat/College in Ontario. Doch über 30 Ex-Schüler meldeten sich und gaben an, von Gleed sexuell misshandelt worden zu sein.
Erst durch diese Meldung wurde Christian Kracht, der Ende der 70er Jahre das Internat – Lakefield College – besuchte, klar, dass er sich eine Begegnung, in der Gleed ihn mit dem Gürtel schlug und hinter seinem Rücken masturbierte, nicht ausgedacht hatte.
Die halb-verschüttete Erinnerung floss in verschiedene Romane ein, z.B. in „Imperium“.
Die FAZ fragt: „Was bestimmt das Denken und Schreiben von Christian Kracht?“ Ich finde es verkürzt und boulevardesk, zu titeln, als „bestimme“ dieser Missbrauch, über den Kracht gestern erstmals sprach, „das Denken und Schreiben von Christian Kracht“.
Andererseits aber ist die Frankfurter Poetikdozentur genau DER Rahmen, in dem Autor*innen erzählen, was ihr Denken und Schreiben bestimmt.
.
Für Kracht ist diese Wortmeldung besonders ungewöhnlich, weil…
a) er, wie Christoph Schröder bei ZEIT Online schreibt „Der Mann [ist], der bei seinen raren Lesungsauftritten geradezu panisch darauf bedacht ist, dass ihm kein Zuhörer eine Frage stellen darf.““
b) seine Romane und besonders die Reportagen mit Biografismen, Autofiktion spielen.
c) ganz lange z.B. Krachs Wikipedia-Foto ein Bild war, das OFFENSICHTLICH ein Selfie war – doch als dessen Fotograf ein „Anthony Shouan-Shawn“ angegeben war, ein „bekannter Industriedesigner“, dessen [inzwischen gelöschte] Website aber ebenfalls wie eine Kracht-Inszenierung wirkt: Gibt es diesen Menschen?
Als Kracht dann d) die Regisseurin Frauke Finsterwalder heiratete, war mein erster Gedanke: „Frauke Finsterwalder? Ist das WIEDER eine Kracht-Kunstfigur?“
Die Artikel um Krachts Vorlesung sind misstrauisch und fragen sich, wie immer bei Kracht, wie wir als Leser*innen der Romane mit dieser neuen Information umgehen sollten:
_die Welt schreibt: „Geständnis“, „Kracht beginnt mit einem furchtbaren Geständnis“ #täteropferumkehr
_Spiegel Online: „Die Ruhe, mit der Kracht diese Sätze vorträgt. Ausgerechnet er. Angestarrt wird er. Wie muss das aussehen für ihn, all diese fremden Augen?“ [uff. und was heißt „ausgerechnet er“.]
_Spiegel Online: „…was bedeutet das für ihn als Autor und somit für die Interpretation seines Werkes?“
ich erinnere mich, dass wir im Studium (Kreatives Schreiben, Hildesheim, 2003 bis 2008) immer wieder über Kracht sprachen als jemand, der es geschafft hat, eine Persona zu etablieren:
Was ist seine Masche? Wie funktioniert diese Masche, was ist an ihr so faszinierend? der ironische Dandy, der von FDP-Bubis geliebt wird UND von allen, die FDP-Bubis verachten etc.
Als Mitherausgeber der Zeitschrift „Der Freund“ gab Kracht damals Katmandu als Redaktionssitz an, und mir ist bis heute nicht klar, ob Kracht damals in Katmandu lebte, ein paar Jahre. [Edit: Kracht schrieb auch einen Reiseführer zu Katmandu; er lebte länger in Südasien und aktuell in LA. Ich habe keinen Grund mehr, Katmandu anzuzweifeln.]
.
2012 fragte sich SPIEGEL-Kritiker Georg Diez, ob Krach faschistoid ist – weil der Ich-Erzähler in „Imperium“, ein (Amateur-)Kolonialherr im deutschen Kaiserreich durchgängig, ohne Brechung rassistisch und erniedrigend etc. handelt. ich fand die Gleichsetzung von Autor und Figur völlig absurd, unsachlich, ad hominem und… peinlich für Diez.
.
Ich selbst „freue“ mich sehr, wenn Christian Kracht offen oder persönlich spricht – und finde enttäuschend, wenn man bei „Ich wurde missbraucht“-Aussagen groß öffentlich fragt: „Was bezweckt er / sie damit? Warum jetzt? Ist das ein Trend, will er/sie sich interessant machen?“ etc.
Klar ist das ein… außergewöhnlicher und wichtiger Schritt:
Dass einer der verschlossensten und diskretesten Autoren der letzten 20 Jahre direkt sagt: Teile meines Schreibens lassen sich auch aus einer Missbrauchserfahrung heraus erklären, kontextualisieren.
Dahinter sofort wieder eine Masche, ein Spiel mit Erwartungen etc. zu vermuten, finde ich respektlos, boulevardesk und… auch literaturwissenschaftlich KRASS fragwürdig/arm.
Ein Mann, der mir persönlich als Autorenpersona oft viel zu weit weg, viel zu distanziert, viel zu vage blieb, macht diese Autorenpersona bewusst und absichtlich greifbarer, verletzlicher, menschlicher. Ich selbst möchte mich für diesen Schritt am liebsten bedanken.
Auch, weil ich z.B. unerträglich fand, dass Kracht DIE Galionsfigur für „anspruchsvolle schwule deutschsprachige Gegenwartsliteratur“ war seit 1995 – und ich mich immer fragte: Ein Autor, mit einer Frau verheiratet, der kaum über sich selbst spricht, lässt Ich-Erzähler, die ihr eigenes schwules Begehren meist verdrängen, ungeschickt und armselig durch die Welt holpern. DAS ist das „beste“ „schwulste“, das wir als Kultur haben?
Und: ein Autor, der nicht auf Twitter ist, keinen Blog hat, kaum sichtbar ist als öffentliche Person [Edit: Krachts Instagram-Account ist einen Blick wert!], schreibt über Pop, Gegenwart, Jetztzeitigkeit – doch nimmt eben kaum an öffentlichen Debatten teil? Bleibt so vage, dass Leute wie Diez sich ernsthaft fragen können: „Ist das ein Rechter, der den Kolonialismus liebt?“
Ich habe KEINE Ahnung, wer Christian Kracht – als Mensch – ist. Doch ich bin froh und dankbar, dass er mit diesen Vorlesungen konkreter, sichtbarer wird.
.
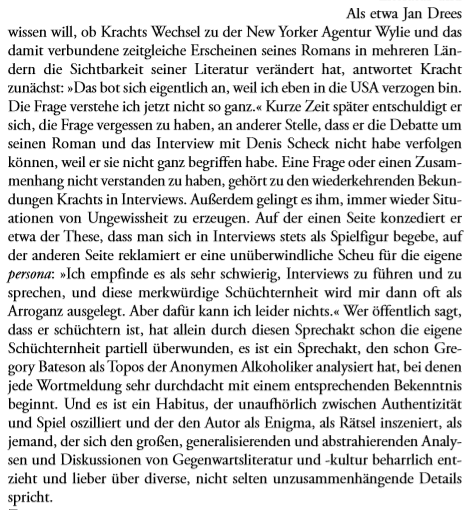
Inszeniert sich Kracht? Gutes Essay von Thomas Wegmann, in „Text & Kritik: Christian Kracht“
.
Statement von mir, transkribiert:
„Christian Kracht war bisher nie jemand, der sich eingemischt hat, oder der Position bezogen hat, und dass so jemand, nachdem wir 20 Jahre lang diese Bücher oft sehr einseitig, in Schwarz und Weiß gelesen haben, ausgerechnet bei der Poetikdozentur, also dem Ort, wo literaturkritisch noch mal alles in ein neues Licht gerückt werden kann, sagt, ‚Leute, ich möchte euch etwas sagen und ich sage das auch, damit ihr meine Romane anders lest, damit ihr die in einem anderen Licht seht‘, ich finde schon, dass das die ganze Rezeption verändert, und ich bin ein bisschen froh drum, weil wir jetzt 20 Jahre lang doch eher auf der Stelle traten.“
.
Es gibt mehrere Texte, die ich empfehle:
„Der Autor will seinen Interpreten, den Journalisten, Literaturkritikern und -wissenschaftlern seine Texte aus der Hand nehmen. Genug habe er von den ständigen Zuschreibungen, vom Popliteratur-Schmäh, den unzähligen Dandy- und Camp–Analysen. Seine Poetikvorlesung steht ganz im Zeichen der Wiederaneignung des eigenen Werkes. Nur konsequent erscheint so, dass Kracht zum Abschluss seines Vortrags die letzten Seiten aus Faserland vorlas, als wollte er dem Publikum vorführen, dass kein Text mehr derselbe sein wird nach diesem Abend. Eine werkbiographische Zäsur ist markiert. Ab sofort gibt es eine prä- und eine post-Frankfurt-Lesart Christian Krachts. Obwohl der Autor jeder offiziellen Video- und Ton-Aufzeichnung widersprochen hatte und sich zu einer Publikation der Vorlesungen bislang nicht geäußert hat, wird seine Biographie in Zukunft unzählige Kracht-Lektüren prägen. Vor biographistischen Lesarten, die Krachts Texte beflissentlich nach Traumaspuren absuchen, graust uns bereits. Wie die Literaturwissenschaft allerdings mit Krachts biographischer Entblößung umgehen wird, ist mit Spannung zu erwarten.“
…schreiben Miriam Zeh und Kevin Kempke bei „Merkur“
.
Literaturwissenschaftlerin Lena Vöcklinghaus postet einen wichtigen, öffentlichen Facebook-Kommentar über Privilegien und Sichtbarkeit:
„Vor zwei Tagen saß ich in einem Hörsaal der Goethe Universität in Frankfurt am Main und habe Christian Kracht dabei zugehört, wie er vor rund neunhundert Menschen einen erlittenen sexuellen Missbrauch und seine Folgen beschrieb. Er beschrieb, wie er in den letzten Monaten verstanden hatte, dass der Missbrauch und das ständige Anzweifeln der Erinnerungen seine Entwicklung und auch sein Schreiben in großem Maße beeinflussten. Die Finesse, die Kraft und der restliche Inhalt dieses Vortrags wurden an vielen Stellen sehr schön beschrieben. Ich weiß, das weil ich seit Dienstag die Berichterstattung gebannt verfolge. Ich hatte Angst vor den Artikeln, die entstehen würden, und ich bin dankbar, dass sie zwar den offensichtlichen Aufhänger ausschlachten, aber das auf so eine behutsame Art und Weise tun. Sie loben zu Recht, was an dem Vortrag literarisch und in Bezug auf Krachts Poetik beeindruckend und bewegend war. Aber noch fehlt mir eine Dimension in den Berichten. Sie fehlt wahrscheinlich, weil sie wenig mit Kracht selbst zu tun hat, wenig mit seinem Vortrag und überhaupt nichts mit seiner Literatur; und weil sie für eine ganz andere Zielgruppe wichtig ist als für die Leserinnen und Leser, Literaturwissenschaftlerinnen und Literaturwissenschaftler, die sich ab jetzt mit dieser Vorlesung auseinandersetzen werden.
Kracht hat ein Tabu gebrochen. Er hat eine Geschichte, die zuhauf erzählt wird, weil sie zuhauf stattfindet, an einen Ort getragen, an dem sie so noch nie erzählt wurde. Er hat die Verletzung, die bei ihm zurückblieb, als ein vertrauter Erwachsener ihn missbrauchte und niemand ihm glaubte, und das späte, viel zu späte Verstehen dieser Verletzung in die Worte des Kanons (Walter Benjamins, seine eigenen) gefasst. Er erzählte eine Geschichte, für die es Ratgeberliteratur gibt, die verschämt im Versandhandel bestellt wird, für die es therapeutische Angebote gibt, die unauffällige Namen und Türschilder tragen, und für die es einige wenige gute und viele kitschig-verklärende fiktionale Selbthilfekrücken gibt. Eine Geschichte also, die überall sonst außer in der Hochkultur zuhause ist. Er erzählte sie Professorinnen und Professoren, dem Dekan der Universität, Geldgeberinnen und Geldgebern der Poetikdozentur, Studierenden und der Presse. Er konnte sich sicher sein, dass einige die Erlebnisse, von denen er berichtet, nur allzu gut kennen. Er konnte sich aber genauso sicher sein, dass die wenigsten in diesen Räumen die Freiheit haben, über solche Erlebnisse offen, gar öffentlich zu sprechen.
Kracht konnte das tun, weil Kracht Kracht ist. Weil Kracht die Sprachmacht besitzt, die Effekte einer solchen Schilderung durch seine Wortwahl weitestgehend zu gestalten. Weil Kracht dieses Werk hat, längst fest im Kanon der Gegenwartsliteratur sitzt, weil Kracht es sich leisten kann, sich dem öffentlichen Interesse zu entziehen, und trotzdem verkauft wird, gebucht wird, geehrt wird. Aber dass Kracht seine privilegierte Stellung nutzt, um öffentlich den eigenen Missbrauch zu erzählen, ist nicht selbstverständlich. Selbst Kracht, sogar Kracht geht mit einer solchen Schilderung ein Risiko ein. Es war so still im Saal während der Vorlesung, weil der Vortrag so gut gemacht war. Aber es war auch so still, weil Kracht etwas riskiert hat. Nicht literarisch, diesmal. Aber menschlich.
Kracht hat an dem denkbar unwahrscheinlichsten Ort auf denkbar unwahrscheinlichste Art #metoo gesagt. Er hat dann noch ein bisschen aus Faserland gelesen, als sanften Ausklang der Vorlesung, sich dann bedankt und ganz kurz in den Applaus hinein verbeugt. Es gab Standig Ovations, einige sogar von Trägern wichtiger Funktionen in Frankfurt. Kracht war da längst wieder an seinem Platz und hat in seiner Tasche gekramt, ich bezweifle, dass er sie gesehen hat. Aber ich bereue trotzdem, nicht aufgestanden zu sein. Ich habe heute Morgen tatsächlich überlegt, den ersten Leserinnenbrief meines Lebens ausgerechnet an Christian Kracht zu schreiben. Jetzt habe ich stattdessen diesen Post geschrieben, weil ich nicht aufhören kann, dankbar zu sein. Ich bin diesen Menschen um ihre Standing Ovations dankbar. Ich bin den Journalistinnen und Journalisten um ihre behutsamen Berichterstattungen dankbar. Aber vor allem bin ich Christian Kracht dankbar, seine Position auf diese Weise genutzt zu haben.
Annie Ernaux schreibt: „Zu jedem Moment gibt es neben dem, was als normal gilt, all das worüber die Gesellschaft Schweigen bewahrt und so all jene, die diese Dinge empfinden, sie aber nicht benennen können, zu Einsamkeit und Unglück verdammt. Eines Tages wird das Schweigen dann gebrochen, ganz plötzlich oder allmählich, endlich bekommen die Gefühle einen Namen, endlich werden sie anerkannt, während darunter neues Schweigen entsteht.“
Dienstag war für mich einer dieser Tage. Danke, Christian Kracht.“
.
- Claudia Dürr erklärt in einem Grundsatz-Text von 2017 Tücken und Chancen des Formats „Frankfurter Poetik-Vorlesung“
- Beate Tröger fasst für den Freitag alles Wichtige in einem griffigen, klaren Text zusammen (Link)
- Philipp Teisson im SRF-Interview (Link):
.
Ist es ein Versuch, sich und sein Werk zu erklären?
Mit dieser Annahme wäre ich vorsichtig. In der Berichterstattung geht unter, dass er mit dem Bekenntnis nicht die ganze Vorlesung ausgefüllt hat. Das war nur ein Moment, aber sicherlich ein Schockmoment.
Es war der Anfang der Vorlesung. Kracht ist damit eingestiegen.
Genau. Aber er selbst hat es nicht als Skandal präsentiert. Er hat es im Grunde als einen Baustein in der Genese seiner Existenz als Schriftsteller präsentiert.
Er erzählt von einer Erinnerung, von der er lange geglaubt hat, es wäre eine falsche Erinnerung oder bloss eine Erzählung, die ihm jetzt als Wahrheit erscheint. Kracht ist jemand, der sehr gut weiss, wie man auch etwas so Furchtbares erzählt. Doch selbst da schimmert durch, dass er sich durch die Worte vor diesen Ereignissen schützt.
.
Miriam Zeh und Kevin Kempke, als Besucher*innen der Vorlesung:
„Mit der Handreichung dieser Fülle von Referenzen wird Krachts Poetikvorlesung bei allem Eingeständnis von Verletztlichkeit und Schwäche auch eine Geste der Souveränität. Der Autor will seinen Interpreten, den Journalisten, Literaturkritikern und -wissenschaftlern seine Texte aus der Hand nehmen. Genug habe er von den ständigen Zuschreibungen, vom Popliteratur-Schmäh, den unzähligen Dandy- und Camp–Analysen. Seine Poetikvorlesung steht ganz im Zeichen der Wiederaneignung des eigenen Werkes. Nur konsequent erscheint so, dass Kracht zum Abschluss seines Vortrags die letzten Seiten aus Faserlandvorlas, als wollte er dem Publikum vorführen, dass kein Text mehr derselbe sein wird nach diesem Abend. Eine werkbiographische Zäsur ist markiert. Ab sofort gibt es eine prä- und eine post-Frankfurt-Lesart Christian Krachts.“
.
ein unangenehm süffisanter Text über die zweite Vorlesung (taz, Arno Frank):
„Licht ins Dunkel sollte die zweite Vorlesung bringen. So richtig brechend voll, mit Leuten im Schneidersitz auf den Gängen und Zuspätgekommenen an den Wänden, so richtig brechend voll ist es nicht – und doch ist das auf 1.200 Plätze ausgelegte Audimax am Campus Westend beinahe voll ausgelastet. In den vorderen Reihen hat sich geschlossen das Feuilleton der Republik versammelt, dazu Prominenz aus dem Verlagswesen, man kennt sich, grüßt familiär. Ist gespannt. Wird er den Bluff auflösen? Die Erzählung weiterspinnen?“
Warum steht hier „Bluff“?
Heißt das: Frank (…und all die Leute, denen Frank unterstellt, dass sie alle wegen dieser „Bluff“-Frage gekommen sind?“), warten darauf, dass Kracht sagt, der Missbrauch sei ein Bluff?
.
Zur Vorbereitung der Gespräche….
- …sah ich „Finsterworld“ von Frauke Finsterwalder (Drehbuch: Christian Kracht) und war angetan. Ein unerwartet optimistischer, abwechslungsreicher, charmanter Episodenfilm, bei dem ich a) an die Serie „Fargo“ denken musste und b) an den tollen Comic „Ghost World“, den eine der Figuren liest. Wer Kracht nicht kennt und einen mühelosen, schwungvollen Einstieg in seine Themen sucht: Empfehlung!
[irritierend nur, dass es schon *wieder* ums Essen von Körperteilen ging.]
- …ließ ich mir die E-Book-Version des hundertseitigen „Text + Kritik“-Bandes über Christian Kracht von 2017 schicken. Der Band ist recht teuer und ein Tick zu kurz (gern noch vier, fünf weitere Beiträge; v.a. auch mehr Texte von Frauen!) Doch kein einziger Beitrag war spöttisch, eitel, verblasen, kulturpessimistisch oder schlimm-am-Thema-vorbei: zweieinhalb Stunden Lesezeit, die sehr helfen, Kracht zu kontextualisieren, zu greifen.
- ein Problem: Dass trotz 100 Seiten Platz niemand noch einmal genauer durch Krachts Briefwechsel mit David Woodard schaut, veröffentlicht als „Five Years“. Georg Diez nimmt 2012 in seiner Kracht-ist-rechts-Attacke im Spiegel „Five Years“ als Basis, stärkste Indiziensammlung für seine Thesen. Ich habe „Five Years“ nicht gelesen und wünsche mir jemanden, der dieses Buch fachkundigt vermittelt. [Aber: Dass Kracht kein Fan des Totalitären, Faschistoiden ist, „beweist“ mir z.B. das warmherzige „Finsterworld“.]
.
zum Abschluss: Passagen aus „Text + Kritik“, die ich aufbewahren und teilen will:
.
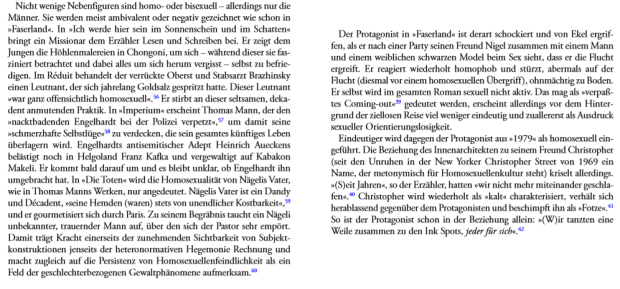
Krachts Romane als „queere Literatur“? Isabelle Stauffer & Björn Weyand
.
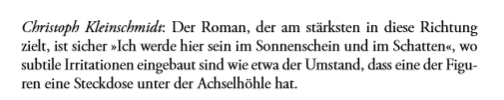
Steckdose?!
.
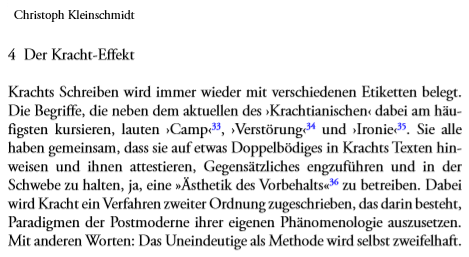
Ironie? Pop? Ein Bluff?
.
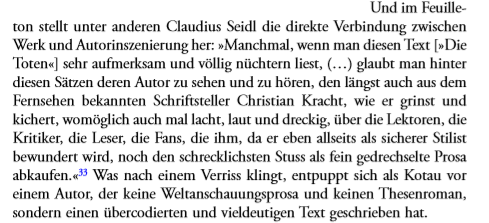
Thomas Wegmann zu Krachts „übercodierten“ Romanen
.
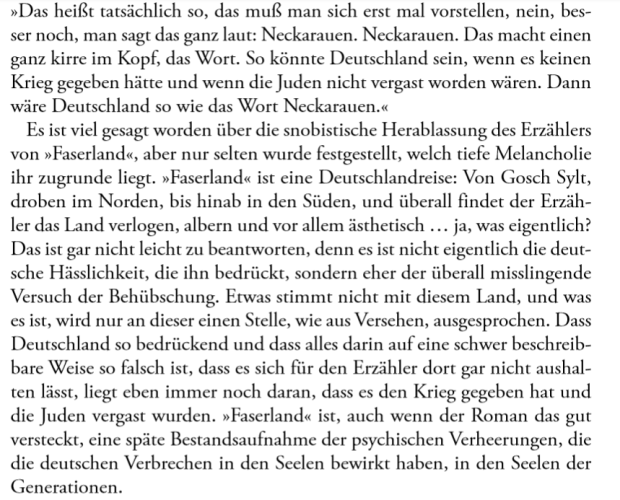
…und Daniel Kehlmann zu Krachts Debüt, „Faserland“
d

