„Es geschah, es geschah in Odessa!“, heißt es überschwänglich in Wladimir Majakowskis frühem Gedichtzyklus „Wolke in Hose“ (1915). Das ist nicht die einzige Hymne, die Künstler auf die Stadt am Schwarzen Meer gesungen haben. Geprägt vom liberalem Geist und mediterranem Klima hat die Stadt viele Autoren hervorgebracht. Und selbstverständlich viele angezogen. – Ich bin auf Autoren gestoßen, die die Umstände der Zeit gebrochen haben, aber auch auf solche, die widerstanden oder einfach Glück hatten. Auf Dissidenten, Kriegsgefallene und Opfer der stalinistischen Säuberungen.
Und mit meiner Spurensuche ist eine kleine Reihe über die Kinder und Besucher einer Stadt entstanden, die von den Einheimischen liebevoll „Mama Odessa“ genannt wird. Keine Kurz-Biographien im klassischen Sinn, die Leben und Werk würdigen. Sondern mal längere, mal kürzere Skizzen die herausstellen möchten, welchen Bezug die Porträtierten jeweils zu Odessa hatten. Eine, wie ich meine, bunte Sammlung, die manchen auch überraschen könnte.
Den Anfang haben drei in Odessa geborene Schriftsteller gemacht, die literarische Kultfiguren geschaffen haben. Isaak Babel in seinen „Geschichten aus Odessa“ den Gauner Benja Krik und das Autorenduo Ilja Ilf und Jewgeni Petrow im Kultroman „Zwölf Stühle“ den Hochstapler Ostap Bender. Dann wurden einige „Großväter“ der modernen jiddischen Literatur und Autoren skizziert, die unfreiwillig in Odessa gelandet sind. – Heute geht es um einige Schriftsteller, die politisch nicht genehm gewesen sind.
Ein Klassiker der frühen Sowjetliteratur ist Jurij Karlowitsch Olescha (1899 – 1960). Geboren in Südrussland, wuchs er ab seinem vierten Lebensjahr in Odessa auf. Er schrieb sich an der Universität für Rechtswissenschaft ein, brach das Studium wegen seiner literarischen Ambitionen ab und zog nach Kiew, wo er als Journalist gearbeitet hat.
Sein Kinderroman „Die drei Dickwänste“ (1924) brachte ihm erste Anerkennung. Über Nacht berühmt hat ihn aber der satirische Roman „Neid“ (1927) gemacht. Hierin spürt er der Frage nach, inwieweit die neue kollektive Ordnung der Individualität Raum ließ. Seine Persiflage über einen russischen Intellektuellen aus der „alten Welt“ und einen (Arbeits-) Helden der „neuen Epoche“ brachte ihm Lob und Kritik zugleich ein. Das Theaterstück „Liste der Wohltaten“, in dem eine Schauspielerin den Entschluss fasst, im Westen zu leben, wurde von Wsewolod Meyerhold (1874 – 1940) uraufgeführt und schon im Jahr darauf, 1931, von der Zensur wieder einkassiert.
Trotz zunehmender Repressionen gegen befreundete Intellektuelle und Künstler blieb Jurij Olescha sich und seinem großen Thema treu: wie man seine individuelle Freiheit und seine Würde unter den neuen gesellschaftlichen Verhältnissen wahren kann? So auch im Drehbuch für den Film „Der strenge Jüngling“, den Regisseur Abram Room (1984 – 1976) im Jahr 1938 verfilmt hat. Die Dreharbeiten waren noch nicht beendet, da war der Film schon verboten. Die Produktion, die heute als ein Meilenstein aus den 1930er Jahren gilt, wurde in der Sowjetunion erst 1974 gezeigt. In Deutschland war der Film erstmals auf der Berlinale 1990 zu sehen.
Mit dem Filmverbot kam Oleschas gesamtes Oeuvre auf den Index. Gerüchte, dass ein Schauprozess gegen ihn organisiert werden sollte, kursierten. Jurij Olescha verfiel dem Alkohol und brachte außer Tagebuchnotizen bis zu seinem Tod nichts mehr zu Papier. Obwohl er in der „Tauwetter“-Periode offiziell rehabilitiert wurde, gehört er zum Kreis der heute vergessenen Autoren.[1]
Wie Olescha ist Kornnej Iwanowitsch Tschukowskij (1882 – 1969) als Kind in die Hafenstadt am Schwarzen Meer gekommen. Ab 1901 arbeitete er als Literaturkritiker bei den „Odessaer Nachrichten“, gründete nach der Revolution von 1905 eine satirische Zeitschrift, legte sich mit dem Zarenregime an, wurde angeklagt, aber frei gesprochen. Danach begann er als Kritiker und Übersetzer (Byron, Shakespeare, Whitman) zu arbeiten und Kinderbücher und –gedichte zu verfassen. Sein erstes Märchen „Das Krokodil“ erschien 1916. Auf Vermittlung seines Freundes Maxim Gorki arbeitete er ab 1919 für einen Kinderbuchverlag.
Von sich reden machte die gereimte Kinderfabel „Tarakanischtsche“ (deutsch: „Die Riesenkakerlake“), 1922 veröffentlicht. Manche sahen darin eine Persiflage auf Stalin. Zum Inhalt: Elefanten, Bären, Löwen und allerlei andere Tiere zittern und kriechen vor einer Kakerlake, die sich großmäulig zum Tyrannen erklärt hat. Als ein zugereistes Känguru sich über die Angst der Tiere vor der mickrigen Schabe lustig macht, geraten sie erst recht in Panik und wollen das Känguru ausweisen. Dann aber kommt ein Spatz daher und macht der Kakerlake den Garaus …
Wenig verwunderlich, Tschukowskijs Bücher landeten auf dem Index. Nach Stalins Tod wurde er rehabilitiert und 1957 mit dem Lenin-Ordnen ausgezeichnet. Seine Kinderbuch-Klassiker verkaufen sich in Russland bis heute millionenfach. In Odessa erinnert regelmäßig das „Internationale Kornnej Tschukowsky Festival der Kinderliteratur“ an ihn. In Deutschland ist wohl nur das 1929 erstmals erschiene Kinderbuch „Doktor Aibolit und seine Tiere“ bekannt geworden. In der DDR in mehreren Auflagen erschienen, brachte es zuletzt der Leipziger Verlag LeiV in einer gekürzten Fassung, von Benno Lichtenberger übersetzt, heraus.[2]
Tschukowskij unterhielt enge Freundschaften zu den großen Künstlern seiner Zeit. Neben Maxim Gorki zu dem Maler Ilja Repin und zu Autoren wie Anna Achmatowa, Iwan Bunin, Wladimir Majakowskij, Boris Pasternak und dem Ehepaar Raissa Orlowa und Lew Kopelew. In ihren Erinnerungen an ihn schreiben die Beiden, dass Tschukowskij unter Stalin einer der wenigen gewesen ist, „der zwischen den Machthabern und der freidenkerischen Intelligenzija vermitteln konnte und wollte.“ Er soll vielen geholfen haben, die damals verfolgt wurden. Etwa Alexander Solschenizyn, Michail Soschtschenko, Joseph Brodskij, Andrej Sinjawskij und Daniil Charms.
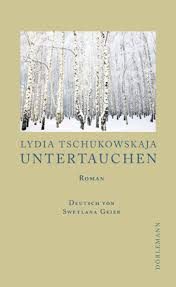 Nicht unerwähnt bleiben sollte seine Adoptivtochter Lydia Tschukowskaja (1907 – 1996). Eine unbeugsame Dissidentin, die immer lautstärker dagegen auftrat, dass die Opfer des stalinistischen Terrors totgeschwiegen wurden. In Artikeln und offenen Briefen setzte sie sich für verfolgte, eingekerkerte und verbannte Schriftsteller ein, die sie in ihrem Elternhaus teils persönlich kennengelernt hatte, wie Joseph Brodsky, Boris Pasternak, Andrej Sinjawski, Juli Daniel oder Andrej Sacharow.
Nicht unerwähnt bleiben sollte seine Adoptivtochter Lydia Tschukowskaja (1907 – 1996). Eine unbeugsame Dissidentin, die immer lautstärker dagegen auftrat, dass die Opfer des stalinistischen Terrors totgeschwiegen wurden. In Artikeln und offenen Briefen setzte sie sich für verfolgte, eingekerkerte und verbannte Schriftsteller ein, die sie in ihrem Elternhaus teils persönlich kennengelernt hatte, wie Joseph Brodsky, Boris Pasternak, Andrej Sinjawski, Juli Daniel oder Andrej Sacharow.
Nachdem sie sich öffentlich für den aus dem Land verwiesenen Alexander Solschenizyn verwendet hatte, wurde sie mit einem Publikationsverbot belegt und 1974 aus dem Schriftstellerverband ausgeschlossen. Auf diese Weise landeten die Werke ihres 1969 verstorbenen Adoptivvaters abermals auf dem Index. Kornnej Tschukowskijs Texte wurden in Schulbüchern getilgt, seine literaturkritischen Arbeiten in der „Prawda“ als schmierige Machwerke bezichtigt und der Nachdruck seiner beliebten Kinderbücher eingestellt.
Tschukowskajas Mann, der Physiker Matwei Bronstein, und viele ihrer guten Freunde waren den stalinistischen „Säuberungen“ zum Opfer gefallen. Ihre Erfahrungen hat sie in zwei Büchern verarbeitet, die trotz Verbot im Untergrund kursierten. 1939 war die Erzählung „Sofja Petrowna“ erstanden, die 1967 unter dem Titel „Ein leeres Haus“ gleichzeitig in russischer, französischer, englischer und deutscher Sprache in Paris, New York, London und Zürich herausgebracht wurde.
„Ich zweifle nicht daran“, schreibt Lydia Tschukowskaja darin, „dass die Literatur sich noch mehr als einmal der Schilderung der dreißiger Jahre zuwenden wird … Aber bei allen denkbaren Vorzügen werden spätere Erzählungen und Novellen doch schon in einer anderen Zeit geschrieben sein… Mein Bericht möge wie eine Stimme aus der Vergangenheit klingen, wie die Aussage eines Augenzeugen, der gewissenhaft versucht, trotz der ungeheuren Verstümmelung der Wahrheit klarzusehen und das aufzuzeichnen, was sich in seiner Gegenwart abgespielt hat.“
Aus den 1950er Jahren stammt ihr autobiographischer Kurzroman „Untertauchen“, 1972 in New York publiziert. In deutscher Sprache lag er in der Übersetzung von Swetlana Geier erstmals 1975 vor. 2015 hat Dörlemann eine Neuausgabe herausgebracht, die vom Feuilleton begeistert aufgenommen wurde: „Eine ganz besondere Perle vergessener russischer Literatur“, ein „Vermächtnis aus finsterer Zeit an die Nachgeborenen“.
Lydia Tschukowskaja wurde zwei Jahre vor ihrem Tod doch noch in ihrer Heimat geehrt. 1994 hat sie den Staatspreis der Russischen Föderation erhalten. Ein besonderes Zeichen der Rehabilitation erfuhr auch ihr Adoptivvater Kornnej Tschukowskij posthum. 1982 hat die Sowjetunion ihn mit einer Sonder-Briefmarke geehrt.
Anmerkungen
[1] Antiquarisch erhältlich: Jurij Olescha: Neid. Ausgewählte Erzählungen – Aufzeichnungen, aus dem Russischen übertragen von Gisela Drohla, Wiesbaden 1960
[2] Doktor Aibolit und seine Tiere oder Doktor Auwehzwick von Kornej Tschukowski, Leipzig 2010.







