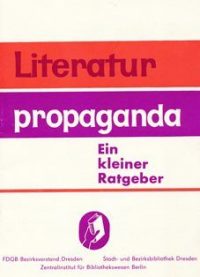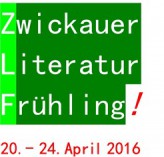Neulich im Café. Enno Arkona, Historiker und Germanist, hat 20 Jahre an seinem historischen Krimi „Die Humanistenverschwörung“ gearbeitet. Kürzlich ließ er das Buch drucken. Er meint, ein Nischenprodukt. Wir kamen ins Gespräch.
Ihnen ist ein kurzweiliger, äußerst spannender Krimi gelungen, der die Zeit kurz vor der Reformation auf 750 Seiten lebendig werden lässt. Nach Nische klingt das nicht unbedingt…
Freut mich, wenn Sie das so sehen. Mit Nischenprodukt meine ich: Es ist ein historischer Roman, der ein bisschen querliegt zu den Erwartungen ans Genre. Ken-Follett-Fans kommen eher nicht auf ihre Kosten.
Das heißt konkret?
Nehmen wir das erste Kapitel. Die halbe Stadt ist unterwegs zu einem Hinrichtungsspektakel. Ein historischer Roman, der den Erwartungen entspricht, schildert natürlich dieses Spektakel. Mein Roman schildert die Gedanken von jemandem, der sich fragt, ob es die richtige Entscheidung war, zu der Hinrichtung nicht mitzugehen.
Wie besessen muss man sein, um sich 20 Jahre lang in einen Stoff zu verbeißen?
Die Frage würde ich anders stellen. Wie groß muss ein Stoff sein, wenn man sich 20 Jahre lang damit beschäftigt? Meiner war ziemlich groß: die Renaissance. Im Übrigen sind die 20 Jahre eine Übertreibung. Ich habe ja nicht ständig dran gesessen. Einige Jahre hat der Text einfach nur in der Schublade gelegen. Und noch was. Für mein Empfinden werden viele Sachen heute zu schnell geschrieben. Das sage ich als Leser. Dass ein guter Roman Zeit braucht, um zu wachsen, versteht sich doch eigentlich von selbst. Ein Krimi ist etwas extrem Konstruiertes. Als Leser will ich davon nichts merken. Der Plot, die Figuren, die Details, das alles soll gerade nicht konstruiert wirken. Das braucht dann eben seine Zeit. Da können ein paar Jahre zusammenkommen.
Warum mussten Sie ein Buch, besser gesagt: „Die Humanistenverschwörung“ schreiben?
Das ist eine lange Geschichte. Mindestens 40 Jahre … Die Idee habe ich tatsächlich im Frühjahr 97 entwickelt. Damals war ich ein paar Monate arbeitslos. Ich wusste allerdings nicht, dass es nur ein paar Monate sein würden. Da zieht man schon mal Projekte zum Geldverdienen in Erwägung, die nicht wirklich dafür geeignet sind. Immerhin war mir klar, dass man mit einem Buch nur dann Geld verdient, wenn es auch Leute lesen wollen. Also Krimi. Krimi wird immer gelesen. Dass es ein historischer Krimi sein muss, war auch schnell klar. Ich war damals ein Fan der Falco-Romane von Lindsey Davis. Außerdem war Geschichte das Fach, das ich studiert hatte. Als arbeitsloser Mediziner hätte ich mir wahrscheinlich einen Pathologenkrimi ausgedacht.
Wie kamen Sie dann auf die Humanistenverschwörung?
Das war mehr Zufall. Eigentlich hätte mich die Zeit um 1800 mehr interessiert, schon von der Literatur her. Aber ich wollte es systematisch angehen und habe mir für meinen ersten Roman die Zeit um 1500 vorgenommen, Renaissance, Geburt der Neuzeit, Epochenwende. Das Jahr 1515 war dann reine Willkür. Ich habs einfach so entschieden, ohne Genaueres darüber zu wissen, was mich erwartet. Es hätte genauso gut 1516 sein können oder 1512. Andererseits gab es auch ein Element von Planung. Im Studium hatte ich mich ausführlich mit der Reformation beschäftigt, von Luther hatte ich genug. Was mir fehlte, war ein genaueres Bild der Zeit vor 1517. Wie hatte ich mir die Situation in den Jahren unmittelbar vor der Reformation vorzustellen? So bin ich dann mitten in der Humanistenverschwörung gelandet.
Anerkennung und Renommee als Autor – darum geht es Ihnen nicht?
Doch, doch. Aber ich dachte immer, das kommt irgendwann von selbst … Inzwischen habe ich eingesehen, von selbst kommt gar nichts. Schon gar nicht beim Selfpublishing. Um die Frage zu beantworten: Ich weiß nicht, wie wichtig mir das ist, Renommee als Autor. Ich bin immer noch dabei, es herauszufinden.
Lieber Buchhändler als Tuchhändler, denkt sich der Nürnberger Patrizier Jacob Teufel im Jahr 1515 – und bezahlt sein Vorhaben mit dem Leben. Der Mord und dessen Aufklärung sind frei erfunden, alles andere haben Sie akribisch recherchiert. Was reizt Sie an der wahren Geschichte so?
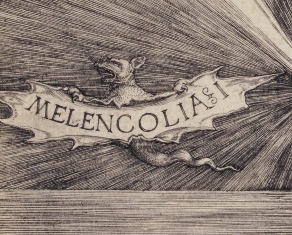
Albrecht Dürer, Melencolia I, 1514 (Detail). Quelle: Wikimedia Commons
Historische Romane leben von Details. Die hätte ich mir niemals alle so schön ausdenken können. Die wahren Geschichten sind einfach unschlagbar. Abgesehen davon habe ich selber am meisten davon gehabt, so viel zu recherchieren, mich in die Dürerforschung einzuarbeiten, in die Nürnberger Stadtgeschichte, in den Reuchlinstreit usw. Das war schon was anderes als im Studium. Eine Art Tiefenbohrung. Irgendwo muss man mal ins Detail gehen.
Sie haben Geschichte und Germanistik studiert. Beste Voraussetzungen, um einen historischen Stoff literarisch zu verarbeiten?
Nicht wirklich. Einen Stoff literarisch verarbeiten, kann sein, dass ein Germanistikstudium da nicht schadet. Aber eine gute Geschichte schreiben, das ist was anderes. Da ist die Germanistik eher hinderlich. Und vom Geschichtsstudium führt auch keine gerade Linie zum historischen Roman. Die Herangehensweise, die man da lernt, Quellenkritik, Hilfswissenschaften, das ist alles nützlich beim Recherchieren. Für das Schreiben eines Romans muss man das hinter sich lassen. Da braucht man anderes Handwerkszeug.
Was machte mehr Arbeit: Figuren zu erfinden, die erfundene Geschichten erleben? Oder die Lebenswelt dieser Figuren möglichst faktentreu zu rekonstruieren?
Beides ähnlich viel, sagen wir: 25 Prozent. Die restlichen 50 Prozent, ich fürchte, die werden gern unterschätzt. Die Arbeit am Text, an der einzelnen Seite, am einzelnen Satz. Das ist die Hauptarbeit.
„Der historische Roman ist erstens ein Roman und zweitens keine Historie“, so Alfred Döblin. Würden Sie dieser Aussage zustimmen?
Ja. Ein historischer Roman ist keine Geschichtsschreibung, er ist ein Roman. Ich würde noch ein bisschen weiter gehen. Ein historischer Roman hat den Vorzug, dass jeder weiß: Dies ist Fiktion. An Geschichtsschreibung geht man anders heran. Das Vertrauen in das, was da vermittelt wird, ist viel zu groß. Einem Sachbuch wird zu schnell geglaubt. Am schlimmsten sind in dieser Hinsicht Biografien. Letztens ist eine über Dürer erschienen, die war mehr Fiktion als mein Roman.
_________________
Im zweiten Teil unseres Gespräches haben wir unter anderem Enno Arkonas bisherigen Erfahrungen als Selfpublisher behandelt und natürlich auch darüber sprechen, was ihn bislang davon abgehalten hat, seinen Krimi aktiv zu bewerben. – Wer mehr über den historischen Hintergrund der „Humanistenverschwörung“ wissen möchte, wird auf der Webseite zum Buch fündig.