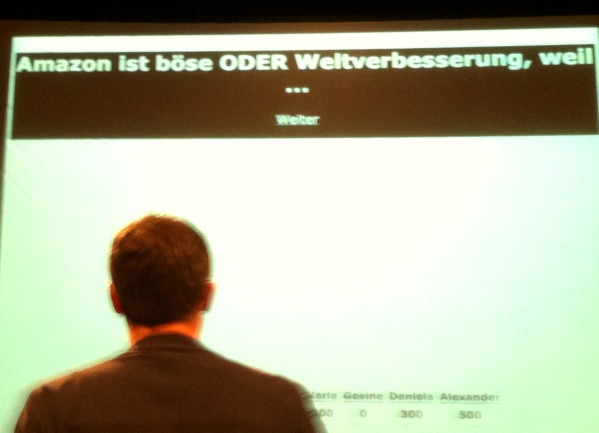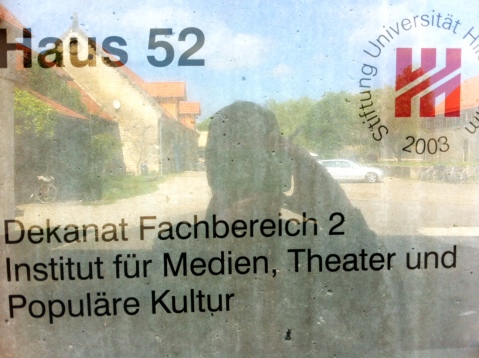Den Namen Swetlana Alexijewitsch kennt man vermutlich. Schließlich wurde ihr 2015 der Nobelpreis für Literatur verliehen. Aber: weiß wer schon, dass sie 1948 in der Westukraine geboren wurde?
Abgesehen von einigen Ausreißern wie etwa Oksana Sabuschko, die 2006 mit ihrem Roman „Feldforschungen auf dem Gebiet des ukrainischen Sex“ für Wirbel sorgte, dem intellektuellen Wortführer der „Orangenen Revolution“ Jurij Andruchowytsch, mittlerweile in Westeuropa der wohl bekannteste ukrainische Autor, oder Natascha Wodin, die das Leben ihrer Mutter – einer ukrainischen Zwangsarbeiterin, die die Nationalsozialisten nach Deutschland verschleppt hatten – literarisch verarbeitete und für ihren Roman „Sie kam aus Maruipol“ 2017 mit dem Literaturpreis der Leipziger Buchmesse ausgezeichnet wurde, tut man sich mit Land, Leuten, Literatur, Geschichte und den aktuellen Entwicklungen in der Ukraine hierzulande schwer. Ganz so, als würde der Eiserne Vorhang noch existieren.

free Julija Tymoschenko © Sabine Münch
Und dies obwohl es seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion und verstärkt nach der „Orangenen Revolution“ immer wieder Bemühungen gab und gibt, ukrainischen Büchern im deutschsprachigen Raum Wege zu ebenen. Darum früh verdient gemacht hat sich die 2011 verstorbene Anna-Halja Horbatsch, die nach dem Einzug der Roten Armee mit ihren Eltern 1940 aus der Ukraine nach Deutschland gekommen war.
Nach langjähriger Übersetzer- und Herausgebertätigkeit gründete sie 1995 noch im hohen Alter von 70 Jahren ihren Brodina Verlag, den sie nach ihrem Geburtsort in der ukrainischen Nordbukowina benannt hat. Bis zu ihrem Tod sind hier 15 Titel erschienen, vornehmlich zeitgenössischer Autoren. Aber auch das deutsch-ukrainische Lesebuch „Die ukrainische Literatur entdecken“ (2001), das die wichtigsten Werke der ukrainischen Literatur präsentiert, und die literaturwissenschaftliche Abhandlung „Die Ukraine im Spiegel ihrer Literatur: Dichtung als Überlebensweg eines Volkes“ (1997). Für ihre Bemühungen um eine weithin unbekannte Literaturszene hat Anna-Halja Horbatsch 2006 das Bundesverdienstkreuz erhalten.
Ebenfalls mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet wurde Katharina Raabe, die sich seit der Jahrtausendwende beim Suhrkamp Verlag engagiert um den Ausbau des osteuropäischen Programms bemüht. Auch andere Verlage wie Luchterhand, Rowohlt Berlin, S. Fischer, Zsolnay in Österreich oder Diogenes und Dörlemann in der Schweiz führen ukrainische Autoren im Programm. Der 2010 gegründete Verein Translit, ein Zusammenschluss von Übersetzern und Kulturmittlern, bemüht sich um den Austausch zwischen der Ukraine und Deutschland. Und die Buchmessen in Leipzig und Frankfurt? Die organisieren inzwischen ebenfalls verschiedentlich Schwerpunkte speziell zu Autoren aus Osteuropa.
Ukrainische Literatur – eine Terra Incognita
Dass wir kaum etwas über die literarische Szene wissen, liegt zweifellos mit daran, dass das Gebiet der heutigen Ukraine – abgesehen von einer kurzen Episode zwischen 1918 und 1920, zu der sich ein unabhängiger Nationalstaat konstituiert hatte – im Zeitenlauf zu vielen unterschiedlichen Staaten gehört hat. Zum zaristischen Russland, Lemberg, Galizien, den Karparten, zum Habsburgerreich, zu Polen, Rumänien und der Tschechoslowakei. Die Sowjetunion verleibte sich nach dem Krieg mit Polen 1920 den größten Teil des Landes ein. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden ihr auch die polnischen, rumänischen und tschechischen Territorien zugeschlagen.
Die jahrhundertelange Fremdherrschaft hatte zur Folge, dass sich die ukrainische Sprache und Kultur nur unter extrem schwierigen Bedingungen entwickeln konnten. Autoren, die ihre Schriften in ihrer Heimatsprache abfassten, wurden drangsaliert und verfolgt. Allein in der Stalin-Ära sollen mehr als 300 Autoren ukrainischer Herkunft ihr Leben durch Terror, Folter oder im Gulag gelassen haben.
Nicht besser war die Situation im Zarenreich gewesen, wo ukrainisch-sprachige Publikationen einem Druckverbot unterlagen. Dies sogar Wiederholt: 1863, 1876 – 1906, 1914 – 1917. Autoren, die sich des Ukrainischen bedienten, wurden verspottet, sich einer schlechten Sprache zu bedienen, schikaniert, eingesperrt und verbannt. So etwa der ukrainische Nationaldichter Taras Schewtschenko (1814 – 1861), der als einer der ersten gilt, der seine Gedichte und Lieder in seiner Heimatsprache verfasst hat. „Bäuerlich“ sei seine Sprache, ein primitiver Dialekt des Russischen. Nachdem er sich einem Geheimbund angeschlossen hatte, der für die Abschaffung der Leibeigenschaft und die Gleichberechtigung der slawischen Völker im Zarenreich eintrat, wurde Schewtschenko verbannt und nach seiner Entlassung mit der Auflage belegt, kein ukrainisches Gebiet mehr zu betreten. Bis zu seinem Tod lebte er in St. Petersburg unter strenger Aufsicht.
Es liegt auf der Hand, dass die Autoren ständig mit sich rangen: Schreibe ich auf Ukrainisch oder auf Russisch? Nikolai Wassiljewitsch Gogol (1809 – 1852), ein gebürtiger Ukrainer, soll in einem Brief an eine Freundin geschrieben haben, dass er nicht wisse, ob er Russe oder Ukrainer sei. Wie ihm erging es vielen. Wer unter imperialer Kontrolle ungeschoren publizieren und zudem eine breitere Leserschaft erreichen wollte, musste sich der Sprache der Herrschenden bedienen.
Kein Staat, keine Nation, keine Nationalliteratur?
Mit Michail Gorbatschows Reformpolitik wendete sich in den späten 1980er Jahren das Blatt. Erst- und Neuveröffentlichungen bisher verbotener und vergessener Werke und Bücher, die nur im Ausland hatten erscheinen können, wurden zugänglich. Autoren brachen mit der sozialistisch-realistischen Tradition der Sowjetära und sagten sich vom ukrainischen Schriftstellerverband los, der 1934 als Verband der Sowjetischen Schriftsteller der Ukraine gegründet und 1959 in Schriftstellerverband der Ukraine (SVdU) umbenannt worden war.
Eine neue Autorengeneration trat auf, die sich am Westen orientierte, Liberalisierungen forderte und eine genuin ukrainische Identität einklagte. Motor dieser Bewegung war die 1985 in Lviv (Lemberg) gegründete Gruppe BU-BA-BU (Burlesk-Balahan-Buffonada, deutsch: Burleske-Farce-Posse), die anfangs im Untergrund agierte, später gingen aus Lemberg zahlreiche literarische Initiativen hervor. Ziel von BU-BA-BU war es, das Land gesellschaftlich, kulturell und sprachlich zu erneuern.
Traditionell wird im Westen Ukrainisch, im Osten hingegen Russisch gesprochen. Daneben existiert eine Mischform aus dem Russischen und dem Ukrainischen, das sogenannte Surzhyk, das vor und nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden ist.[1] Die Frage, welche Sprache man benutzt, wird in der ukrainischen Politik schärfer diskutiert und problematischer bewertet, als dies in der ukrainischen Lebensrealität der Fall ist. Die Sprachen koexistieren, die meisten Ukrainer sprechen Russisch und Ukrainisch. Was auch für Autoren gilt, die in beiden Sprachen veröffentlichen.
Nach dem Zerfall der Sowjetunion wurde 1989 das Russische durch das Ukrainische als einzige Amtssprache ersetzt und Maßnahmen zur Ukrainisierung des Bildungswesen und der Medien beschlossen. Das bis dahin sozial, kulturell und politisch dominante Russisch erhielt den niedrigeren Status einer geduldeten Verkehrssprache.

Nationalfarben © Sabine Münch
2012 ließ der damalige pro-russische Präsident Viktor Janukowitsch mit dem Gesetz „Über die Grundlagen der staatlichen Sprachpolitik“ Russisch wieder als Regionalsprache zu. Manchem mögen die tumultartigen Szenen und handgreiflichen Auseinandersetzungen noch in Erinnerungen sein, die anlässlich des Sprachengesetzes im ukrainischen Parlament losgebrochen waren. Einige Bezirke sowie Städte im Osten und Süden, darunter auch die Hafenstadt Odessa, ließen das Russische wieder als nahezu gleichberechtigte Sprache zu. Unmittelbar nach der Maidan-Revolution wurde das Gesetz in einer außerordentlichen Sitzung des Parlaments im Februar 2014 wieder gekippt.
Nachdem sich im Dezember 1991 in einem Referendum 90 Prozent der Bevölkerung für die Unabhängigkeit ausgesprochen hatten – übrigens mit klarer Mehrheit auch in den heutigen Separatistenhochburgen Donezk und Lugansk – stand nicht nur die Sprachenfrage, sondern auch die Frage nach dem Nationalbewusstsein und einer genuinen ukrainischen Identität an. Hier war ukrainisch-sprachige Literatur gefragt. In Vergessenheit geratene Klassiker wurden wieder oder neu entdeckt. Autoren wie Ljubko Deresch (geb. 1984), Oksana Sabuschko (geb. 1960), Jurij Andruchowytsch (geb. 1960), Jurko Prochasko (geb. 1970) oder Serhij Zhadan (geb. 1974) wurden auf Festivals und Lesungen gefeiert.[2]
Die literarische Szene entwickelte sich dynamisch, wenn auch unter schwierigen Bedingungen. Unabhängige Verlage und Buchhandlungen, die sich ukrainischer Literatur verschrieben haben, kämpfen mit immensen Schwierigkeiten.[3] Professionelle literaturvertreibende, -herstellende und -propagierende Strukturen fehlen weitestgehend und den Kulturkommissionen im Parlament mangelt es vielfach an Weitblick und Kompetenz. Zwar florierte eine junge ukrainische Szene, der Literaturbetrieb aber blieb russisch dominiert; der Markt wurde von niedrig-preisigen russischen Büchern überschwemmt, die in der Regel drei- bis viermal billiger sind als Titel aus ukrainischen Verlagen.
Mit Annexion der Krim und dem Bürgerkrieg im Osten wendete sich das Blatt. Die riesigen Verlagshäuser aus der Sowjetzeit, die in Kiew und anderen Großstädten ansässig gewesen waren, machten dicht. Auch viele der großen sowjetischen Buchhandlungsketten, die das Land einst mit einem mustergültigen Vertriebsnetz überzogen haben, wurden aufgelöst. An ihrer Stelle entstanden kleinere Sortimente und Buchkioske, die aber vornehmlich preisgünstige russische Importe anbieten. Trotz immer rigideren Versuchen seitens der Regierung, russische Literatur einzudämmen, heimsen russische Produktionen weiterhin einen Großteil des Umsatzes auf dem ukrainischen Markt ein.
Spätestens seit dem Bürgerkrieg im Osten steht die Frage, die sich Autoren seit dem 19. Jahrhundert schmerzhaft gestellt haben, wieder im Raum. Für die einen ist sie eine Frage der politischen Haltung, für andere (noch) eine Frage der Fertigkeit. „In der Regel beherrscht ein Schriftsteller eine der beiden Sprachen besser. Auch ich selbst habe einige meiner Essays ins Russische übersetzt und dabei festgestellt, dass mir im Russischen einige Nuancen und Ausdrucksmöglichkeiten fehlen. Mein Russisch ist viel ärmer als mein Ukrainisch.“ So Jurij Andruchowytsch in einem Interview mit der „Neuen Züricher Zeitung“ im März 2007.
Alter Wein in neuen Schläuchen
Eine erste Debatte über den Status der in der Ukraine auf Russisch erschienenen Bücher war bereits mit der Krimkrise entbrannt. Eine Quote sollte her, um den überbordenden Buch- und Filmimport aus Russland einzudämmen. Im August 2015 wurden Werke von 38 russischen Autoren aus dem Verkauf gezogen, die die Eingliederung der Krim in die Russische Föderation befürwortet hatten. Im Dezember 2016 erließ Präsident Petro Poroschenko ein Gesetz, dass Bücher mit pro-russischer Tendenz in der Ukraine verbietet. Begründet wurde die Maßnahme mit dem Kampf gegen russische Propaganda.
Seither stehen Werke auf dem Index, die Russland und seine Führung verherrlichen, anti-ukrainisch sind oder totalitäre Ansichten vertreten, und Bücher, in denen zum Staatsstreich in der Ukraine, zum Krieg oder zum Rassenhass aufgerufen wird. Für das Fernsehen gilt, dass 75 Prozent der Nachrichten und Filme auf Ukrainisch sein müssen. Russische Produktionen werden ukrainisch untertitelt. Russische Fernseh- und Radiosender wurden eingestellt, im Mai 2017 der Zugang zu mehreren russischen Internetdiensten gesperrt, darunter das russische Facebook-Pendant VKontakte (VK).
Und Russland? Macht es nicht anders. Auf der Krim existieren keine ukrainischen Radio- und Fernsehsender mehr, Internetdienste wurden vom Netz genommen, ukrainische Zeitungen dürfen auf die Halbinsel nicht geliefert werden. Im Oktober wurde in Moskau – nicht zum ersten Mal – die „Bibliothek für Ukrainische Literatur“ von bewaffneten Polizeimannschaften durchsucht. Beschlagnahmt wurden Bücher, elektronische Datenträger, Dokumente und Zeitungen. Die Direktorin wurde verhaftet und im Juni 2017 zu vier Jahren Haft auf Bewährung verurteilt.
Als „Missverständnis“ sollte sich die Festnahme des ukrainisch-sprechenden Serhij Zhadan herausstellen – so jedenfalls berichteten die „Ukrainer-Nachrichten“ im März 2017 über den Fall. Den Autoren, der in der Ostukraine zur Welt gekommen ist und 2014/15 verschiedentlich in die Kriegsgebiete im Donbass gereist war,[5] hatten weißrussische Polizisten in Minsk im Februar 2017 unter dem Vorwand festgenommen, ihm sei wegen einer „Teilnahme an terroristischen Aktionen“ eine Einreise in die Russische Föderation untersagt.

Odessa 2014 © Sabine Münch
In der heftigen Propagandaschlacht, die sich beiden Seiten liefern, scheinen nicht nur Bücher, auch das kulturelle Erbe zum Spielball geworden zu sein. Gestritten wird um große Namen; etwa um Anton Tschechow und Michail Bulgakow, um den großen Komponisten Sergei Prokofjew oder Maler wie Kasimir Malewitsch und Ilja Kabakow.[6] Besonders ins Auge gefallen ist mir in diesem Zusammenhang der „Kampf um Gogol“, eine Kontroverse, die anlässlich des 200. Geburtstages des bedeutenden Klassikers 2009 offen aufgebrochen war.
Richtig ist, dass Nikolai Gogol seine Werke auf Russisch verfasst hat, als junger Mann nach St. Petersburg gezogen war, später nach Moskau. Im Herzen aber blieb er Ukrainer, wo er aufgewachsen und zweisprachig erzogen worden war. Seine ersten literarischen Erfolge hat er mit folkloristischen Erzählungen über die ukrainische Heimat gefeiert. Im Alter litt Gogol an Schizophrenie. Er verbrannte Teile seines Oeuvres, darunter auch die Fortsetzung seines 1841 erschienenen Opus Magnum „Die toten Seelen“, an der er 1850/51 in Odessa gearbeitet hat, und hungerte sich zu Tode.
Beide Seiten reklamieren den Klassiker für sich. Ukrainische Neuübersetzungen merzen alles aus, was russisch anmutet. Die Russen wollen seine Herkunft vergessen machen lassen. Dabei wäre Gogol prädestiniert, Brücken zu schlagen. In der bereits zitieren Passage aus dem Brief an eine Freundin heißt es ausführlich: „… und weiß auch selber nicht, welche Seele ich habe, eine ukrainische oder eine russische. Ich weiß nur, dass ich weder dem Kleinrussen den Vorzug geben würde vor dem Russen noch dem Russen vor dem Kleinrussen. [Den Norden der Ukraine nannte man damals Kleinrussland.] Beide Naturen sind von Gott überreich beschenkt, und jede davon schließt das ein, was die andere nicht hat – ein deutliches Zeichen dafür, dass sie sich gegenseitig ergänzen müssen.“
Allein: in der zugespitzten politischen Lage tobt ein Kulturkampf; ein altbekannter. Wenn auch – zumindest aus ukrainischer Perspektive – unter umgekehrten Vorzeichen.
Eine kleine Reihe über die schreibenden Kinder und Besucher der Stadt kann man hier lesen.
Anmerkungen
Bis zu meinem Besuch in Odessa im Juli 2017 (dazu hier mehr) war auch mir die ukrainische Literatur ein unbeschriebenes Blatt. Umso erstaunter bin ich gewesen, wie reich die Hafenstadt am Schwarzen Meer auch in dieser Hinsicht ist. Zurückgekehrt nach Steglitz machte ich mich auf eine Spurensuche, die ich in loser Folge dokumentiere.
Empfehlenswert: Andreas Kappeler: Ungleiche Brüder. Russen und Ukrainer. Vom Mittelalter bis zur Gegenwart. München 2017.
[1] Siehe dazu das Gespräch „Der Versuch, das Russische abzuschaffen, war eine Dummheit“ mit Gerd Hentschel, Professor für Slavistische Sprachwissenschaft an der Universität Oldenburg, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 14. Juli 2014.
[2] Von allen Genannten liegen Übersetzungen ins Deutsche vor.
[3] Einen lesenswerten Bericht über die Situation des unabhängigen Buchhandels in Odessa in Zeiten des Bürgerkriegs kann man bei Deutschlandfunk Kultur nachlesen
[5] Seine Eindrücke im Donbass hat Serhij Zhadan in Prosaarbeiten und in Gedichten verarbeitet: „Warum ich nicht im Netz bin“ und „Mesopotamien“. Beide Titel sind 2015 bei Suhrkamp erschienen.
[6] Siehe hierzu etwa: Gogol – großer Russe oder großer Ukrainer?, in: Die Presse vom 23. August 2015.
 Vater und Tochter in jungen Jahren © GvP
Vater und Tochter in jungen Jahren © GvP mein Großvater Bernhard (links) mit seinem Vater Wilhelm © Familie vP
mein Großvater Bernhard (links) mit seinem Vater Wilhelm © Familie vP