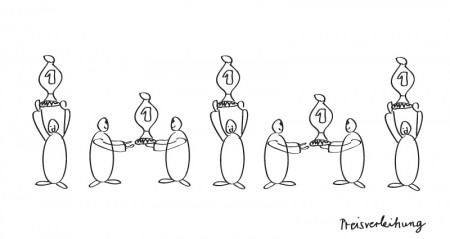23. Mai 2011 - 21:51 Uhr
Theaterkritik, wohin gehst du? Ein Gespräch mit Sigrid Löffler und Christine Dössel über den Spaß an Verrissen, Dinosaurier des 20. Jahrhunderts und Klagen gegen den eigenen Arbeitgeber.

Sigrid Löffler und Christine Dössel. Verschwommenes Foto: Grete Götze oder Nikola Richter, fotografisches Talent ausbaufähig
Nikola Richter: Sigrid Löffler, Sie haben lange das Feuilleton geprägt, beim österreichischen Magazin „profil“, bei der Wochenzeitung „Die Zeit“ etwa. Wir möchten mit Ihnen über Ihre Berufserfahrungen sprechen, um etwas für unseren Berufsweg mitzunehmen. Wie sind Sie Kritikerin geworden?
Sigrid Löffler: Kritiker kann man nicht werden, nur sein. Ich habe mich vom politischen Journalisten zum Kulturjournalisten entwickelt. In Österreich war es relativ leicht, als Kritiker einen neuen Ton und einen neuen Stil zu etablieren, denn die Kritik war verkommen: ein kriterienloses selbstzufriedenes Geschmacksgerede, Daumen rauf, Daumen runter, ohne Kenntnis der und ohne Interesse für die neuen Entwicklungen der Kunstwelt im Ausland, namentlich in Deutschland.
NR: Wie sah Ihre Form der Kritik aus?
SL: Ich habe adornitisch argumentiert, analysiert und Vergleiche angestellt, und mein Geschmacksurteil war sekundär.
Grete Götze: In einer Kritik muss also nicht stehen: „Diese Inszenierung ist gelungen“?
SL: Es muss vor allem nicht drinstehen: „Das ist die gelungenste Inszenierung des vergangenen Jahrzehnts.“ Solchen Blödsinn habe ich nie geschrieben. Aus der Rezension sollte das kritische Urteil implizit hervorgehen. Als ich jünger war, hat es mir Spaß gemacht, scharfe und witzige Verrisse zu schreiben. Heute nicht mehr.
GG: Warum?
SL: Mit guten Verrissen kann man sich als junger Kritiker leicht und rasch einen Namen machen. Es gibt aber wenige Dinge, die zu verreißen sich wirklich lohnt. Zeug, das nichts taugt, taugt auch nicht dazu, sich damit auseinanderzusetzen. Außer, es ist wirklich auf eine so ärgerliche Weise misslungen, dass es schon wieder exemplarisch ist.
GG: Wie kam es dazu, dass Sie von der politischen Journalistin zur Kulturjournalistin wurden?
SL: Man müsste eher fragen: Wie kam es dazu, dass ich in der Politik angefangen habe? Ich war durch mein Studium gepolt auf die Künste, aber mein erster Chefredakteur wollte mich in der Politik sehen. Ich bereue diesen Seitensprung nicht, bin froh, auch als Kulturjournalist politisch zu denken. Es ist ein nicht ganz unschlauer Weg für einen Journalisten, als Allrounder anzufangen und sich dann zu spezialisieren.
NR: Haben Sie sofort als Redakteurin angefangen?
SL: Ja, das waren die märchenhaften Zeiten des 20. Jahrhunderts: Man wurde sofort angestellt. Ich habe gleichzeitig immer schon versucht, mir in Deutschland einen Namen zu machen. Irgendwann bemerkt man die Disproportion zwischen dem eigenen Ehrgeiz und dem kleinen Land Österreich. Dann muss man aus Wien weggehen.
GG: Kritisieren Männer und Frauen auf unterschiedliche Art und Weise?
SL: Es gibt sachorientierte Kritiker, und es gibt eitle, narzisstische Kritiker, die in erster Linie darüber schreiben, ob sie heute Kopf- oder Bauchweh haben und dann in der dritten Spalte darauf kommen, dass sie auch ein Theaterstück gesehen haben. Das ist aber nicht nach Geschlechterrollen aufzuteilen.
NR: Aber man redet öfter von Kritikerpäpsten als von Kritikerpäpstinnen, warum? Weiterlesen »