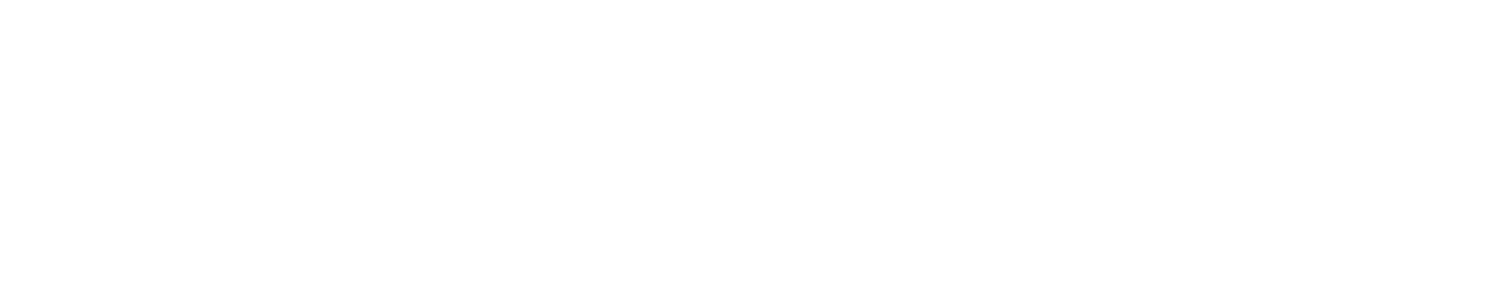Allen digitalen Unkenrufen zum Trotz: Es gibt sie noch, die dicken Romane (früher sagte man auch Schinken dazu), so auf richtigem Papier, mit Buchdeckeln und allem Drum und Dran. Als müsste das analoge Medium gleichsam in einem letzten Aufbäumen zeigen, was es wirklich kann, machen sich dieses Jahr besonders viele Exemplare dieser Gattung bemerkbar.
Eines davon ist „Dein Name“, ein Roman des iranischstämmigen Orientalisten Navid Kermani. Der hat neben dem Gebiet, in dem er ausgewiesener Fachmann ist, auch eine Schwäche für Rockmusik. Und so geht es in „ein[em] der ungewöhnlichsten Romane unserer Zeit, der das Privateste ebenso in den Blick nimmt wie die Geschichte, in der wir leben, ein[em] Buch, das unser Bild der Gegenwart nachhaltig verändern wird“ (Verlag) eben auch um – Neil Young.
Wer Navid Kermanis „Buch der von Neil Young Getöteten“, eine mit viel Herzblut geschriebene Ehrerbietung an den Godfather of Grunge, kennt, den wird es nicht wunder nehmen, dass Kermani auch in „Dein Name“ immer wieder seinem Idol huldigt. Das freut den Young-Exegeten und nimmt vielleicht auch manchem die Scheu vor dem mit seinen immerhin 1232 Seiten allzu intellektuell gigantomanisch erscheinendem Riesenroman:
It’s all one song, rief Neil Young, als sich bei einem Konzert jemand lauthals beschwerte, daß alles gleich klinge. Den Unterschied macht nicht die Geschichte, die beliebig, ja austauschbar anmutet, sondern der Mut, sich in eine einzelne Situation, eine abseitige Episode von vielleicht zehn, vielleicht fünf, vielleicht zwei Minuten Realzeit hineinzustürzen wie in einen reißenden Fluß, sich darin zehn, fünfzehn, dreißig Seiten treiben zu lassen, ohne einen Gedanken zu verschwenden ans Ufer, an das, was draußen in der Handlung passiert.
Navid Kermani: Dein Name. Carl Hanser Verlag, 1232 Seiten, 20 Abbildungen, 34,90 €.