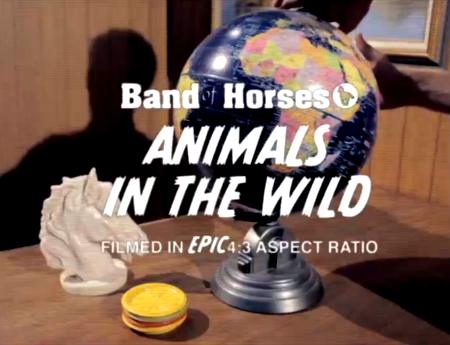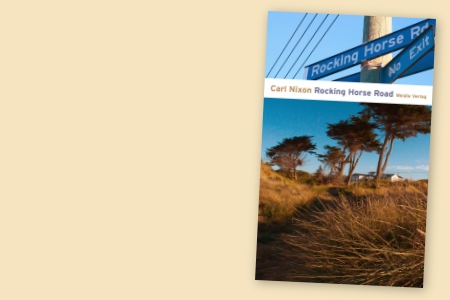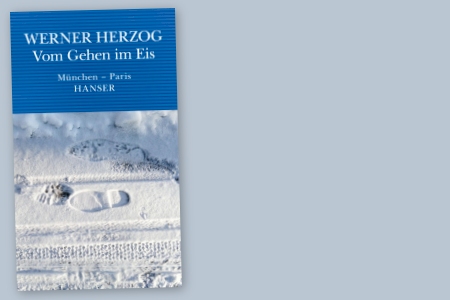
An Werner Herzog scheiden sich die Geister, man ist entweder entrückt oder befremdet von dieser Art des Filmemachens, die sich noch den entlegensten Alltagsbeobachtungen mit kindlichem Staunen annähert.
Gut beobachten konnte man das am Ende des letzten Dokumentarfilms „Die Höhle der vergessenen Träume“, wenn Herzogs sanfte Erzählerstimme plötzlich über die Albino-Alligatoren zu meditieren beginnt, die unweit der Chauvet-Höhlen im Kühlwasser eines Atomreaktors leben.
Dass Werner Herzog auch auf dem Papier fesselnd erzählen kann, zeigt sich in seinem neuen Buch „Vom Gehen im Eis“, das eine Wanderung von München nach Paris im November 1974 dokumentiert, entstanden aus der wahnwitzigen Idee, dadurch der Filmhistorikerin Lotte Eisner das Leben zu retten. Wahrscheinlich auch ein Buch, an dem sich die Geister scheiden – aber das kann ja zum Glück jeder für sich selbst entscheiden.
Sonne, wie ein Frühlingstag, das ist die Überraschung. Wie aus München herauskommen? Was beschäftigt die Menschen? Caravans, die Unfallautos, die aufgekauft werden, Autowaschstraße? Das Nachdenken über mich fördert eines zutage: der Rest der Welt reimt sich.
Ein einziger, alles beherrschender Gedanke: weg von hier. Die Menschen machen mir Angst. Die Eisnerin darf nicht sterben, sie wird nicht sterben, ich erlaube das nicht. Sie wird nicht sterben, sie wird nicht. Nicht jetzt, das darf sie nicht. Nein, jetzt stirbt sie nicht, weil sie nicht stirbt. Meine Schritte gehen fest. Und jetzt zittert die Erde. Wenn ich gehe, geht ein Bison. Wenn ich raste, ruht ein Berg. Wehe! Sie darf nicht. Sie wird nicht. Wenn ich in Paris bin, lebt sie. Es wird nicht anders sein, weil es nicht darf. Sie darf nicht sterben. Später vielleicht, wenn wir es erlauben.