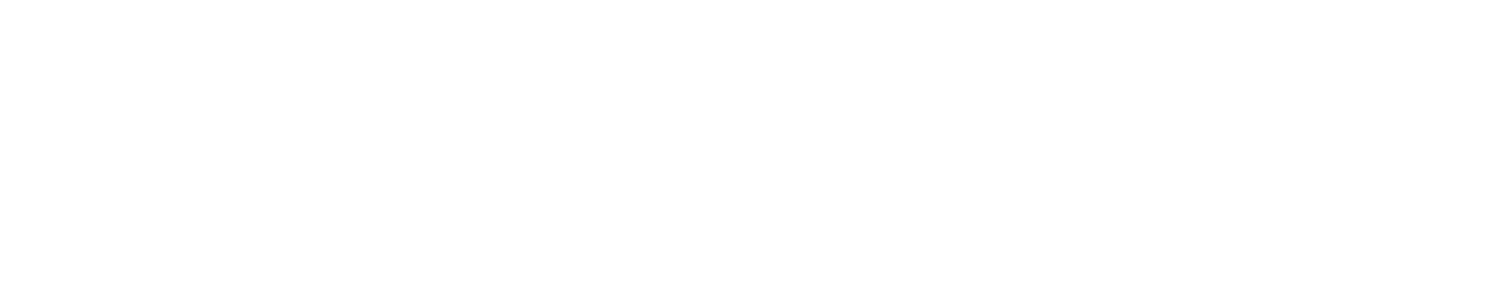Carl Nixon ist einer von ihnen. Sein Roman „Rocking Horse Road“, der jetzt im Weidle Verlag erschienen ist, ist zwar wunderhübsch aufgemacht – gleich auf den ersten Seiten wurden als Beigabe herzerweichende Landschaftsszenen eingefügt –, handelt aber von gar nicht so schönen Dingen.
Ein Mädchen, Lucy, liegt eines Morgens am malerischen Strand nahe Christchurch: Nackt, erwürgt, vergewaltigt. Sie war der feuchte Traum aller halbwüchsigen Jungs in der Gegend, und ihr Tod reißt eine Lücke in das sonst so friedliche, verschlafene Leben der neuseeländischen Provinz. Was Carl Nixon hier schafft, schmerzt beim Lesen fast ebenso sehr wie es fasziniert: Er macht das traumatische Erlebnis, das der Tod einer geliebten Person bedeutet, spürbar, indem er konsequent aus der Wir-Perspektive die quälende Suche der Übriggebliebenen nach dem Schuldigen beschreibt. „Rocking Horse Road“ ist aber eigentlich noch mehr: In dem groß angelegten Erzählzeitraum, der über zwanzig Jahre umfasst, geht es auch um die ganz großen Themen. Das Erwachsenwerden, den Verlust der Unschuld – und immer wieder um Neuseeland, dieses Sehnsuchtsland, das nach dem Lesen dieses Buches auch ein bißchen entzaubert ist.
Passend dazu auch wieder die äußere Gestaltung: Nimmt man den prächtigen Umschlag ab, der erst einmal wie die schönste Ansichtskarte der Welt aussieht, entdeckt man auf dem Einband grobkörnige Schwarzweiß-Fotografien von Stacheldraht und Menschen, die mit Stöcken aufeinander einprügeln. Auch das, eine Anspielung auf die ersten gewalttätigen Demonstrationen in Neuseeland anlässlich des Besuchs der südafrikanischen Rugbymannschaft im Jahr 1981, ist Teil des Romans. Unter der Oberfläche brodelt es, auch im Land der Hobbits, Kiwis und Maoris.
Carl Nixon: Rocking Horse Road. Weidle Verlag, 240 Seiten, mit Abbildungen, 19,90 €.