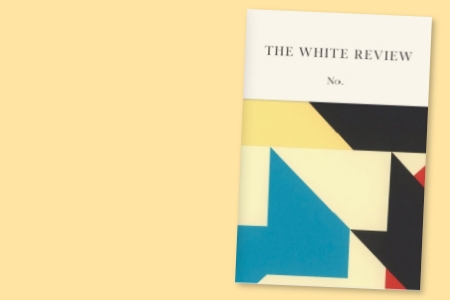Zur Grundausstattung jedes Haushalts bis weit in die neunziger Jahre hinein gehörte selbstverständlich: der Videorekorder.
Ob man nun eifriger Nutzer von Videotheken war oder einfach nur die Lieblingssendung aufzeichnete, das Überspielen, Zurückspulen und die charakteristischen Streifen im Bild – die sich mit jedem Abspielen häuften – wurden zwangsläufig zum festen Bestandteil vieler in dieser Zeit gesehener Lieblingsfilme. Das war alles natürlich unglaublich umständlich, aber auch auf eine im Rückblick sehr erleichternde Weise unperfekt: War das Band kaputt, konnte man den Film halt nicht sehen – Sicherheitskopien, Torrent-Download, YouTube oder Streaming gab es ja noch nicht.
Ty Segall aus San Francisco, um den es eigentlich in dieser Ausgabe der Clipkritik geht, hat dieses Jahr schon drei Alben in wechselnder Band-Besetzung herausgebracht, die tief im Garagenrock der sechziger Jahre verwurzelt sind. Seinem neuesten, diesmal solo aufgenommenen Album Twins schickte er die Single „The Hill“ voraus. Auf dem dazugehörigen Video kann man alle Vorzüge der Betrachtung eines VHS-Videos wiedererleben, als Bären kostümierte Bandmitglieder vor weißem Hintergrundrauschen inklusive. Und was den Vertrieb angeht, bleibt das Label Drag City dem Magnetband treu: Twins ist auch auf Musikkassette erhältlich. Also, Walkman raus und Videorekorder an!
Bisher erschienen in der Rubrik „Clipkritik“:
Eine Nachtmeerfahrt mit Hundred Waters
Auf Expedition mit Band of Horses
Kindergeburtstag mit Black Moth Super Rainbow
Motorradfahren mit Spiritualized