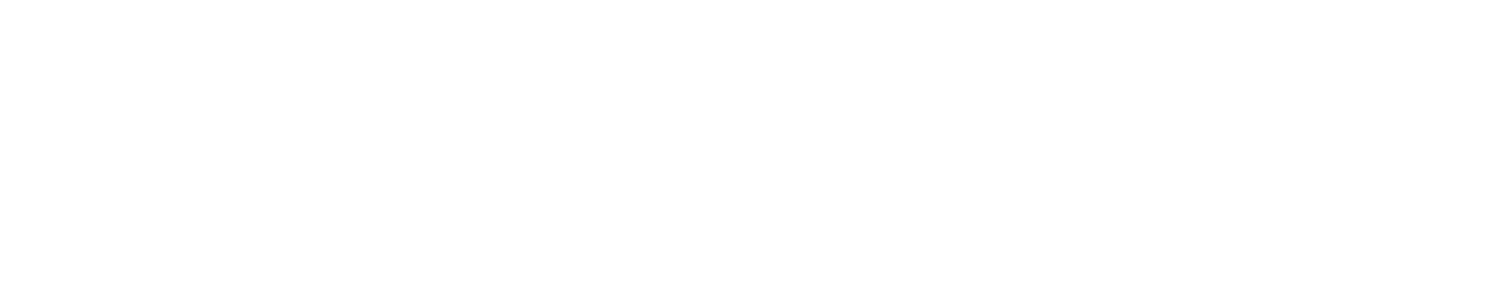Kühl ist es in Sascha Kokots Gedichten, es friert, zieht, knirscht in allen Ecken. Dazu passt die äußere Aufmachung: Der Band Rodung ist in einem dezenten Blaugrau gehalten, schmal, aber festgebunden, und räumt dem in eleganten Serifen gesetzten Text viel Freiraum ein.
Der Blick ins Buch zeigt: Sascha Kokot ist ein präziser Formulierer. Selten findet man Titel, Einrückungen oder Absätze im Textblock, was den Blick auf die Sprache selbst schärft. Gleichzeitig haben seine Texte etwas gnadenlos Insistierendes, das schon im Titel vorweggenommen wird: Wo einmal gründlich gerodet wurde, wächst so schnell nichts mehr.
Überhaupt erweist sich die Welt der Rodung als unwirtlich und lebensfeindlich. Bäume werden gefällt, Asche fällt ein, Glieder erlöschen. Das Ich nimmt die Rolle eines Beobachters der Zerstörung ein: „dort fällen sie noch immer auch wenn die/Krähen schon lange nicht mehr wissen wohin“. Oder es sieht sich selbst als Teil der vom Kahlschlag Betroffenen: „es wurde begonnen jede Lichtung jeden Weg auszuschildern/so wächst vor unseren Augen ein neuer Bestand/der sich konzentrisch um uns schließt“.
Bildet der Wald oft, wie etwa bei Ulrike Almut Sandigs Dickicht-Gedichten, eine Art mythische, überweltliche Schutzzone, findet man in diesem Band das genaue Gegenteil. Die Rodung bietet wenig Trost, dafür einen schockierend klaren Blick auf die Wirklichkeit der Unwirtlichkeit.