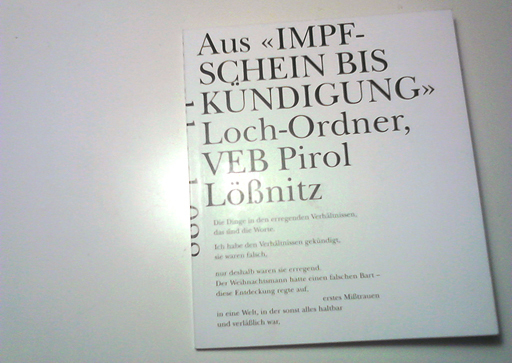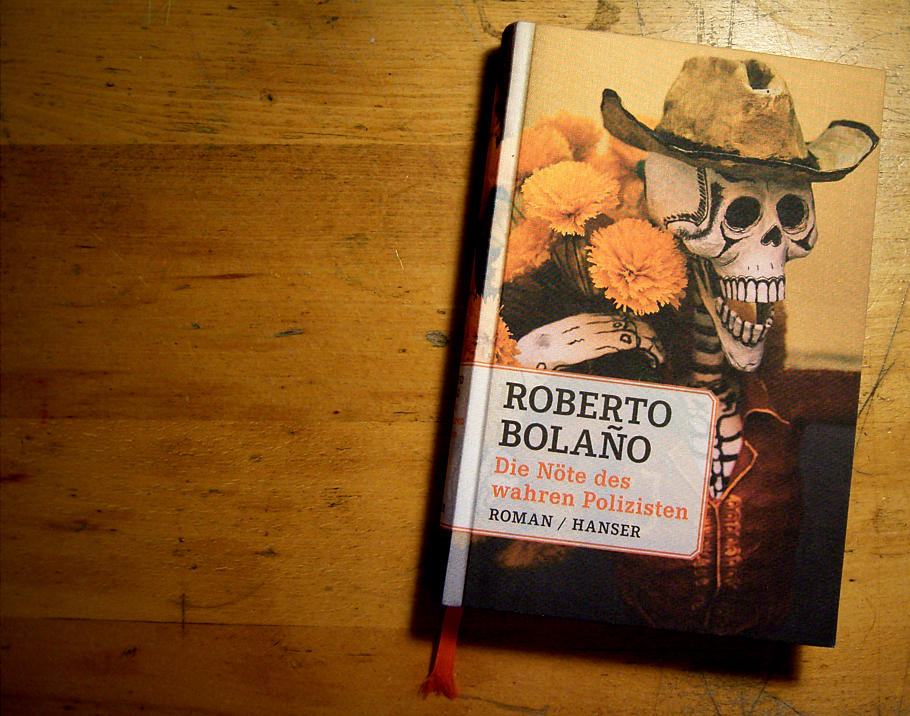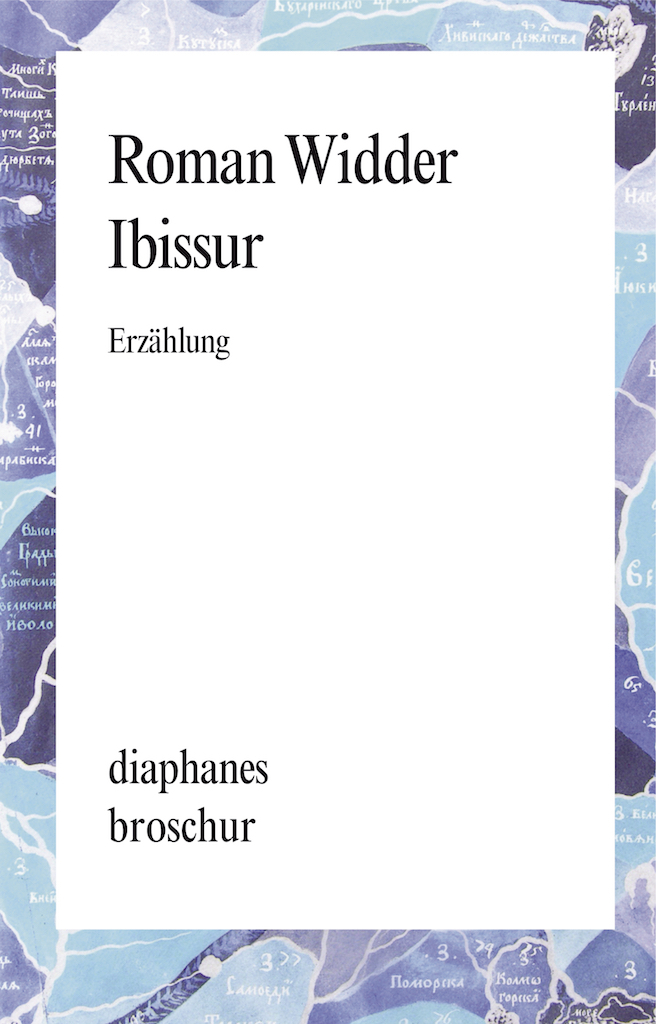Statt einer Thilo-Sarrazin-Karikatur entschied sich der Verfasser dafür, diesen Beitrag mit einem harmlosen Pony zu bebildern.
Dieser Artikel ist der Auftakt der neuen Reihe Karteikarte und soll die verstreuten Veröffentlichungen interdisziplinärer Künstlerinnen und Künstler sammeln, die sich einer einfach Kategorisierung typischerweise entziehen. Die erste Karteikarte beschäftigt sich mit dem Lyriker, Dramatiker, Erzähler und Hörspielautoren Wolfram Lotz.
Treuen BELLA-triste-Lesern ist sicherlich der „Monolog des gefangenen Negers“ in der aktuellen Ausgabe 35 hängengeblieben. Wer genau hingeschaut hat, dem wird nicht entgangen sein, dass auch in der zeitgleich erschienenen Edit Nr. 61 ein Lotz-Monolog abgedruckt ist, namentlich aus der Perspektive von Thilo Sarrazin. Bewegt man sich von hier aus rückwärts in der Zeit, gelangt man zu einer Rezension im Poetenladen, die sich der Einzelveröffentlichung Fusseln widmet, einer Liste, die in der Parasitenpresse erschienen ist. Theater macht Wolfram Lotz auch, da erzählte Nikola Richter kürzlich von einem amüsanten Kommentaraustausch aufgrund einer Verwechslung im Blog zum diesjährigen Theatertreffen:
Auch bin ich es ja als Jungautor gewöhnt, mit anderen, ebenfalls nichtssagenden Jungautoren verwechselt zu werden, die ihr Handwerk ebenfalls auf einer Schreibschule gelernt haben (zum Beispiel, wie man einen Stift hält, oder dass man einen Satz mit einem Großbuchstaben anfängt), allerdings dann eher textlich, nicht so sehr mein Äußeres betreffend.
Die Verwechslungsgefahr ist offenbar tatsächlich ein Problem, denn das Hörspiel über die „Seekuh Tiffany“, das ursprünglich in diesem Artikel Wolfram Lotz zugerechnet werden sollte, stammt in Wirklichkeit von Roman Ehrlich. Obwohl Wolfram Lotz auch Hörspiele schreibt, was sich aber aufgrund eines Ladefehlers auf der Webseite des SWR nicht hundertprozentig verifizieren lässt. Erreichbar ist dagegen dieser Klagegesang über die Zerstörung eines Hochhauses, der mit der schönen Zeile schließt: „Hier stellte die Frau einen Apparat an, aber dieser war kaputt.“