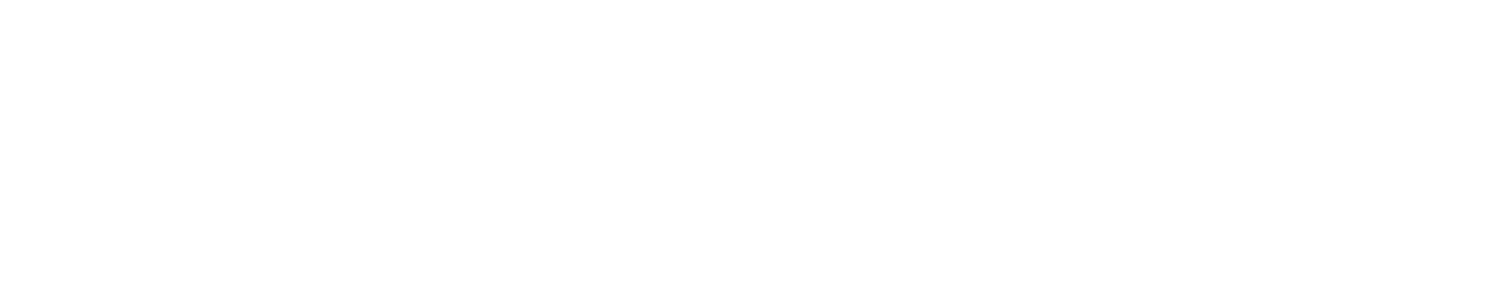Eben noch in Klagenfurt, jetzt im Buchhandel: Das kalte Jahr (Foto: bachmannpreis.eu)
Roman Ehrlich nimmt sich in seinem Debütroman Das kalte Jahr viel vor, scheitert aber an einem grundsätzlichen Problem: Das Buch ist zu langweilig.
Man sollte nicht den Fehler machen, dieses Buch an einem heißen Sommertag zu lesen. Ein Umstand, den der Autor am wenigsten beeinflussen kann, ist natürlich der Veröffentlichungszeitpunkt seines Buches. Titel werden verschoben, vorgezogen, oder einfach für einen bestimmten Termin eingeplant. Bei Roman Ehrlich war es die Woche nach seiner Lesung um den Ingeborg-Bachmann-Preis, und die könnte dem Wetter zutrotz öffentlichkeitswirksamer nicht gewählt gewesen sein – auch wenn außer dem Riesenmaschine-Preis der Automatischen Literaturkritik kein Pokal aus Klagenfurt an den Autoren von Das kalte Jahr ging.
Aber stimmt die eingangs ausgesprochene Warnung wirklich? Oder ist auch das nicht wieder viel zu sehr Klischee, ein Buch, in dem es durch eine eine karge, nebelumhüllte Landschaft geht, auch nur an bewölkten Herbsttagen zu lesen? Anders gesagt: Wie sehr prägen eigentlich äußere Umstände die Lektüre, oder sollte ein wirklich gutes Buch nicht einen Sog entwickeln, bei dem es schlicht egal ist, wann, wo, und bei welchem Wetter man es liest?
Die Anlagen für eine Sogwirkung sind da, soviel kann man sagen. Das kalte Jahr ist ein Roman, der versucht, eine eigene, beunruhigende Welt zu erschaffen. Der Ich-Erzähler wandert durch Gegenden, die Züge einer nicht weiter bestimmbaren europäischen Provinz haben; zusätzlich ist diese Landschaft mit militärisch-industriellen Elementen ausgestaltet: Eine schnurgerade Autobahn dient als Orientierungspunkt; das heimische Elternhaus, Ziel der Wanderung, liegt nah an einem verlassenen Militärstützpunkt an der Küste, wo Gefechtstürme und Patrouillenboote ein latentes Gefühl der Bedrohung erzeugen.
Was der Roman dagegen nicht schafft, ist die Übertragung dieser Bedrohungslage auf die sprachliche Ebene: Ehrlich experimentiert mit verschiedenen Schreibstilen, zitiert aus historischem Material über Naturkatastrophen, fügt sogar Bilder ein, die den Text durchbrechen – leider aber scheitert er bei dem Versuch, einen eigenen Ton für das aus der Sicht des Ich-Erzählers erlebnisartig Aufgezeichnete wiederzugeben. Knapp, kühl und lakonisch kleidet sich, was sich bei genauerer Sicht als banal herausstellt: Ist es wirklich wichtig, wieviele Äpfel der Erzähler im Rucksack hat? Wie oft er seine Wasserflasche auffüllt? Wie er sich (auch wenn dies ein gutes Bild ist) nachts unruhig in seine Laken „schraubt“? Unter dieser Problematik leidet der gesamte Romanaufbau, denn was sich über kurz oder lang einstellt ob der ganzen Kargheit, Lakonie und postzivilisatorischem Survival-Denken, ist schlicht Langeweile. Eine riskante Angelegenheit, die zu Ungunsten einer gut angelegten Idee ausgeht.
Roman Ehrlich: Das kalte Jahr. DuMont Verlag, Köln, 240 Seiten, 19,99 €