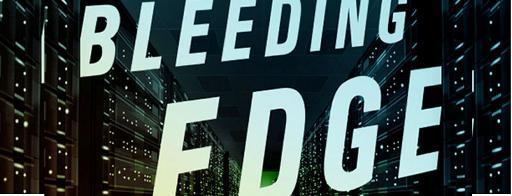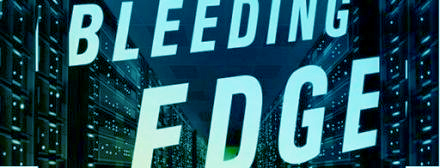
Es geht weiter: Nach dem „helical and slow“-Auftakt des letzten Beitrags nun der zweite Teil des Lesetagebuchs zu Thomas Pynchons Bleeding Edge.
Lesefortschritt: 48%
Was sich im ersten Teil noch angenehm spinnert las, wird nun durch zahlreiche neue Figuren und Schauplätze ernsthaft kompliziert, was zwar bei Pynchon nicht gerade überrascht, aber zwischenzeitlich doch etwas zu Lasten der Aufmerksamkeit geht. Es treten auf: March Kelleher, eine ehemalige Nachbarin von Maxine, die einen Alumni-Vortrag an der Otto Kugelblitz School hält. Sie ist die Schwiegermutter von Gabriel Ice, dem Geschäftsführer der obskuren Firma hashslingrz, die immer noch im Fokus von Maxines Ermittlungen steht. Auf ihrem Weblog tabloidofthedamned.com prangert sie dessen Geschäftspraktiken an – was Maxine ihr erzählt, liefert ihr noch mehr Stoff zum Rundumschlag gegen den ungeliebten Schwiegersohn. Im Gegenzug gibt sie wiederum Maxine den Hinweis, dass sich Gabriel Ice ausgiebig mit dem Montauk-Projekt beschäftigt, einer geheimen Studie der US-Regierung über neuartige Technologien (und eine beliebte Verschwörungstheorie) und bittet sie, Grüße an Tochter Tallis zu übermitteln, die schon vor längerer Zeit den Kontakt abgebrochen hat. Tallis ist nicht nur die Ehefrau von Gabriel Ice, sondern auch Controllerin für hashslingerz und scheint über mehr Bescheid zu wissen, als sie von sich preisgibt. Rocky Slagiatt macht Maxine außerdem mit dem Geschäftsmann Igor Dashkov bekannt, der sie bittet, einige Transaktionen von Bernie Madoff zu überprüfen und sie mit russischer Eiscreme versorgt. Mehr ungeklärte Zahlungen tauchen auf, unter anderem an die Fiberglas-Firma Darklinear Solutions, eine Observation ergibt, dass Tallis Kelleher Ice dort offenbar private Interessen verfolgt. Auf einer koreanischen Karaokeparty berichtet der ehemalige Inhaber von hwgaawgh.com, Lester Traipse, noch einmal über die ungewöhnlich großen finanziellen Zuwendungen von Gabriel Ice an seine Firma; später stellt sich heraus, dass Lester für sich selbst eine Ader aus dem Geldstrom abgezweigt hat. Nun taucht auch die erste Leiche auf, Maxine macht eine Bootstour mit Maxine Kelleher und ihrem Mann Sid und bekommt eine Videokassette zugespielt, die sie veranlasst, nach Montauk zu fahren, wo Gabriel Ice ein großzügiges Ferienhaus mit gesichertem Kellerabteil unterhält, ganz in der Nähe des Radargeräts AN/FPS-35, das in direkter Verbindung mit dem Montauk-Projekt steht. Weitere Nebenfiguren sind der Geruchsexperte („professional nose“) Conkling Speedwell, der mit seinen Fähigkeiten bei der Aufklärung hilft, sowie der Webentwickler und Fußfetischist Eric Jeffrey Outfield.
Der chaotische, durch zahlreiche Abschweifungen immer schwerer zu verfolgende Handlungsfaden ist im zweiten Viertel von Bleeding Edge stark durch Maxine Tarnows rasante Ermittlungsarbeit gekennzeichnet, die sie mal mehr, mal weniger zielgerichtet zu Land und zu Wasser bis in die ländliche Umgebung New Yorks verschlägt. Über das Deep Web erfährt man vorerst weniger, es wird lediglich angedeutet, dass sich auf der Defcon-Messe für Hacker und Internet-Experten in Las Vegas ein großer Pool an Interessenten für die DeepArcher-Software gebildet hat.
Markierte Zitate:
Maxine Tarnow zu Gabriel Ice über March Kellehers Weblog tabloidofthedamned.com:
„She’s got you that worried? Come on, it’s only a Weblog, how many people even read it?“ (Link)
Während der koreanischen Karaoke-Party:
„Drowning out even the piped-in karaoke music, the row ostensibly has to do with tables versus CSS, a controversial issue of the time, which has always, given its level of passion, struck Maxine as somehow religious.“ (Link)
Igor Kashkov über die Unterschiede zwischen amerikanischer und russischer Eiscreme:
„‚No, no, it’s real ice cream,‘ Igor explains. ‚Russian ice cream. Not this Euromarket food-police shit.‘ ‚High butterfat content,‘ March translates. ‚Soviet-era nostalgia, basically.‘ ‚Fucking Nestlé,‘ Igor rooting through the freezer. ‚Fucking unsaturated vegetable oils. Hippie shit. Corrupting entire generation. I have arrangements, fly this in once a month on refrigerator plane to Kennedy. OK, so we got Ice-Fili here, Ramzai, also Inmarko, from Novosibirsk, very awesome morozhenoye, Metelitsa, Talosto … today, for you, on special, hazelnut, chocolate chips, vishnya, which is sour cherry …‘ (Link)
Maxine nach der Bootstour mit March und Sid:
„(…) she feels free—at least at the edge of possibilities, like whatever the Europeans who first sailed up the Passaic River must have felt, before the long parable of corporate sins and corruption that overtook it, before the dioxins and the highway debris and unmourned acts of waste.“ (Link)
Deutsche Pressestimmen: