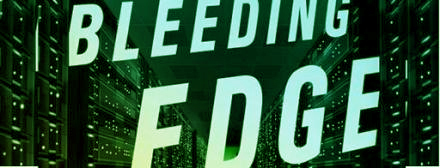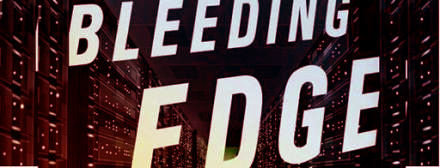Die Lesungsreihe „Literatur in Weißensee“ ist inzwischen bereits in die zehnte Runde gegangen – Zeit für einen kleinen Rückblick.
Die Lesung ist das ideale Format, um unbekannte Literatur zu entdecken: Man muss sich nicht durch Klappentexte quälen oder Geld für ein Buch ausgeben, das dann doch im Regal verstaubt, man lernt nicht nur ein Werk, sondern auch den Autoren kennen und ist – social reading! – nicht allein mit seinen Eindrücken, sondern kann sich direkt im Anschluss mit anderen darüber austauschen.
Das erklärte Ziel, den Berliner Stadtteil Weißensee kulturell mit einem breitgefassten Lesungsprogramm zu bereichern, hat Veranstalter Alexander Graeff in wechselnden Konstellationen verfolgt und so ein großes Angebot für Literaturinteressierte geschaffen: Zu Themen mit großen Assoziationspielraum wie „Tier“, „Zeit“, zuletzt „Religion“ und „Tradition“ lud er Autoren zum literarischen Dialog in den Roten Salon der Brotfabrik. Das Genre von reichte dabei von Kürzestgedichten bis zum 400-Seiten-Roman, multimedial angereichert oder gleich mit eigenständigem musikalischen Begleitprogramm.
Auch mehrsprachig ging es zu: Mit Dato Barbakadse war ein georgischer Autor zu Gast, Ricardo Domeneck brachte portugiesische Verse auf die Bühne, wohingegen Verleger Johannes Frank Erzählungen auf englisch vortrug und Tobias Roth sich nicht scheute, die Motti seiner Gedichte im lateinischen Original zu lesen.
So ist mit der Zeit eine kleine Bibliothek der Gegenwartsliteratur entstanden, die auch Empfehlungscharakter für Nicht-Weißenseer hat:
- Mikael Vogel: Massenhaft Tiere
- Anja Kümmel: Träume digitaler Schläfer
- Daniel Ketteler: Grauzone
- Ricardo Domeneck: Körper. Ein Handbuch
- Sascha Reh: Gibraltar
- Asmus Trautsch: Treibbojen
- Johannes Frank: Erinnerungen an Kupfercreme
- Tobias Roth: Aus Waben
Weiter geht es übrigens am 17. November mit Marlen Pelny, die als literarischer und musikalischer Gast auftreten und ihr neues, bei Voland & Quist erschienenes Buch Wir müssen nur noch die Tiere erschlagen mitbringen wird.