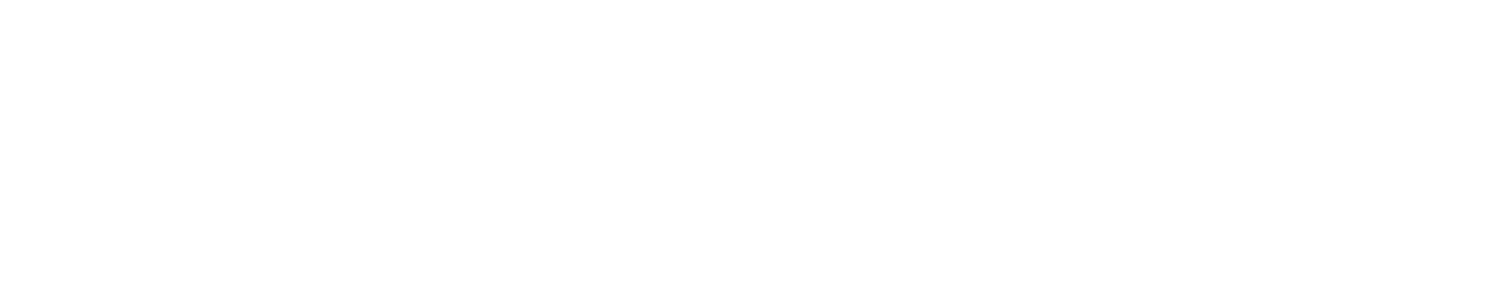Svenja Leiber holt in ihrem neuen Roman Das letzte Land weit aus und verwebt die Fäden ihres bisherigen Erzählens gekonnt zu einem großen Ganzen – ein Roman, der viel wagt, aber dabei glücklicherweise auf dem Boden der Tatsachen bleibt.
Die Verlagsankündigung vom „kapitalen Bildungsroman“, den die 1975 in Hamburg geborene, mit zahlreichen Preisen ausgezeichnete Autorin Svenja Leiber hier abliefere, kann jeder halbwegs an Literaturgeschichte interessierte Leser nur mit einem Kopfschütteln quittieren. Dennoch stimmt sie in ihrer vollmundigen Art zumindest in der einen Hinsicht: Svenja Leibers Bücher sind mit der Zeit immer umfangreicher geworden. Büchsenlicht, das so wunderbar betitelte Debüt mit Erzählungen über Sonderlinge aus der norddeutschen Provinz, setzte bei 160 Seiten an. Schipino, der Aussteigerroman eines frustrierten Deutschen, der im wilden Osten sein Glück sucht, erhöhte auf 208 Seiten. Nun, mit dem zweiten, inzwischen bei Suhrkamp herausgekommenen Roman Das letzte Land ist die 300-Seiten-Marke geknackt. Viel Platz, um die unerhörte Geschichte, die hier erzählt wird, über den großen Zeitraum von über sechzig Jahren zu spannen.
Und darum geht es: Der Junge Ruven Preuk wächst irgendwo im Nirgendwo der deutschen Provinz am Vorabend des ersten Weltkriegs auf. Der Sommer brütet über den Alleen, Landarbeit auf den Feldern wird verrichtet, während die Wäsche zum Trocknen auf der Leine hängt – fast ein Setting wie in Michael Hanekes Film Das weiße Band, mit dem dieser Roman einsetzt. Und tatsächlich schart sich um Ruven herum das Personal, mit dem man in solch einem Setting rechnen muss. Stumpfsinnigkeit, aber auch eine Atmosphäre von Gewalt und derbem Landleben ist deutlich spürbar. Umso klarer wird bald, dass Ruven aus einem ganz anderen Holz geschnitzt ist, hat er doch eine besonders feine musikalische Begabung, mit der er sich fortan durch das Chaos der Geschichte des 20. Jahrhunderts schlagen wird. Er lernt meisterhaft Geige spielen, erst bei einem jüdischen Musiklehrer mit einer wunderschönen Tochter, dann bei einem Professor in der großen Stadt. Er heiratet, bekommt eine Tochter, zieht in den Krieg; seine Frau betrügt ihn und kann mit der Schande nicht leben; am Ende des Romans ist Ruven ein alter Mann, die Musik aber ist ihm geblieben.
Vieles spricht dafür, dass Svenja Leiber hier die Quersumme ihres bisherigen literarischen Schaffens bildet: Vor allem in den furiosen ersten hundert Seiten von Das letzte Land bedient sie sich einer süffigen, mal mehr, mal weniger stark vom Plattdeutsch gefärbten Sprache, die ihr auch in Büchsenlicht brillant gelungen ist. Zuviel Grausen vor dem mal einfachen, meist aber schlicht tumben Personal, das sich ein Stelldichein gibt, weiß sie mit einem gewitzten Humor abzuwenden, etwa wenn Mutter Preuk gegenüber dem Pastor steif und fest an ihrem Aberglauben festhält, dass ihr weiser Erbstock die Zukunft voraussehen könne. Berührend gelingt ihr auch die Schilderung der sich zart andeutenden, aber letztlich unerfüllt bleibenden Liebe zwischen Ruven und Rahel, der Tochter des Musiklehrers.
Im Gesamtverlauf dieser wirklich reichhaltigen Erzählung, und das ist dann vielleicht der einzige Kritikpunkt, droht man etwas den Überblick zu verlieren, wenn der Fokus zu sehr auf Randfiguren oder Nebenhandlungen verweilt. Hier ist es vielleicht der überbordende Gestus des Geschichtenerzählens aus der Zeit von Büchsenlicht, der wieder zu stark in den Vordergrund gerät. In der epischen Ausarbeitung ihres Stoffs geht Svenja Leiber in Das letzte Land aber einen entscheidenden Schritt weiter, als sie es noch im Vorgänger Schipino wagte. Dort war es die doch alles in allem recht geradlinige Reise des überforderten Stadtmenschen auf der Suche nach Erneuerung, die dem Roman auf der ganzen Strecke die Spannung entzog. Zu sehr schwarz-weiß erschien zudem der Kontrast zwischen Großstadt und Wildnis, Zivilisation und Natur, Menschenmassen und spleenigen Individuen im Aussteiger-Dorf Schipino.
Das ist hier ganz anders: Man erlebt – so viel Bildungsroman ist Das letzte Land dann doch – Ruven Preuk als jungen Mann kennen, Außenseiter zweifelsohne, aber auch einer, der in sein Talent erst hineinwachsen muss, es unterschiedlich nutzt, aber auch lernen muss, mit Schicksalsschlägen und gesellschaftlichen Veränderungen umzugehen, und so langsam vor den Augen des Lesers, ja, erwachsen und zu einer vielschichtigen Figur wird.
Mit Das letzte Land ist Svenja Leiber zweierlei gelungen: Eine Weiterentwicklung des eigenen Werks auf der Basis von zwei ganz unterschiedlichen Vorgängern; gleichzeitig aber auch ein auf eine seltsam anrührende Weise ganz altmodischer Roman. Man kann sich regelrecht festlesen in der großzügig ausgebreiteten Geschichte, die sich mit großer Detailfreude und einem Ohr für das dem Mundartlichen Abgelauschte aufrollt. Zeit allerdings muss man mitbringen, aber das trägt schließlich sehr zum Genuss dieses großen, aber keineswegs „kapitalen“ oder etwa „gebildeten“ Geschichtsromans bei.
Svenja Leiber: Das letzte Land. Suhrkamp Verlag, 320 Seiten, 19,95 €
Beitrag zuerst erschienen auf FIXPOETRY. Wir reden über Literatur.
Jetzt weiß ich nicht mehr wo ich bleiben soll

Schwer zu sagen, warum der letzte Vers in Ann Cottens Gedicht „Eine Zeit lang bin ich früh nach Hause gegangen“ so eine melancholische Wucht entwickelt. Vielleicht ist es der scharfe Kontrast zwischen kindischem Reimen (blasser, krasser, voll, soll) und der Plötzlichkeit der Erkenntnis über eine Art Verlorenheit, die sich nicht nur aus einer Unentschiedenheit zwischen Heimgehen und Noch-in-der-Kneipe-Bleiben speist, sondern geradezu als Epiphanie im Alltag – ja, was? – eine Ortlosigkeit, Unbehaustheit, Einsamkeit als allgemeinen Zustand formuliert. Lesen kann man es jedenfalls in voller Länge (bzw. Kürze) seit gestern als Teil von einem Gruß aus Japan im Suhrkamp-Logbuch, und das ist sehr gut so.
Zuletzt von Ann Cotten erschienen:
Hauptwerk. Softsoftporn. Verlag Peter Engstler, 72 Seiten, 14 €
Der schaudernde Fächer. Suhrkamp Verlag, 251 Seiten, 21,95 €
Foto © Suhrkamp Verlag
Wie von Sinnen lag ich da
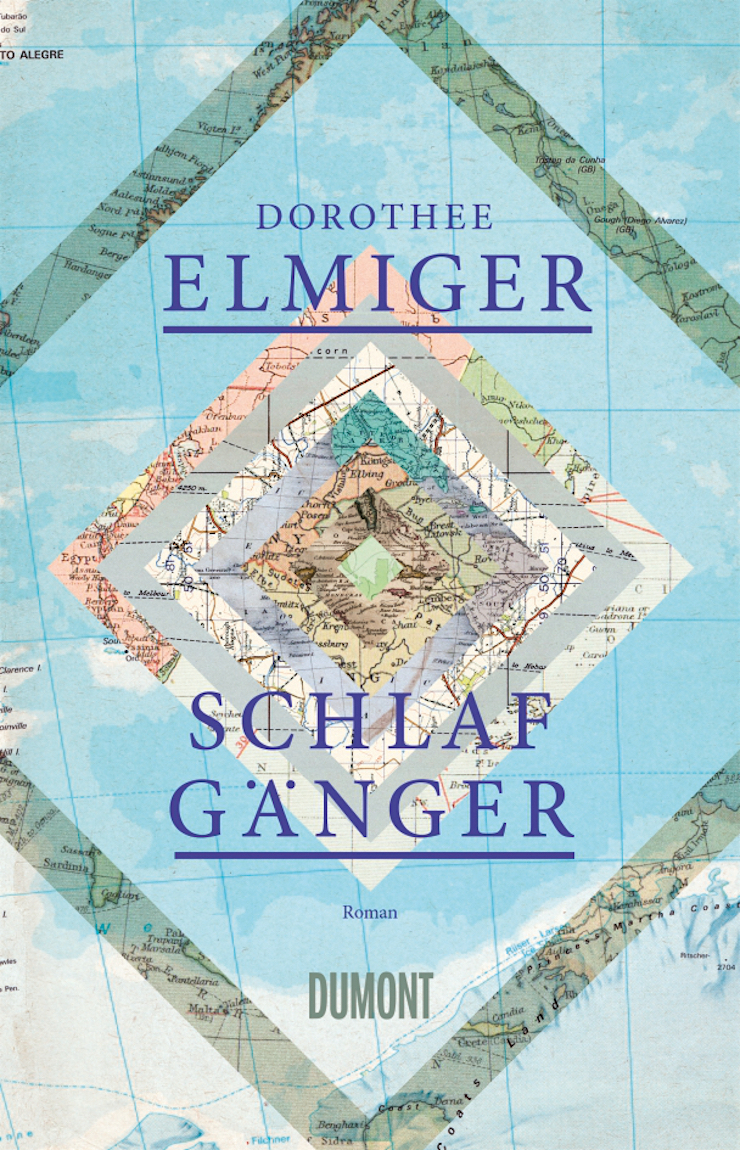
Schlafwandler kreuz und quer durch Europa: Wer wissen will, was Literatur jenseits von Familien- und Beziehungsdramen vermag, für den führt in diesem Frühjahr an Dorothee Elmigers neuem Roman Schlafgänger kein Weg vorbei.
Wobei – wie schon beim letzten Buch – wieder spätestens nach der zweiten Seite die lästige (weil eigentlich völlig unnötige) Frage auftauchen mag: Ist das überhaupt noch ein Roman? Antwort: Egal! Geht doch diese Prosa ohnehin ihrer ganz eigenen Wege, so kühn und experimentell montiert, noch ein ganzes Stück experimenteller als in Einladung an die Waghalsigen, ist dieser neue Text, der gleich fünf Hauptpersonen hat, die abwechselnd ihre Geschichten erzählen, bruckstückhaft, fragmentarisch, man kann sich nicht einmal sicher sein, ob diese Personen sich beim Sprechen im selben Raum befinden, also wer wem gerade genau erzählt, so oft kommt es zu Überschneidungen, Wiederholungen und unvermittelt wechselnden Perspektiven auf ein und dasselbe Geschehen.
Dieses Geschehen, das flüchtige, oszillierende Thema des Romans, lässt sich vielleicht am besten mit einem stetigen Kommen und Gehen umreißen: Es geht um afrikanische Flüchtlinge in einer Grenzstadt nahe Basel, die hinein wollen, dann aber wieder um die Bewegung fort, aus der Schweiz, diesem „nur scheinbar geschlossenen Ganzen“, an die Grenzen Europas, nach Portugal zum Beispiel. Ein guter Teil des Romans spielt aber auch in Los Angeles, der Stadt, die auf „tausend kleinen Erhebungen“ (eine kleine Reminiszenz an den glühenden Flöz in der Einladung an die Waghalsigen) erbaut wurde. Ähnlich auch zum Vorgängerroman – freilich aber viel genauer herausgearbeitet und formuliert – die Atmosphäre: In allem, was die Hauptfiguren, im Übrigen anscheinend ein willkürlich zusammengeworfener Haufen, ein „Logistiker“ ist darunter, eine Schriftstellerin, eine Übersetzerin, ein Musiker und eine Frau, die nur mit ihrem Namen A.L. Erika vorgestellt wird, in allem, was diese Figuren also berichten, schwingt eine bedrohliche, beunruhigend-ruhelose Stimmung mit: Gewalt, Unterdrückung oder schlicht, und das ganz ohne Witz, eine Angst vor dem bevorstehenden Weltuntergang.
Im Schlaf, sagte die Übersetzerin, sah ich einmal das ganze europäische Gebirge zusammenbrechen, wie von Sinnen lag ich da, aber still, hörte auch Geräusche in diesem Zusammenhang, die Gipfel zerbrachen vor meinen Augen, alles stürzte langsam ein und kam mir als Geröll entgegen, Gestein wurde durch die Luft geschleudert, ich sah, wie die Flanken in Bewegung gerieten, in Stücke zerfielen, alles kam auf mich zu. Später wachte ich auf, der Raum war leer, die Heizung auf höchster Stufe eingestellt. Unverändert lag die Landschaft vor den Fenstern, das ganze nächtliche Panorama, das aufgefaltete, das gestapelte Gestein.
Dass das immanent politische Literatur ist, die ohne Zeigefinger, vielmehr im Auffangen einer Stimmung viel über eine Zeit aussagt, der nahezu alle Sicherheiten abhanden gekommen sind, dass sie das aber auch in einer Sprache vermag, die vor Schönheit fast zerbirst, ohne je pathetisch oder gekünstelt zu wirken, das ist eine Kombination, die nur in absoluten Glücksfällen, wie dies zweifellos einer ist, gelingt.
Dorothee Elmiger: Schlafgänger. DuMont Verlag, 160 Seiten, 18 €
Dieser Artikel erscheint live von der Leipziger Buchmesse 2014. Dorothee Elmiger stellt ihren Roman Schlafgänger im Rahmen von „Leipzig liest“ an folgenden Terminen vor:
Donnerstag, 13. März, 21 Uhr: Lange Leipziger Lesenacht
Samstag, 15. März, 18 Uhr: «Auftritt Schweiz» (Schauspielhaus)
Sonntag, 16. März, 16 Uhr: Schweizer Forum (Glashalle)