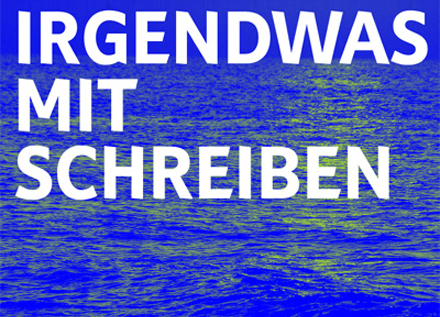
„Fuck Leipzig!“ Wenn eine Podiumsdiskussion im ehrwürdigen Roten Salon der Berliner Volksbühne Teilnehmern solche Statements entlocken konnte, war sie vielleicht doch nicht ganz überflüssig.
Zum Thema „Ästhetik 2.014“ lud Conférencière Christiane Frohmann zur neuesten Ausgabe des Katersalons, einer Veranstaltungsreihe, in der bereits über die Themenkomplexe Berlin Unschick, Cat Content und die neue Twitter-Literatur gesprochen und performt wurde. Diesmal sollte es um die Gegenwartsliteratur gehen, der mal Langeweile, mangelnde Introspektion, Erfahrungsarmut oder fehlende Ernsthaftigkeit bescheinigt wird. Diese Diskussion, die gerade im Frühjahr anhand des vielzitierten ZEIT-Artikels von Hildesheim-Absolvent Florian Kessler wieder entbrannt, aber keineswegs neu ist, sollte nun noch einmal auf den Prüfstand gestellt werden – erklärtes Ziel von Christiane Frohmann, die selbst auch E-Book-Verlegerin ist, war zudem die Frage zu klären, ob im Internet, bei Twitter und auf Facebook nicht mittlerweile eine neue Literatur stattfinde, die jenseits von Feuilletondiskussionen schon ein reges Eigenleben führt.
Diese Frage blieb freilich weitgehend als These im Raum, denn das ordentlich gefüllte Podium (zwei Verleger, drei Journalisten, drei Autoren, eine Kulturwissenschaftlerin) hatte sich auch so schon viel zu sagen. Da ging es um den Wunsch nach der „drängenden Erfahrung“, den Michael Angele (der Freitag) und Jörg Sundermeier (Verbrecher Verlag) nahezu unisono formulierten; hinzu kam von Seiten Angeles noch eine dezidierte Kritik an ironielastigem, zu sehr ins Witzelnde geratendem Schreiben, das eine Pose zeige, aber keine Inhalte – die Popliteratur sei da ein gutes, weil abschreckendes Beispiel. Passen dazu würde ein immer oberflächlicherer Journalismus, ergänzte Jörg Sundermeier weiter, der – aufgrund von massivem Einsparzwang und immer weniger Rückgriff auf freie Schreiber – bereits einen Großteil seines Niveaus eingebüßt habe und nur noch „Homestorys“ zu fabrizieren imstande sei.
Harter Tobak für die anwesenden Vertreter der jungen Autorengeneration, allesamt mit Schreibschulhintergrund Hildesheim: Stefan Mesch etwa machte in einem eindrücklichen Statement klar, wie schwer es überhaupt sei, so weit zu kommen und sich selbst zuzutrauen, den Stoff, den man für sich irgendwann einmal gefunden habe, auch ernst zu nehmen und weiterzuverfolgen – selbst wenn es nicht um die großen, existenziellen Themen, sondern um Liebeskummer in der Kleinstadt und Einsamkeit an der Bushaltestelle gehe. Das Argument der „Deformation“ war von Jan Fischers Seite noch eine willkommene Ergänzung, die das oft monierte Gleichförmige der Schreibschul-Prosa versuchte, zu entkräften: Gerade wenn man merke, dass alle im Seminar dasselbe Handwerkszeug erlernen, um ihre Geschichte zu bauen, sei es wichtig, einen Weg zu finden, wie man sich wiederum absetzen, aber trotzdem interessant bleiben könne. Martin Spieß, der als unangekündigter Gast den Schreibschüler-Block erweiterte, hatte noch anzumerken, dass er harte, B-Movie- oder Breaking-Bad-artige Geschichten „von unten“ vermisse, und man konnte heraushören, dass er damit auch seine eigene Situation beschrieb, die ganz offenbar von einer gewissen Frustration geprägt war, mit diesen Stories nicht das große Publikum erreichen zu können – und das eigene Schreiben stattdessen einem Brotjob, in diesem Fall als Comedian, zu opfern.
Jörg Sundermeier, der die Diskussion mit scharfen, aber auch unterhaltsamen Wortbeiträgen gehörig würzte, konnte damit wenig anfangen: Fernsehserien wie Breaking Bad seien doch schon längst im Feuilleton angekommen, die gar zu inbrünstige Klage darüber, dass man nicht vom Schreiben leben könne, verstehe er nicht – habe doch nicht einmal Kafka seine Literatur in bare Münze verwandeln können, die prekäre Schriftsteller-Existenz sei also nichts Neues.
Lösungsvorschläge für die zahlreich angesprochenen Dilemmata und Problematiken mit dem Journalismus, dem Leben als Schriftsteller und der Situation der nach wie vor stark bürgerlich geprägten Gegenwartsliteratur konnten an diesem Abend nicht geliefert werden. In manchen Momenten wurde auch deutlich, warum: Diese Fragestellungen, die auch aufgrund der teils hitzigen Wortgefechte immer nur fragmentarisch angerissen werden konnten, müssten zusammengenommen eigentlich aufs gesamte Gesellschaftssystem bezogen werden – und dafür war der Rote Salon an diesem Abend dann doch nicht der richtige Ort.

Ein Kommentar zu „Geschichten aus dem deformierten Schreiben“