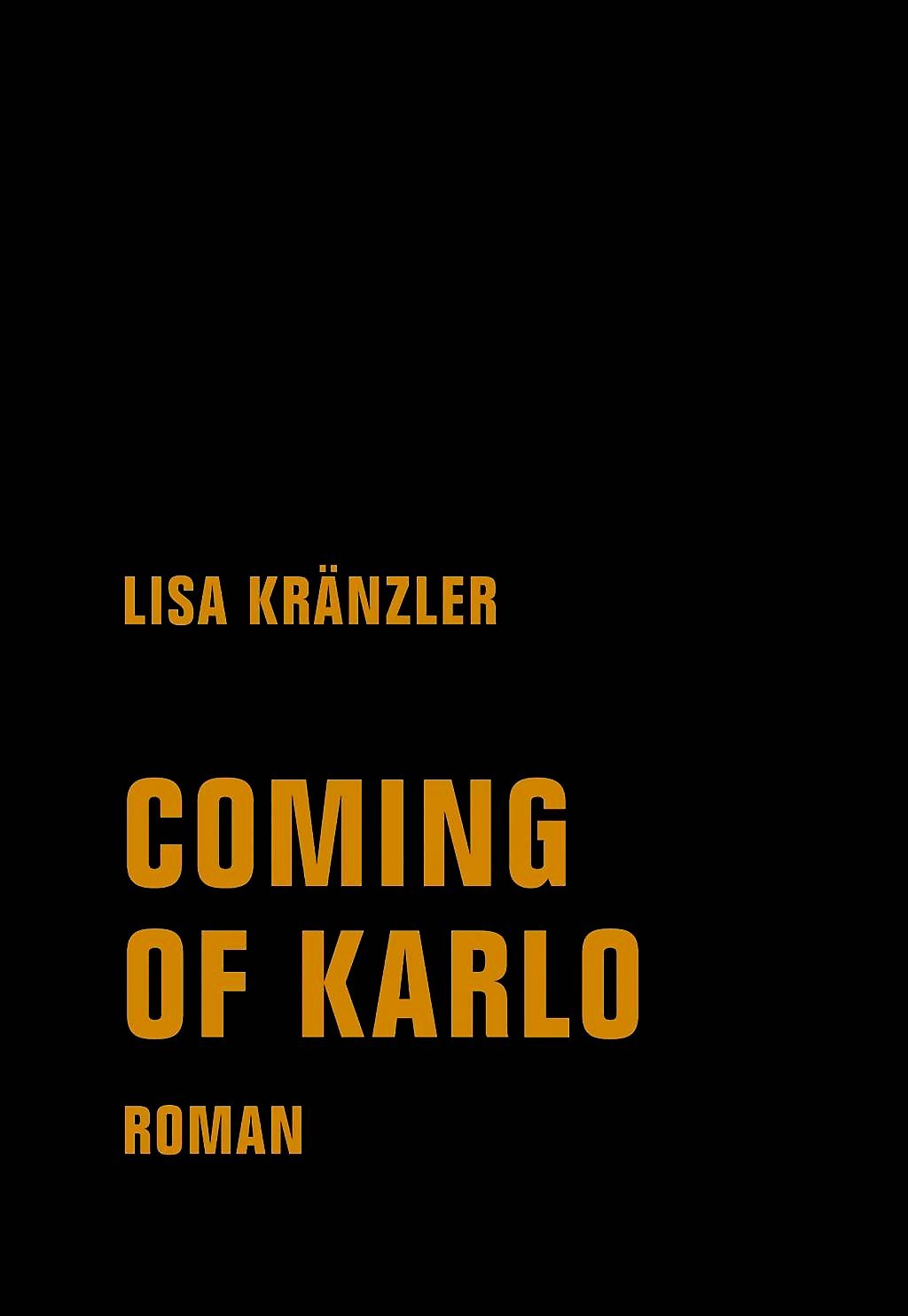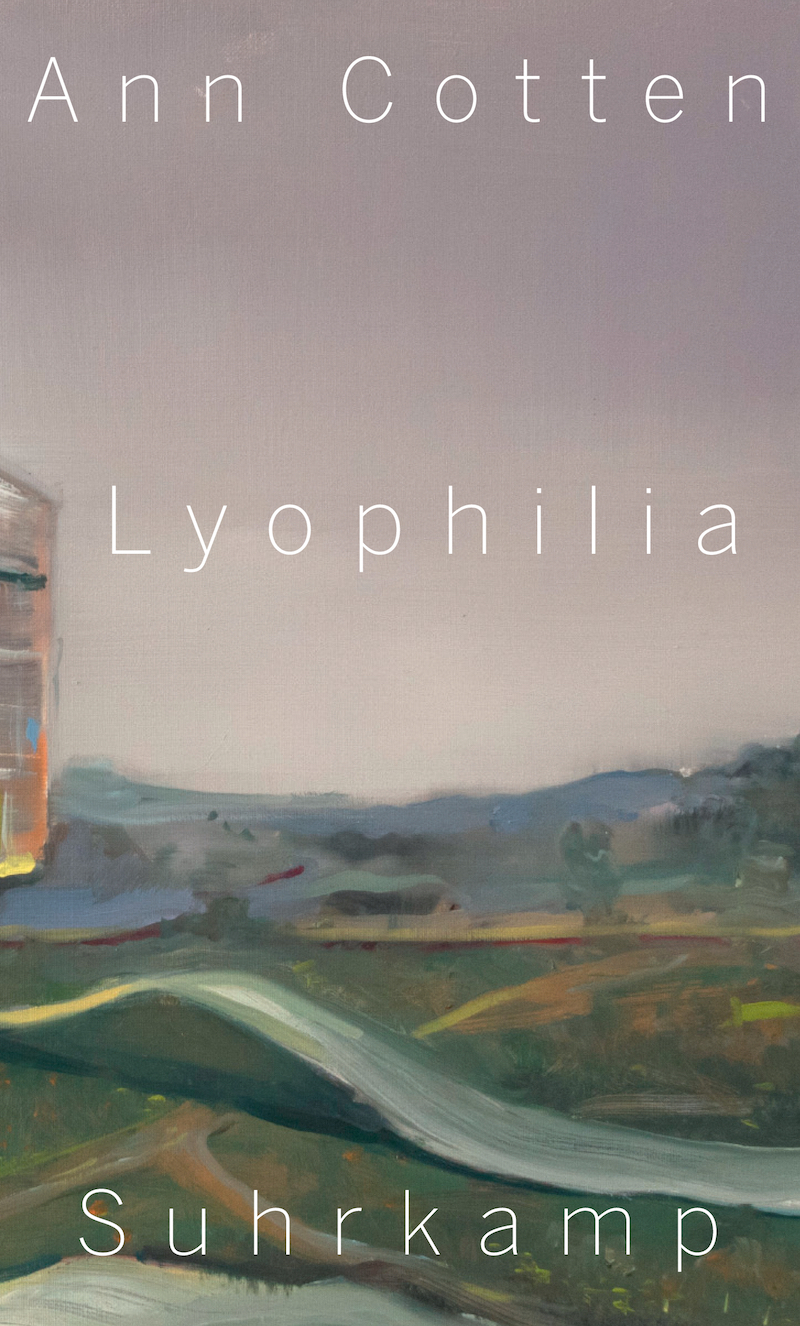Ihre EP Mechanical Bull setzte mit sparsamer Instrumentierung und genauem Blick einen Akzent zum Höhepunkt der #MeToo-Bewegung. Mit Beware Of The Dogs zeigt sich Stella Donnelly nun musikalisch vielseitiger.
Sorglos beschwingt sind die retro-poppig angehauchten Stücke auf Stella Donnellys erstem Album aber nur scheinbar: Was musikalisch harmlos erscheinen mag, macht sie auf der Textebene wieder wett:
I’ll tell your wife and your kids about that time
’Cause this is not ’93
You lost your spot on the team, you’re out of line
So heißt es gleich im ersten Song, der im schönen Refrain „you grabbed me with an open hand/the world is grabbin‘ back at you“ noch gleich eine kleine Breitseite gegen Donald Trump liefert. Auch der Titel „Old Man“ ist wohl nicht zufällig gewählt, er erinnert natürlich sofort an Neil Youngs großen Klassiker, den Stella Donnelly hier in einer schönen Ermächtigungsgeste einfach für sich neu definiert. Sie erzählt die andere Seite der Geschichte, wie Männer sich bei Frauen bedienen („He wants to take baby out, ‚Give us a smile'“) – der ganze Mechanismus toxischer Männlichkeit eben wird hier und in zwölf weiteren Songs ausführlich durchdekliniert: In der Familie, in Alltagssituationen („Lunch“, „Bistro“) oder der trügerischen Kleinstadtidylle im überzeugenden Titelstück „Beware Of The Dogs“.
Die australische Singer-Songwriterin, die 2018 vom Indie-Label Secretly Canadian entdeckt wurde, das flugs ihre EP re-releaste, hat ihre Musik konsequent weiterentwickelt: Vom sparsam instrumentierten Vorgänger ist nur das in ihrem typischen, durchdringenden Vibrato gesungene, zynische „Boys will be boys“ übrig. Aber es muss nicht eben die anklagende Ballade sein, Stella Donnelly versetzt der von ihr besungenen männlichen Überlegenheitsmaschinerie lieber einen beschwingten Tritt in den Allerwertesten und setzt zur lustvollen Gegenerzählung an. Beware Of The Dogs steht damit gut da in einer Reihe von Titeln junger Künstlerinnen, die ganz selbstverständlich ein modernes feministisches Selbstbewusstsein in ihren Pop-Entwurf integriert haben.
Stella Donnelly: Beware Of The Dogs, Secretly Canadian, 43 Min., ca. 12 €