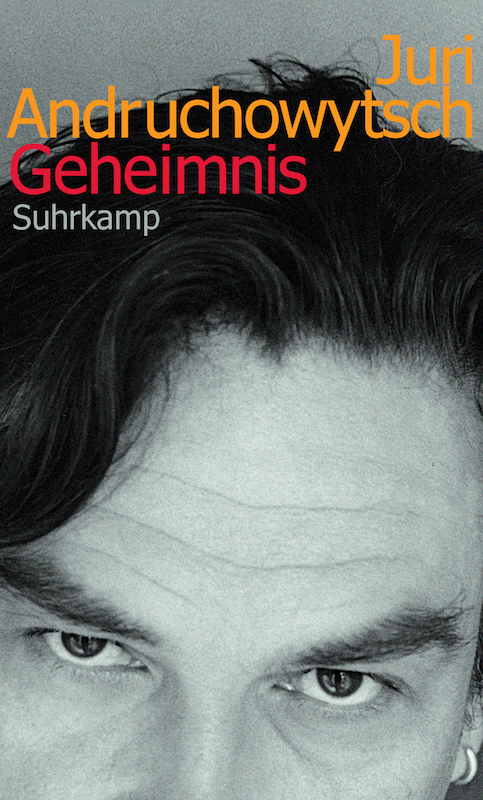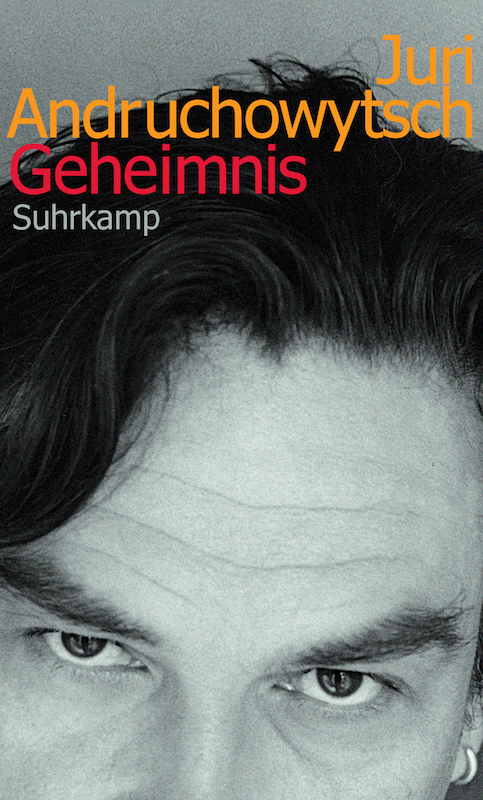
Der Fall der Berliner Mauer war in Osteuropa bekanntlich nur der Auftakt in einer Reihe von politischen Umwälzungen, an deren Ende der Zerfall der Sowjetunion stand. Die Ukraine hat sich bereits 1991 aus dem Staatenverbund herausgelöst. Die Frage nach der Orientierung in Richtung Europa oder Russland bestimmte lange das politische Geschehen. Nachdem im Zuge der viel beachteten sogenannten „Orangen Revolution“ im Jahr 2004 der westliche orientierte Wiktor Juschtschenko die Stichwahl um das Präsidentenamt gewonnen hatte, sind die Augen Europas auch wieder verstärkt auf die äußerst lebendige ukrainische Literaturszene gerichtet. Im deutschen Sprachraum hat sich vor allem der Suhrkamp Verlag um die Bekanntheit jüngerer Autoren wie Ljubko Deresch und Serhij Zhadan verdient gemacht. Eine Generation älter ist Juri Andruchowytsch, der heute als einer der wichtigsten Schriftsteller seines Landes gilt. Seine Romane und Essays liegen – ebenfalls bei Suhrkamp – nun schon zu einem guten Teil auf Deutsch vor.
Schreiben an einer Landkarte der Identität

Der Geburtsort Andruchowytsches auf einer Ansichtskarte der Jahrhundertwende (um 1900, damals noch Stanislawiw/Stanislau)
Die Lebensgeschichte von Juri Andruchowytsch ist eng verwoben mit der Geschichte der Ukraine seit den sechziger Jahren. Er wurde 1960 in Iwano-Frankiwsk geboren, einem in der Westukraine gelegenen Städtchen, das bis zum Ende des Ersten Weltkriegs zur österreichisch-ungarischen Monarchie gehörte und deren äußersten östlichen Ausläufer gebildet hatte. Aufgrund dieser historischen Konstellation ist Andruchowytschs Familiengeschichte gleichermaßen von ukrainisch-russischen und deutsch-österreichischen Anteilen geprägt, was zum zentralen Gegenstand seines Schreibens wurde.
Die Suche nach den familiären Wurzeln, Gedanken über die eigene Identität und mithin die geographische Verortung des eigenen Landes in einem Mitteleuropa, dessen West- und Ostgrenzen fließend sind, durchziehen thematisch das schriftstellerische Werk in verschiedenen Formen. Eindrucksvoll ist Andruchowytsch die Verschmelzung der Geographien in dem Roman Zwölf Ringe gelungen, in dem ein österreichischer Fotograf namens Karl-Joseph Zumbrunnen wieder und wieder in die postsowjetische Ukraine reist und von diesem chaotischen Land fasziniert ist. Von ähnlicher Erzählgewalt sind die Essaybände, teilweise zusammen mit dem polnischen Schriftstellerkollegen Andrzej Stasiuk verfasst, in welchen Expeditionen in die Ruinen der ukrainischen Landschaft sich mit Geschichten aus der Väter- und Großväter-Generation zu einem wundersamen Erzählfluss ergänzen.
Ein Interview mit sich selbst – der Roman Geheimnis
Aber auch ein großer Fabulierer hat einmal klein angefangen. Um noch weiter zurück zu gehen als zu den politischen achtziger Jahren, in denen Andruchowytsch als Lyriker reüssierte und zeitweilig mit Band auftrat, sind es die Erlebnisse einer Kindheit zwischen Lemberg und Prag, die ebenso eine wichtige Rolle spielen. Und da setzt Geheimnis an, und ist doch alles andere als eine gerade herunter erzählte Autobiographie. Bevor der Erzählvorgang einsetzt, erklärt der Autor in seinem Vorwort, das in seinem Spiel zwischen Realität und Fiktion an Ingo Schulzes Neue Leben erinnert, dass der Leser gar keinen Roman zu erwarten habe. Vielmehr sei dem zur Zeit der Niederschrift als Stipendiat des Berliner Wissenschaftskollegs in Berlin lebenden Andruchowytsch ein Journalist mit dem Namen Egon Alt (spätestens hier horcht der genaue Leser auf, handelt es sich doch um nichts anderes als ein Wortspiel mit dem lateinischen alter ego) begegnet, der ihm auf Anhieb so sympathisch war, dass er es ihm gewährte, ein auf sieben Tage angelegtes Großinterview zu führen, in dem er ausführlich Gelegenheit haben würde, über sein Leben Auskunft zu geben. Der nun folgende Text gibt sich folglich als Abschrift der Tonbandaufnahmen von Egon Alt aus, der in einer tragischen Schlusswendung die Fertigstellung des Buches nicht mehr miterleben kann, da er in einem Autounfall sein fiktives Leben ausgehaucht hat. Der schöne Effekt des Kunstgriffs einer inszenierten Interviewsituation ist ein sich immer wieder durch nachhakende Fragen unterbrechender Erzählfluss, der dem allzuoft hemmungslos plaudernden Gegenüber die Richtung weist, nachbohrt, wenn er nicht zufrieden ist, und ihn auch vor manch argen Abschweifungen bewahrt. Geheimnis ist also formal ein auf 380 Seiten ausgebreitetes Interview. Tatsächlich hat aber Juri Andruchowytsch hier im Zwiegespräch mit sich selbst eine reizvolle Erzählform gefunden, die dem schriftstellerischen Narzissmus Rechnung trägt, es aber andererseits auch dem Leser leicht macht, der oft verwirrenden Handlung zu folgen, während die Kapitelschnitte im Tagesrhythmus den Stoff in sehr ökonomischer Form gliedern.
Familiengeschichte in einem wechselvollen Zeitenlauf
Wer Andruchowytschs verschlungener Autobiografie folgt, erfährt Wunderliches über das alte Lemberg und den Sehnsuchtsort Prag, an den ihn schicksalhafte Familienreisen führten. Natürlich ist Geheimnis auch eine Familiengeschichte: Der Vater, ein Förster von Beruf, teilt die literarische Begeisterung des Sohnes, hält ihn aber wiederum von zu argen Versuchungen wie Boccaccios Decamerone ab; die Mutter hört an jedem Sonntag das Wunschkonzert aus Lemberg auf Mittelwelle. Am ehesten aber ist die paradoxe ukrainische Existenz in der Großmutter Irena personifiziert, die alle Regimewechsel in ihrer Heimat erlebt hat: von Österreich, der Westukrainischen Volksrepublik über Polen und die Sowjetunion:
Meine Oma, das ist ein phantastischer Spagat über den Fluß der Zeit. Am einen Ufer – Daguerrotypie, Franz Ferdinand, Stummfilm und Shimmy, am anderen – Kosmonauten, Mao Tse-Tung, Zentralfernsehen und der Tod Gagarins, den sie bitter beweinte.
Über die Trunkenheit als Weltzustand

Der Moskauer Lubjanka-Platz Anfang des 20. Jahrhunderts (Ansichtskarte, um 1910)
Aber Geheimnis ist nicht nur Autobiographie und Familienroman, sondern auch eine große Erzählung über die Trunkenheit als Weltzustand: in der Armeezeit, die sich hauptsächlich durch Abwesenheit jeglicher fleischlichen Genüsse auszeichnet, ist der „Stoff“ die einzige Substanz zum Überleben. Danach zieht sich wie ein roter Faden eine Alkoholspur durch Andruchowytschs Leben, so dass man als Leser fast schon dankbar für die Gewissheit ist, dass der Autor das alles überlebt hat. Im Studentenwohnheim in Lemberg und später in Moskau (worüber ausführlich in seinem frühen Roman Moscoviada nachzulesen ist) und auch auf der Erzählebene mit seinem „alter ego“ fließen Wodka und Bier in Strömen. Wie nahe sich die große, tragische Geschichte und der Alltag des Trinkens sind, bringt eine nur auf den ersten Blick lapidare Feststellung zum Jahr 1986, dem Jahr von Tschernobyl und der Perestroika, auf den Punkt, die man sich beim genaueren Hinschauen erst einmal auf der Zunge zergehen lassen muss: „Alles entwickelte sich immer katastrophaler. Im Sinne einer Wunderbaren Katastrophe natürlich. Erst haben sie den Alkohol verboten, dann ist Tschernobyl explodiert, und alles verbrannte.“
Der Nebelschleier, der sich über die Handlung legt, vermischt die gespenstische Wirklichkeit – etwa Breschnews Beerdigung, bei der der Sarg von grässlichem Lärm begleitet in die Grube polterte – mit fantasierten Anekdoten wie der Reise in einem musikalischen Kognakbus nach Freiburg, die durch eine humorlose ukrainische Grenzbeamtin abrupt unterbrochen wird. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und der ukrainischen Unabhängigkeit, die vor allem Reisefreiheit bedeutete, kehrt Andruchowytsch wieder zu seinen Ursprüngen zurück: hier liegen die schönsten Stellen von Geheimnis, eine freundschaftliche Wiederannäherung zwischen Vater und Sohn und die beginnende Reflexion über die eigene Herkunft in einem schwer zu definierenden Mitteleuropa, das zu beiden Teilen West und Ost ist. Vielleicht ist deshalb gerade das wiedervereinigte Berlin der richtige Schlusspunkt für diesen außergewöhnlichen Roman. Er endet in einer Ruine einer amerikanischen Abhörstation am Teufelssee in Berlin, wo sich die beiden Hauptfiguren Egon Alt und Juri Andruchowytsch nach einer Fahrt quer durch die Stadt wiederfinden und gemeinsam eine letzte Flasche Wein leeren. „Genug Geschichten für heute?“ – „Nur noch eine …“
Juri Andruchowytsch: Geheimnis. Sieben Tage mit Egon Alt. Aus dem Ukrainischen von Sabine Stöhr. Suhrkamp Verlag, 387 Seiten, 24,80 €
Dieser Beitrag erschien erstmals als Teil einer Serie zum 20. Jubiläums des Berliner Mauerfalls auf kritische-ausgabe.de