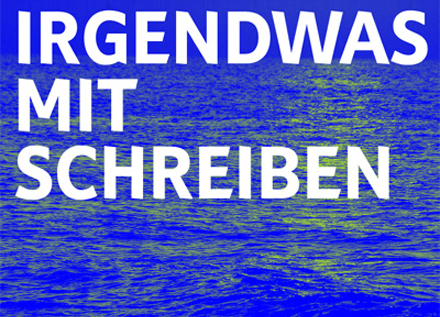David Foster Wallace Reader, erschienen bei Little, Brown & Co.
Ein Gastbeitrag von Paul Brodowsky
Die Idee, dass im Namen und unter Hochhalten von „DFW“ eine Menge von jungshaftem Literaturdistinktionsquatsch betrieben wird, hat mich schon vor eineinhalb Jahren über amerikanische feministische Bloggerinnen erreicht – das konnte ich damals nachvollziehen und kann ich auch heute noch. Ähnlich wie beispielsweise Deirdre Coyle macht sich Frohmann für einen anderen Kanon, für Bücher von diversifizierteren, weiblicheren Schreibenden stark. Etwas daran ist tatsächlich überfällig, und Kritik an Lit-Bros würde ich immer teilen (z.B. auch in der Spielart von „Dirk“ in einem Text von Maren Kames).
Aber anders als bei Coyle, die sich mit Wallace differenziert auseinandersetzt und deren Einschätzungen ich nachvollziehen kann (wenngleich ich sie nicht alle unterschreiben würde), gibt es bei Frohmann eigentlich keine Argumente gegen die Texte von Wallace außer dem einen, den Autor von dem Rezeptions- und Distinktionsverhalten seiner dümmsten Leser her zu bewerten. (In dem Sinne will ich sogar Murakami vor Frohmanns Lesart schützen, der so viel mehr kann, als nur schöne, einfache Sätze fürs „Team Muramaki“ schreiben.)
Das anderthalbte, mit dem ersten verwandte Argument, Wallaces Sätze seien zu kompliziert, weil sie Leser und Leserinnen außen vor halten, finde ich eigentlich noch ärgerlicher: Aufgabe von Literatur (oder Kunst) ist meiner Meinung nach nicht, zugänglich zu sein. (Eine Autorin/ein Autor kann sich selbstredend für Zugänglichkeit entscheiden, das Gegenteil muss aber auch immer möglich sein, zumindest dann, wenn die komplexe Form den Gegenstand adäquat abbildet, was ich bei David Foster Wallace durchgängig so beschreiben würde.) Ich glaube an Literatur als Herausforderung, nicht an Texte, die uns seicht beschallen.
David Foster Wallace hat zu kurz gedacht, er hat nicht bedacht, dass man primär nicht denken, sondern umsehen lernen muss. Nicht nur sich vorstellen lernen, dass etwas auch anders sein könnte, sondern dass man sich manches gar nicht vorstellen kann, weil man nicht gelernt hat, es wahrzunehmen.
Wallace vorzuhalten, er habe zu viel gedacht, streift für meine Begriffe schon das unfreiwillig Komische. Und der Vorwurf des unsensiblen, selbstbezogenen Autors führt bei David Foster Wallace fundamental am Gegenstand vorbei: Ich kenne wenige Schreibende der letzten hundert Jahre, die über mehr Empathie verfügen, (und zudem selbst-reflexiver und -kritischer vorgegangen sind). Freilich wird diese Empathie (gepaart mit einer modernen Oberflächenkälte) in jede Richtung funktionabel gemacht, auch für die auftretenden Sexisten, rassistischen Arschlöcher, idiotischen Präsidenten etc. Aus dieser entlarvenden und immer auch dekonstruierten Rollenprosa in oberflächlicher Lesart dem Autor einen Strick drehen zu wollen finde ich mindestens unterkomplex. Empathie ist nicht nur der Glutkern von David Foster Wallaces Prosa, sondern auch sein erklärtes Programm (etwa in „This Is Water“).
Vor allem aber tappt Frohmann selbst in die Lit-Bro-Falle: Literaturkritik als Distinktion, in dem Fall unter Hochhalten von ein paar Ikonen feministischer Literatur. Don’t get me wrong: Ich finde auch, man sollte bei jeder Gelegenheit auf gute Autorinnen aufmerksam machen, sie werden leider immer noch viel zu wenig rezipiert. Klar kann man sich zehn Jahre nach dem Tod des Autors hinstellen und sagen: Von heute aus gesehen fehlen mir da ein paar eindeutig feministische Markierungen in dem Werk von David Foster Wallace. Aber drive-by-Kritik nach Oberflächenmarkern und wechselseitiges Sich-Abklatschen unter diskursiv Einverstandenen anstelle von Auseinandersetzung finde ich wenig hilfreich.
Paul Brodowsky wurde 1980 in Kiel geboren. Sein Erzählband Die blinde Fotografin erschien 2007 im Suhrkamp Verlag. Neben Prosa schreibt er auch Theaterstücke, zuletzt waren Regen in Neukölln an der Berliner Schaubühne und Intensivtäter am Theater Freiburg zu sehen.