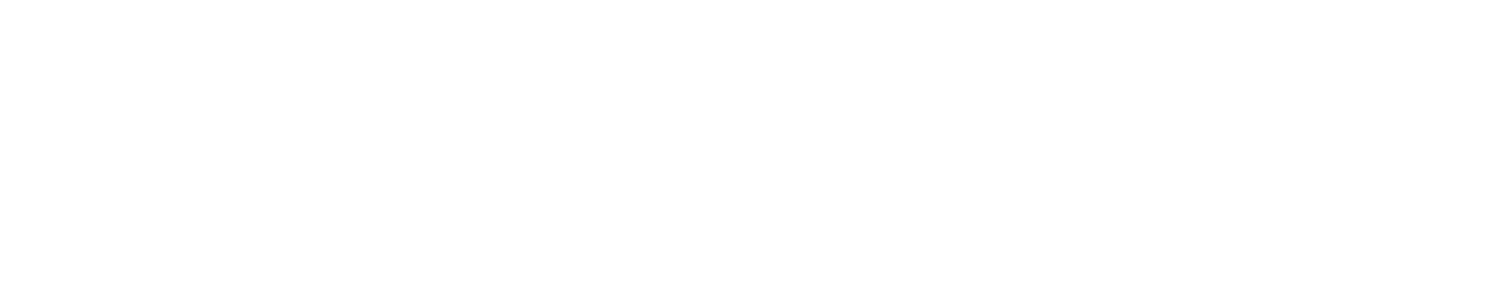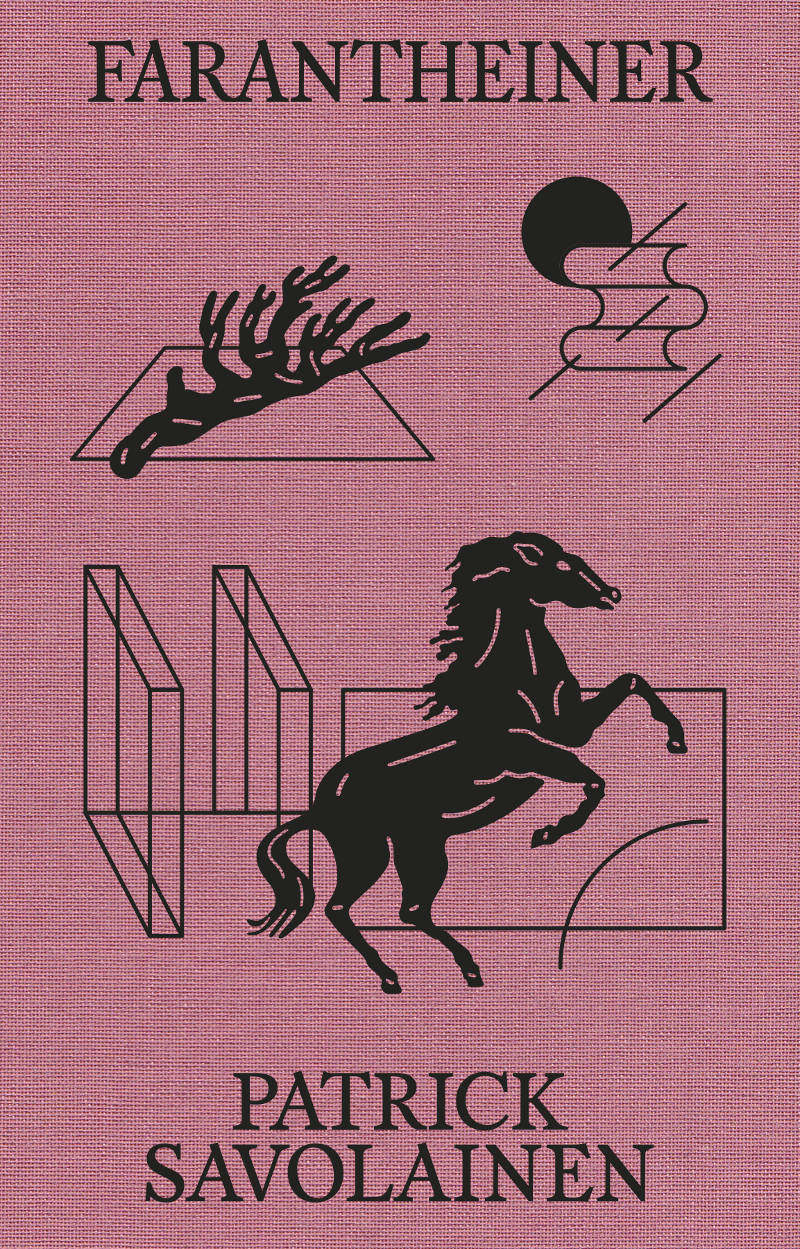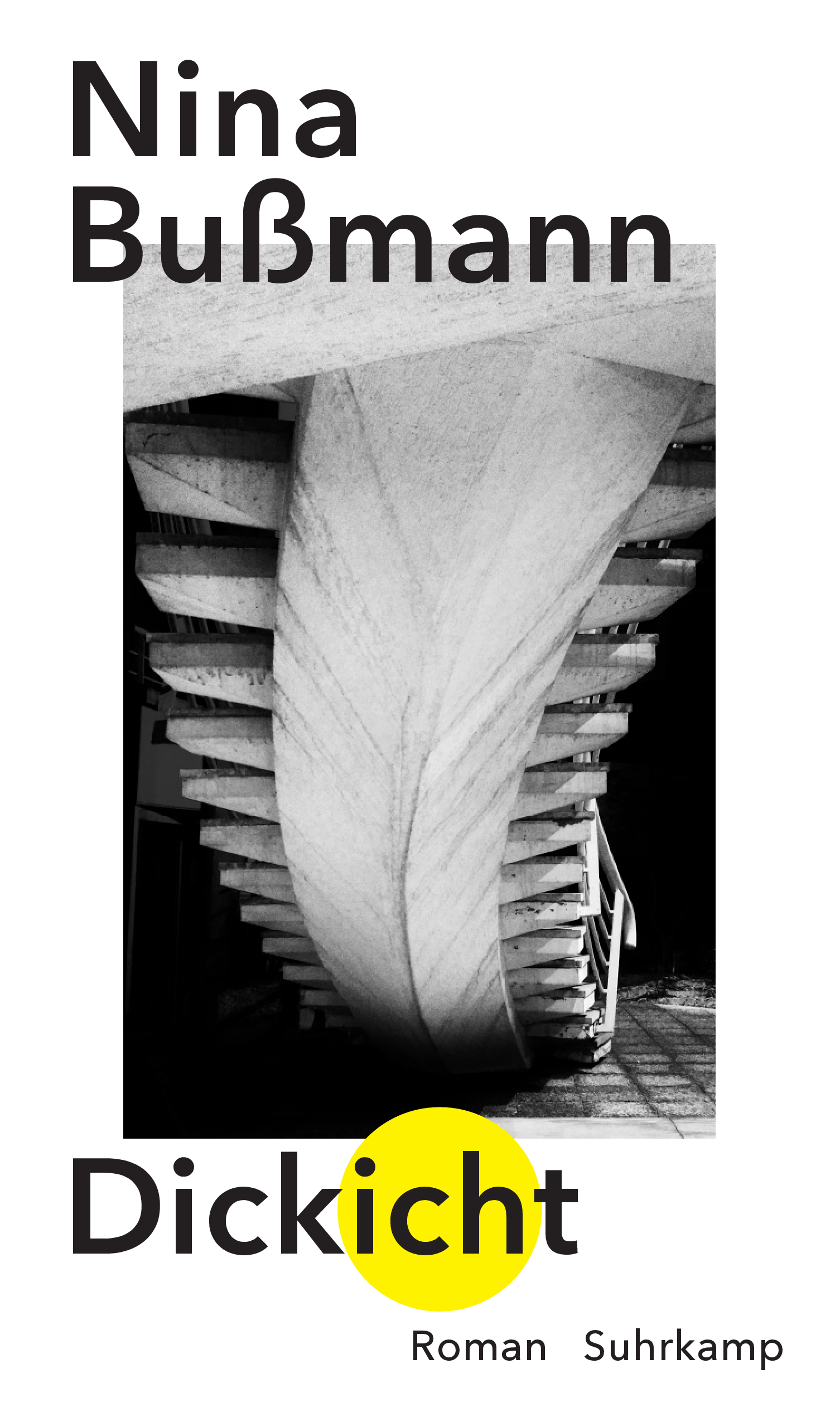
Menschen in der Großstadt: In ihrem neuen Roman lässt Nina Bußmann die Lebensentwürfe von drei Menschen aufeinanderprallen. Ein komplexer Entwurf über moderne Beziehungsgeflechte – und darüber, was diese eigentlich motiviert.
Nach „Große Ferien“, einem Ein-Personen-Kammerspiel über einen suspendierten Lehrer, und „Der Erde der Mantel ist heiß und geschmolzen“, der Geschichte einer ungleichen Frauenfreundschaft zwischen Deutschland und Nicaragua ist „Dickicht“, der dritte Roman, Nina Bußmanns bislang komplexester: Drei Figuren, Ruth, Max und Katja, deren Geschichten umeinander kreisen, die aber auch für sich alles andere als einfach sind, stehen im Mittelpunkt. Es ist auch Nina Bußmanns erster Berlin-Roman: Ein politische Aktionsbündnis für Mieterrechte spielt eine Rolle, die Stadt mit ihrem hektischen Zentrum und dem eintönigen Randgebiet, eine Stadt, in der jeder seine „Projekte“ verfolgt und doch prekäre Jobs an der Tagesordnung sind.
Ruth, um die fünfzig, Fleischbeschauerin und Tierschutzbeauftragte in einem mittelständischen Betrieb, der Dreh- und Angelpunkt der Geschichte, hat sowohl Kontakt zu Max als auch zu Katja. Als sie nach einem Unfall aus dem Krankenhaus entlassen wird, nimmt Katja sie bei sich auf. Ruth hatte schon davor den deutlich jüngeren Max kennen gelernt und mit ihm auch ein sexuelles Verhältnis. Sie ist Alkoholikerin: Das wird aus den im Erzählfluss nicht-chronologisch angeordneten und oft knapp gehaltenen Passagen klar. Sie hat ihre Arbeit aufgegeben, auch ihre Mietwohnung musste sie verlassen und in ein anonymes Apartment am Rand der Stadt ziehen. Ihre Familiengeschichte und die Gründe für ihr von Dritten oft als schroff und einzelgängerisch beschriebenes Verhalten bleiben im Dunkeln – ganz anders als es bei Max und Katja, der Fall ist, deren Lebensverhältnisse und emotionale Verfasstheiten sehr deutlich ausgeleuchtet werden: Max hat sein Studium und auch seinen Job als Fahrer für einen Lieferservice geschmissen, um Kindergärtner zu werden; er hat eine Schwester, Edna, die ihn in Berlin besuchen kommt, er wohnt in einer WG, die er aber plant, zu verlassen, und nimmt die Hilfe von einer Coachin, angesiedelt irgendwo zwischen Self-Help-Guru und Telefon-Abzocke in Anspruch. Katja dagegen ist gerade in ihr neues Projekt gestartet, das Jobcenter-Kunden helfen soll, ihren Lebenslauf zu ordnen und gut vorbereitet in einen neuen Karriereabschnitt zu starten; sie ist, zumindest für einen Teil des Romans, mit Milan zusammen, einem Anwalt, der an einem Erschöpfungssyndrom leidet, und auch sie hat mit gesundheitlichen Problemen, zu kämpfen, die sich durch fortschreitenden Haarausfall äußern.
Das Spannungsverhältnis zwischen den Parteien Max-Ruth und Katja-Ruth ist jeweils dasselbe: Sowohl Max als auch Katja sind „Kümmerer“, wollen Problemlöser sein, die Ruth ihre Hilfe anbieten, die aber ihrerseits Züge einer toxischen Persönlichkeit trägt: Sie nimmt die Hilfe an, gibt aber selbst wenig zurück.
Statt einem typischen Großstadtroman über die Einsamkeit vereinzelter Existenzen legt Nina Bußmann hier einen komplexen Entwurf über die vielschichtigen Beziehungen ganz unterschiedlicher Figuren vor, die niemals holzschnittartig typologisiert daherkommen. Vielmehr wird der Hintergrund ihres Handeln erzählerisch höchst detailliert ausgestaltet – bisweilen hat man das Gefühl, es hier nicht mit einem, sondern zwei oder drei Romanen in einem zu tun. Das Missverhältnis zwischen den ausführlich geschilderten Biografien Katjas und Max‘ und der nur angerissenen Lebensgeschichte Ruths erstaunt zunächst, ist aber womöglich auch eine Fährte zum Verständnis des Anliegens, das dieser Roman hat: Braucht es immer eine große Geschichte, um die Motivationen einer Person zu verstehen, oder ist ihr Handeln auch aus dem Moment zu begreifen? Um Antworten auf diese Fragen zu finden, sollte man diesen Roman lesen.
Ich gehe durchs Gestrüpp

Von Lotto- und Zuckerkönigen, quer durch Europa und seine ehemaligen Kolonien: In Aus der Zuckerfabrik öffnet Dorothee Elmiger die Türen ihrer Werkstatt – und betritt selbst neues Terrain.
Man kann dieses Buch an jeder beliebigen Stelle aufschlagen und wird sofort in seinen Bann gezogen. Schnell fügt sich Gelesenes, Gesehenes und selbst Erlebtes mit der Zeit zusammen: Die Geschichte des ersten Lottomillionärs der Schweiz Werner Bruni, der sein Geld ebenso schnell, wie er es gewann, wieder verlor, der Anbau von Zuckerrohr auf Haiti mit all seinen kolonialistisch-kapitalistischen Implikationen, ein Bericht über die erste Anorexie-Patientin Ellen West, den Balletttänzer Vaslav Nijinsky, Heinrich von Kleists und Henriette Vogels Doppelselbstmord am Wannsee, Kleists Erzählung „Die Verlobung in St. Domingo“ – von wo es wieder zurück nach Haiti und die Geschichte des blutigen Sklavenaufstands geht. Geld, Gier und Begehren sind die Leitmotive; die Form ist disparat: Tagebuchaufzeichungen und kurze Prosaentwürfe wechseln sich ab mit der Wiedergabe von Gesprächsfetzen – und Selbstzweifeln:
Es wird mir alles zuviel. Wo ich doch am Anfang dachte, ich müsse alles irgendwie zusammenklauben, zusammentragen, drängen sich mir die Dinge nun geradezu auf, ich sehe überall Zeichen und Zusammenhänge, als hätte ich eine Theorie von allem gefunden, was natürlich kompletter Unsinn ist.
Die titelgebende Zuckerfabrik ist nichts anderes als die Werkstatt von Dorothee Elmiger, deren Türen sich hier weit öffnen. Neben einer imposanten Menge an Material – der Aufzählung von oben wären noch hinzuzufügen die Geschichte der Teresa von Ávila, frühe Studien über das berüchtigte Newgate-Gefängnis in London sowie die Autobiografie der peruanisch-französischen sozialistischen Schriftstellerin Flora Tristan, die nebenbei die Großmutter von Paul Gauguin war – wird auch das eigene Leben in Form von Kindheitserinnerungen, Liebesbeziehungen und surrealen Träumen thematisiert. Immer wieder wacht die Erzählerin „weit nach Mitternacht“ auf, tritt eine Wendeltreppe herab und findet sich im Elternhaus, in einem Motel an der amerikanischen Atlantikküste oder auf einer karibischen Insel wieder.

Dorothee Elmiger (Foto: Peter-Andreas Hassiepen)
Klassische Romane hat Dorothee Elmiger nie geschrieben. Doch hier, in ihrem dritten Buch, erreicht ihr Schreiben noch einmal eine neue Ebene: Den zahlreichen angerissenen Themen wird immer auch die eigene Person gegenübergestellt – wie man es aus den zahlreichen Beispielen autofiktionaler Texte aus den letzten Jahren kennt – und die Erwartung an weibliches Schreiben problematisiert:
Seit einer Weile behaupte sie Freunden gegenüber, sie arbeite an einem Buch über die Liebe, und in der Regel reagierten die Freunde lachend darauf, als hätte sie einen guten Witz gemacht, und auch sie selbst lache, wenn sie davon spreche. Sie habe sich bisher von diesen Dingen, der Liebe, dem Gefühl, dem Sex, ferngehalten, und diese Entscheidung habe ihr oft auf gewisse Weise zum Vorteil gereicht: Oft habe sie Lob dafür erhalten, dass das Spektrum ihrer sogenannten Themen sich nicht beschränke auf jene, die Frauen angeblich in der Mehrzahl bearbeiteten, sondern auch das Historisch-Politische oder Fragen und ein Vokabular der Technik mit einschließe. Als zeichne sich ihre Arbeit vor allem dadurch aus, dass sie die Kennzeichen einer als männlich verstandenen Literatur trage, obwohl sie aus der Hand einer Frau stamme – weil sie also, sagt sie lachend, trotz ihres Geschlechts zur Vernunft gekommen sei, der Larmoyanz der Frauen eine Absage erteilt und die Seiten gewechselt habe.
Die Zwischenstellung zwischen Journal, Materialsammlung und Prosaskizzen elektrisiert: Alles, sei es eine Liebesaffäre oder eine Zitat aus Susan Buck-Morss kulturwissenschaftlicher Untersuchung Hegel und Haiti, ist gleich wichtig und relevant für das eigene Schreiben; die Zusammenhänge entstehen oft erst mit dem Niederschreiben, dem Erfassen der gedanklichen Vorgänge und führen im besten Fall an einen ganz neuen Ort. Dorothee Elmiger auf diesen Wegen zu folgen, ist so erkenntnisreich wie spannend, so verstörend wie schön: „So ungefähr. Ich gehe durchs Gestrüpp. Es tschilpen auch einige Vögel. – Und dann? – Weiter nichts, es geht einfach immer weiter so.“
Dorothee Elmiger: Aus der Zuckerfabrik. Hanser Verlag, 272 Seiten, 23 €
Über der Stadt flog lustlos ein Helikopter
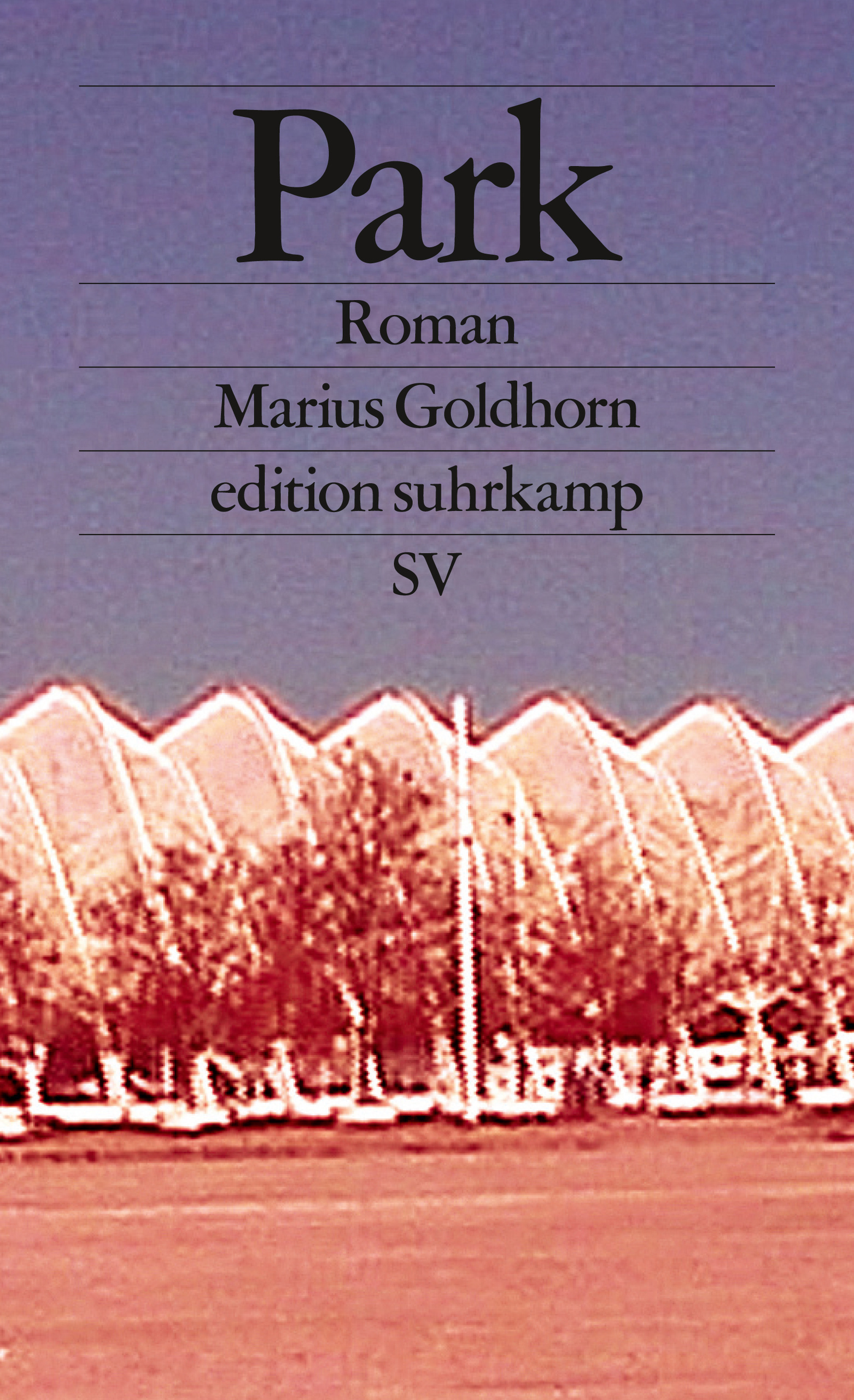
Ein Liebesroman mit Aliens: Marius Goldhorn entwirft ein beunruhigend zeitgenössisches Szenario zwischen Berlin, Paris und Athen.
Die Zeit der Lockdowns, Kontaktverbote und Quarantäne-Verordnungen, die die COVID19-Pandemie im Frühjahr 2020 mit sich gebracht hat, wird auch als eine Zeit der Fülle digitaler Veranstaltungsformate in Erinnerung bleiben, die aus der Not geschlossener Literaturhäuser und Theater geboren wurden. Und gerade Debütautorinnen und -autoren sind auf Lesungen angewiesen, um überhaupt eine Grundaufmerksamkeit zu bekommen.
Zu Marius Goldhorns Park gibt es aktuell immerhin schon zwei Streams: Eine Lesung für das Literaturforum im Brecht-Haus („Vorstellung meines MacBooks, des Romans Park und anderem“) sowie „Die große Beunruhigung“ bei den Kammerspielen München zusammen mit Enis Maci, Mazlum Nergiz und Tanita Olbrich.
Arnold, ein junger Schriftsteller ist auf dem Weg nach Athen, um Odile wiederzusehen, die dort einen Film dreht. Mit ihr verbindet ihn eine etwa ein halbes Jahr andauernde Liebesbeziehung in Berlin, die abrupt abbrach, als sie, mit dem Ziel, ihrem Master an der Kunsthochschule zu machen, nach London zog. Arnolds Reise nach Athen führt über Paris, weil er von dort aus das günstigste Flugangebot erhalten hat, weswegen der dort noch etwa zwei Tage in einem Hostel verbringt.
Ein sensibler, bis an die Grenze des Hypochondrischen empfindsamer Charakter, macht sich Arnold fast unentwegt Gedanken und beobachtet sich selbst, wobei ihm iPhone und MacBook sowie zuweilen auch sein Chatpartner Veysel zur Seite stehen. Offenbar steckt er seit der Abreise Odiles in einer Lebenskrise, ist passiv, nachdenklich und verliert sich in surrealen Träumereien. Diese gipfeln in einer außerkörperlichen Erfahrung, die Arnold in seinem Hotelbett in Paris macht: Sein Körper erscheint ihm mit vielen dünnen Schläuchen besetzt, er trifft auf Aliens, die ihn (wie er glaubt, zu erkennen) „ihre Sprache lehren“ wollen; vor seinen Augen verästeln sich fraktale Strukturen.
Diese eigentümliche Figur, die Marius Goldhorn auf ihre Reise durch Europa schickt, zeichnet sich durch eine gewisse Abgekapseltheit von der Welt aus. Gleichzeitig ist Arnold aber, mehr unbewusst als bewusst, mittendrin im politischen Zeitgeschehen: Schon während seines Aufenthalts in Paris wird er über das Fernsehen Zeuge eines Attentats; später, angekommen bei Odile in Athen, gerät er mitten in die Unruhen im Autonomen-Viertel Exarchia in Athen, wird sogar von der Polizei aufgegriffen.
Spannend an der Konstruktion von Park ist die Art, wie Goldhorn seinen Protagonisten an der Wirklichkeit teilhaben lässt, dieser sich aber gleichzeitig in seiner eigenen, von YouTube-Videos, Games und Popkultur-Referenzen – bevorzugt japanischer Instrumental-Musik – geprägten artifiziellen Wirklichkeit bewegt. Die klare, einfach gehaltene Sprache, in der er selbst die aberwitzigsten Szenarien beschreibt, resultiert in einer bizarren Schönheit.
Draußen, über der Stadt flog lustlos ein Helikopter. Arnold dachte: Die Luft ist sauer und warm und schwer von Abgasen. Menschen telefonierten oder verkauften irgendwelche Plastiksachen am Straßenrand. Häuser lagen unter halbtransparenten Gerüstplanen. Arnold beobachtete eine Gruppe Männer. Sie standen vor Stapeln Rubellosen auf mobilen Holztischen, die von Fahrradspannern zusammengehalten wurden. Arnold dachte: Seitdem die Welt untergeht, sieht alles besser aus.
Die Verbindung beider Welten – der realen und der artifiziellen – gelingt Arnold am Ende des Romans: Während in Athen ein Stromausfall nach einem Unwetter das öffentliche Leben lahmlegt, erstellt er auf seinem MacBook eine neue Homepage und lädt dort alle Gedichte hoch, die er im Verlauf des Romans geschrieben hat. Sie ist abrufbar unter romcompoems.com.
Marius Goldhorn: Park. Edition Suhrkamp, 140 Seiten, 14 €
Noch ein Hinweis: Dieser Titel erscheint aufgrund der Coronakrise zunächst nur digital. Das gedruckte Buch ist ab dem 15. Juni regulär im Buchhandel erhältlich – dann am besten lokal kaufen über buchhandlung-finden.de!
Zerschlagt die Moleküle!
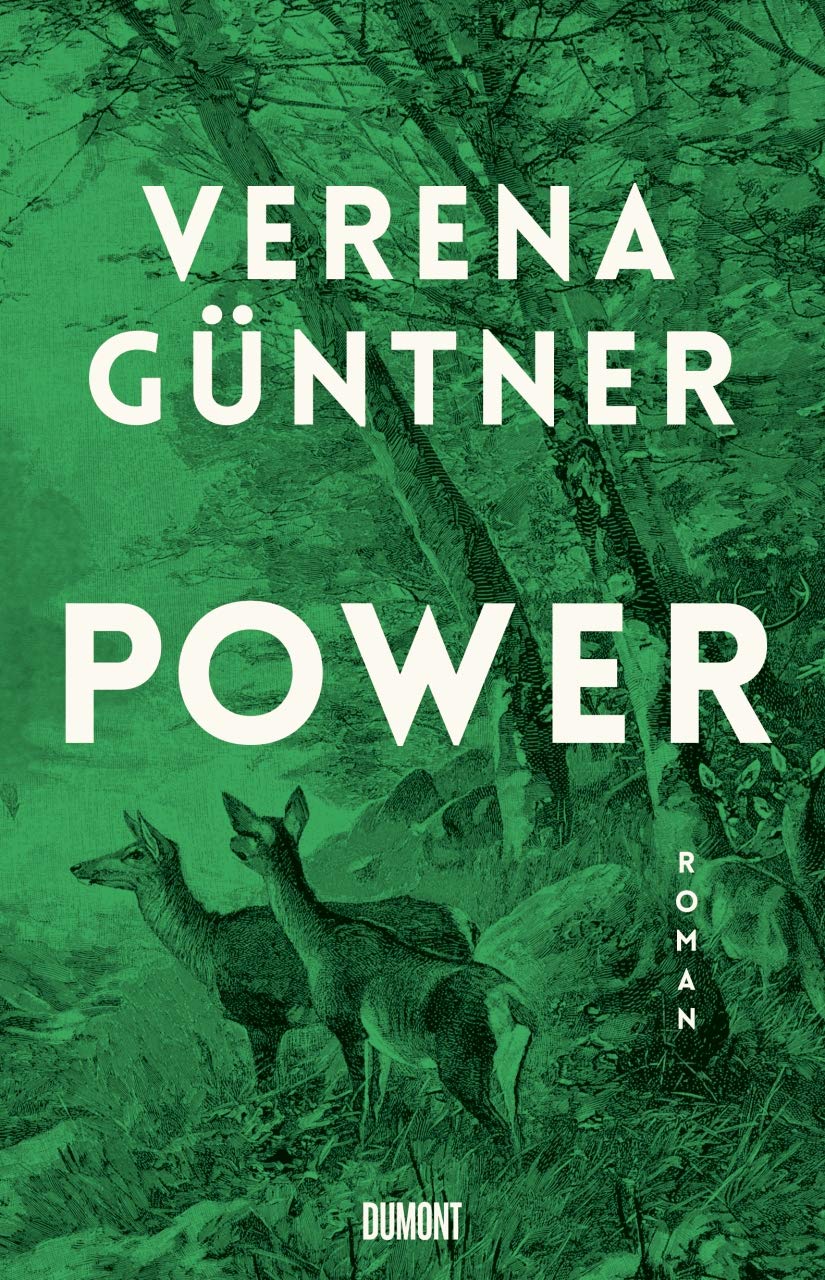
Tatsächlich werden die Spuren, das hier etwas ganz gehörig aus den Fugen gerät, schon recht früh gelegt: Warum steht in der Eröffnungsszene ein Mädchen mit zerrissener Kleidung, zerzausten Haar und einem Bündel Zweige in der Hand vor einem Kaufhaus? Klären wird sich das erst ein ganzes Stück später im Buch. Erst geht es zeitlich ein paar Wochen zurück: Hilde Hitschkes Hund Power ist verschwunden. Sie beauftragt die junge Kerze damit, ihn wiederzufinden, die sofort mit der Suche loslegt. In dem kleinen Dorf, in dem Verena Güntners neuer Roman spielt, scheint das eigentlich eine leichte Aufgabe. Doch es wird sieben Wochen dauern, bis Power wieder auftaucht. Und in denen wird so ziemlich jegliche Ordnung in der kleinen Dorfgemeinschaft auf den Kopf gestellt werden. Zum einen durch Kerzes rigorose Ermittlungsarbeit, die schnell die Aufmerksamkeit weiterer Kinder auf sich zieht, die sich ihr anschließen. Zum anderen durch den ohnehin schon fragilen Zusammenhalt der Gemeinschaft, die durch Suchaktion, die schnell das beherrschende Thema der gerade beginnenden Sommerferien werden, vollends zerfällt. Kerze, die sich alle ihre Beobachtungen fein säuberlich in ein vorbereitetes DIN-A-5-Heft notiert, entwickelt zunehmend eigenwilligere Methoden, um den verschwunden Power wiederzufinden: Sie, und nach und nach auch die anderen Kinder des Dorfes, beginnen sich selbst wie Hunde zu verhalten, bellen, laufen auf allen Vieren, lehnen das Essen mit Messer und Gabel am Tisch ab. Der Höhepunkt ist erreicht, als die Kinder des Dorfes, als sie eigentlich schon kurz vor dem Aufgeben stehen, in einem letzten Kraftakt beschließen, gemeinsam in den Wald zu ziehen und sich dort als Rudel neu zu organisieren.
Treibend für diese Bewegung ist die charismatische und willensstarke Kerze (sie hat sich den Namen übrigens selbst gegeben), elf Jahre alt und fest entschlossen, ihren Auftrag zu Ende zu führen. Dabei geht sie beeindruckend souverän, aber auch mit einer mitunter grausamen Unerbittlichkeit als Anführerin vor:
Stumm, die Zähne aufeinandergepresst, treibt sie die Gruppe vorwärts und führt sie tiefer und tiefer in den Wald hinein. Denn sie weiß, es wird besser werden. Sie werden sich an die Schmerzen gewöhnen, bis sie auf ein erträgliches Maß schrumpfen und schließlich ganz vergehen. Nichts bleibt so schlimm, wie es am Anfang scheint, das weiß sie, das hat sie erlebt. Es gibt keinen unbesiegbaren Gegner. Die Grenzen sind durchlässig, immer.
„Zerschlagt die Moleküle“, ruft Kerze am sechsten Tag, als alle nur noch wimmern.
„Ich kann nicht mehr“, jammert Flori.
„Doch, du kannst!“
Daneben stellen mehrere Nebenhandlungen die zurückgebliebenen Bewohner des Dorfes näher vor, durch die mit der Zeit ein immer deutlicherer Riss geht: Auf der einen Seite steht Hilde Hitschke (oder einfach nur: „die Hitschke“, um in der Sprache des Romans zu bleiben), deren Welt langsam zerbricht, weil nach ihrem Mann Karl, der sie vor sechs Jahren verlassen hat, nun auch noch ihr Hund verschwunden ist; auf der anderen Seite steht der Sohn des Großbauern Huber („der Hubersohn“), ein zarter junger Mann, der so gar nicht für das Landleben gemacht ist, aber dafür um so mehr den starken Macher hervorkehren will und eine Bürgerwehr auf die Beine stellt, die dafür sorgen soll, dass die Kinder wieder zurückkehren.
Verena Güntner erzählt diese Geschichte, die sich mit der Zeit immer mehr auf einen düsten Showdown hinzubewegen droht, in einer mitreißend direkten Sprache, am Sound ihres Debüts Es bringen geschult, in dem sie sich gekonnt den Blickwinkel eines großspurig auftretenden Teenagers angeeignet hat. Gleichzeitig wirkt diese aus den Fugen geratende Abenteuergeschichte wie eine Parabel, die entschlossen mit gesellschaftlichen Phänomenen wie Verrohung, Zusammenbruch der Kommunikation und dem Zerbrechen von Zusammenhalt abrechnet.
Verena Güntner: Power. DuMont Buchverlag, 254 Seiten, 22 €
Verena Güntner ist zusammen mit Maren Kames, Leif Randt, Ingo Schulze und Lutz Seiler für den Preis der Leipziger Buchmesse 2020 in der Kategorie Belletristik nominiert. Die Preisverleihung findet am 12. März im Rahmen der Leipziger Buchmesse statt.
I used to be a lunatic


Maren Kames holt in ihrem neuen Buch zur ganz großen Geste aus: Luna Luna führt mitten hinein in die Mondlandschaften der Liebe – und des Krieges.
Weiß auf schwarz, umgeben von einem pinken Vorsatzpapier, präsentiert sich hier ein Text, der Monolog, Klagerede und Sprachperformance miteinander verbindet. Es geht um Trauer, Wut, gleichzeitig ist der Redefluss hoch reflektiert und findet immer wieder zu einer ironischen Distanz. Das zeigt sich in den Brechungen, in denen sich die Sprecherin selbst aufs Korn nimmt („warum bin ich so zerzaust? warum rauch ich so oft?“); das zeigt sich aber auch in der so heterogenen Textgestalt, in der Maren Kames ein ganzes Repertoire an Songreferenzen untergebacht hat und so auch einen Teil ihrer Poetik offenlegt: Wortwörtliche Übersetzungen, frei Assoziiertes und miteinander Montiertes lassen Luna Luna zu einem komplexen Gewebe werden, das mit einem großen musikalischen Gespür zusammengesetzt ist. Der Wahrhaftigkeit tut das alles keinen Abbruch: Auch in den ironischen Momenten, und gerade in der unbekümmerten Art, wie dieser Text bereit ist, seine Gemachtheit auszustellen, liegt eine schonungslose Ehrlichkeit, die die große Qualität von Maren Kames’ Schreiben ausmacht.
Es beginnt, drastisch, „scheiße und eiskaltz“, mit einer Trauer- oder auch Wutrede über einen schmerzlichen Verlust („ich bin circa in der mitte entzwei gebrochen/und nicht wieder heilgeworden“), und der Anrufung der Mutter, die ihr „mödchen“ (sic!) vermisst; um die Ecke lugt ein Sheitan. Dann folgt der Mittelteil „krieg“, eine Art Totentanz, oder zumindest nahe dran, in dem Körperlichkeit, Wahnsinn und Gewalt sich ihre Bahn brechen. Körper werden „zu Gold gedrillt“, ein Tyrann verschanzt sich mit Basecap im Schützengraben und verliebt sich in einen Soldaten, mit dem er zusammen kitschige Liebeslieder zum Besten gibt. Eine unwirkliche Szenerie entfaltet sich hier, in der weniger der Krieg selbst als die fatalen Auswirkungen auf die mentalen Zustände der in ihm verstrickten Akteure Thema sind. Wieder zurück vom Schlachtfeld, im dritten Teil, stößt, in einer freien Variation auf den Songtext von Lapsleys „Station“, neues Personal dazu: Eine Geisha und der Sheitan vom Anfang, der sich als „eine art dämon“, als böser Gegenspieler, das negative Prinzip an sich entpuppt:
die
gähnend klaffende,
von oben herab lachende
ableitung aus allem vermeintlich zu ende gedachten, ein zwang, die angst, die leiter abwärts, ein spross von moder, und gleitend, hinterrücks: ein laut posaunender gauner, aus dem aus klau entstandener bummer, perfide perücke, filzig, verflixt, zugleich der kamm gegen den strich, das aber! aus allen verteufelten ecken und die steigerung von ewig.
wenn’s die gäbe.
eine schimäre.
Es ist ein kurzes Innehalten, ein Moment des Zögerns zwischen sich Ergeben, Zurückziehen und Weitermachen, der den dritten Teil ausmacht, bevor Luna Luna in einer zauberhaften Wendung – „hokus pokus“ – zum großen Finale ansetzt: „In meinen gloriöseren Tagen bin ich ziemlich lunar gewesen“ hieß es am Anfang – jetzt fällt der Mond in einer fantastischen Wendung des Geschehens selbst vom Himmel, die Geisha fährt auf einem Boot davon, zusammen mit Annie Lennox, die eine Schliere von pinkfarbenem Make-up hinter sich herzieht. Schöner, tröstlicher und hoffnungsvoller könnte man sich ein Ende nicht ausmalen in einem Buch, das sich weit in die Extreme menschlicher Zustände vorwagt.
Anhören kann man sich diesen vielstimmigen Text übrigens auch als Hörspiel, das zeitgleich mit dem Erscheinen des Buches im Deutschlandfunk gesendet wurde und hier nachgehört werden kann. Und auf keinen Fall zu verpassen ist die Buchpremiere am 7. Oktober im Silent Green Kulturquartier in Berlin-Wedding.
Maren Kames: Luna Luna, Secession Verlag, 160 Seiten, 35 €
Buchpremiere am 7. Oktober um 20 Uhr, Silent Green Kulturquartier, Gerichtstr. 35, 13347 Berlin
Lauf, lauf, lauf!

Lisa Kränzler ist wieder da. Und wie! Im hyperrealistisch-expressionistischen Überschwang lässt sie mit ihrem vierten Roman Coming of Karlo alle literarischen Konventionen weit hinter sich.
Kurz zurückgeblickt: Nachdem sie bereits als Malerin in Erscheinung getreten war, veröffentlichte Lisa Kränzer 2012 ihren ersten Roman Export A über den traumatischen Kanada-Aufenthalt einer Austauschschülerin, las beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb und gewann den 3sat-Preis. Im Jahr darauf folgte der Roman Nachhinein, in dem die Freundschaft zweier Mädchen gewaltsam eskaliert. Noch ein Jahr später dann der dritte Roman Lichtfang, berührende Geschichte eines Wahns, den die Liebe nicht retten kann. Das künstlerische Schaffen Lisa Kränzlers äußerte sich wieder stärker in den beiden folgenden Bänden Manifest (mit Tomaso Carnetto) und dem als Katalog konzipierten Kränzler, Lisa, wo sich Text und Bild vereinten. Jetzt ist im Verbrecher Verlag Lisa Kränzlers neuer, vierter Roman Coming of Karlo erschienen. Mit über 600 Seiten ist es ihr bislang längster – und auch ihr avanciertester.
Ich laufe nicht, ich fliege – und für Momente ist alles, wie es sein soll: schwere- und beschwerdelos. Voll funktionstüchtige Freude, die rennt, was sie kann: Das bin ich. Der Verbund aus Knochen, Muskeln, Sehnen weiß schon, wohin, braucht keine Befehle, kennt meinen Willen und nimmt ihn, wie er ist: nervenfasernackt und vollkommen wortgewandlos, hat keinen Begriff aber Zugriff, schreitet zur Tat, wenn diese noch keinen Namen hat, verwirklicht das Unsagbare.
Lauf, lauf, lauf!
Wer weiß, was Laufen ist? Wer kann sagen, was er da tut und wie er es gelernt hat?
Nicht denken, Karlo! Nicht den natürlichen Ablauf durcheinanderbringen! Lass es machen, einfach machen, bevor – da setzt sie ein, die Erinnerung, und mit ihr das Bewusstsein, das mich in Schrecken setzt: Ich weiß, wo ich bin und was geschehen wird …
Lisa Kränzlers Sprache ist von einer Plastizität, wie man sie in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur kaum findet. Ohne falsche Bescheidenheit lässt sie ihre Figuren innere Monologe abspulen, geizt nicht mit Ausrufezeichen, Fragezeichen, Auslassungspunkten und eigenwilligen Adjektiv- und Substantivkonstruktionen, die sich aber alle in ein Großes und Ganzes fügen, das sich am ehesten vielleicht als expressionistischer Hyperrealismus beschreiben lässt. Hier ist jede Szene bis ins letzte Detail ausgeleuchtet, jede Emotion wird aufs Schärfste beschrieben – und auch das Geschehen treibt unaufhaltsam ins Extreme: Karlo, der triebgesteuerte Teenager, der sich nur ansatzweise unter Kontrolle hat, stellt seine Familiengeschichte in Frage, seinen – von einer Fußballverletzung außer Gefecht gesetzten – Körper auf eine Belastungsprobe nach der anderen, und seine Sexualität steht ihm wie ein riesiger Klotz im Weg.

Foto: Nane Diehl
Es fühlt sich an wie ein Rausch, diesen atemlos, in vielen kleinen Kapiteln, Unterkapiteln und Fußnoten erzählten Roman zu lesen. Wie Stoppschilder tauchen aus dem Nichts heraus schwarze Seiten auf, dann Beschleunigungsstreifen, gegen Ende wird es ganz wild, mit typografisch variierenden Dialogzeilen, Diablochromen, Märchenzeilen und schwarzer Magie.
Lisa Kränzler hat sich mit einem Paukenschlag zurückgemeldet. Coming of Karlo schlägt wie ein gefährlicher Komet in den Bücherfrühling ein.
Lisa Kränzler: Coming of Karlo. Verbrecher Verlag, 624 Seiten, 29 €
Buchpremiere am 14. April 2019 um 20 Uhr in der Fahimi Bar, Skalitzer Straße 133, 10999 Berlin
Mit dem Kleiderbügel im Abfluss der Welt

Ann Cotten hat mal wieder das Fach gewechselt: Mit Lyophilia erscheint im Suhrkamp Verlag der zweite Band mit Erzählungen der anarchischsten der deutschsprachigen Gegenwartsautorinnen.
Damit nicht genug, verzweigt sich das ohnehin schon auf eine beachtliche Größe angewachsene Werk Ann Cottens nun auch noch ein weiteres Mal. Im Wiener Sonderzahl Verlag sind zuletzt unter dem Titel Was geht? ihre Salzburger Poetikvorlesungen erschienen (The Daily Frown berichtete); davor das japanische Reisebuch Jikiketsugaki Tsurezuregusa bei Peter Engstler und Fast Dumm, amerikanische Reflexionen bei Starfruit Publications, englischsprachige Gedichte in der Broken Dimanche Press – Lather in Heaven – und natürlich das irre Versepos Verbannt!, das zuletzt im Hausverlag Suhrkamp verlegt wurde.
In Lyophilia nun geht es in das weitläufige Gebiet der Science-Fiction. Und herausgekommen ist dabei eine knallbunte Wundertüte: Von japanisch inspirierter Kürzestprosa bis zur hundertseitigen Novelle ist alles dabei. Es geht um außerirdische Sprachen, die buchstäblichen Untiefen von Wikileaks („Mit dem Kleiderbügel im Abfluss der Welt“), vermeintliche und wirkliche Geistererscheinungen am Kahlenberg in Wien („Nepomuk“), prekäre Arbeitswelten der Zukunft („Putztruppenweiseheiten“) und eine entlang des klassischen H.G.-Wells-Romans erzählte psychedelische Zeitreise im Prenzlauer Berg. Die Kernstücke bilden zwei jeweils weit über hundert Seiten lange Erzählungen, deren kleinster gemeinsamer Nenner möglicherweise die Liebe ist: „Proteus oder Die Häuser denen, die drin wohnen“ über eine Affäre, die sich über mehrere Paralleluniversen erstreckt und „Anekdoten vom Planeten Amore (Kafun)“, in der auch die titelgebende Lyophilisation zur Sprache kommt:
Wir patentierten einen Lyophilisator des Geistes, ein Konkurrenzprodukt zum Coder Kant der Uni Osaka, das unter dem Namen Hegelator zugleich als Treiber hinter einem der beliebtesten Rides im Philosophenpark wertvolle Konversationserfahrungen machte, Industriespionage nicht ausgeschlossen. Die Künstlichen fanden an den Denkweisen ihrer Menschen nostalgischen Geschmack, auch wenn sie es lästig und auch eklig fanden, dieses Denken andauernd in Feuchtform um sich zu haben. Vieles, was Psychologie, Philosophie und Literatur formuliert hatten, stellte sich auch nach der Erforschung der Muster als verblüffend treffend heraus, wie ja auch die Entdeckung des Periodensystems der Elemente das Kochen und sein Vokabular nicht wesentlich veränderte.
Alles klar? Was sich schon im schaudernden Fächer zeigte, wird hier bestätigt: Ann Cotten ist auch als Erzählerin nicht zu stoppen. Grandios verplaudert, mitunter auch nervtötend in ihrer Ausführlichkeit, sprudeln ihre Geschichten munter über die 463 Seiten, die Lyophilia umfasst. Dabei ist es nicht einmal klar, ob Lyophilia wirklich als Science-Fiction-Band verstanden werden kann: Wirken Erzählungen wie „Nepomuk“ und das kurze Dialekt-Stück „Tullner Creeks“, die durchaus Tagebuch-Charakter haben, nicht nah an der Realität? Nicht immer jedenfalls ist die Grenze zum Spekulativen klar zu ziehen.
Vielleicht hat sich die durchaus dem Blödeln nicht abgeneigte Autorin hier aufs Neue selbst übertroffen. Festgehalten werden kann zumindest das: Langweilig wird es uns mit Ann Cotten noch lange nicht werden.
Ann Cotten: Lyophilia. Erzählungen, Suhrkamp Verlag, 463 Seiten, 24 €
Rote Haare, wie angezündet
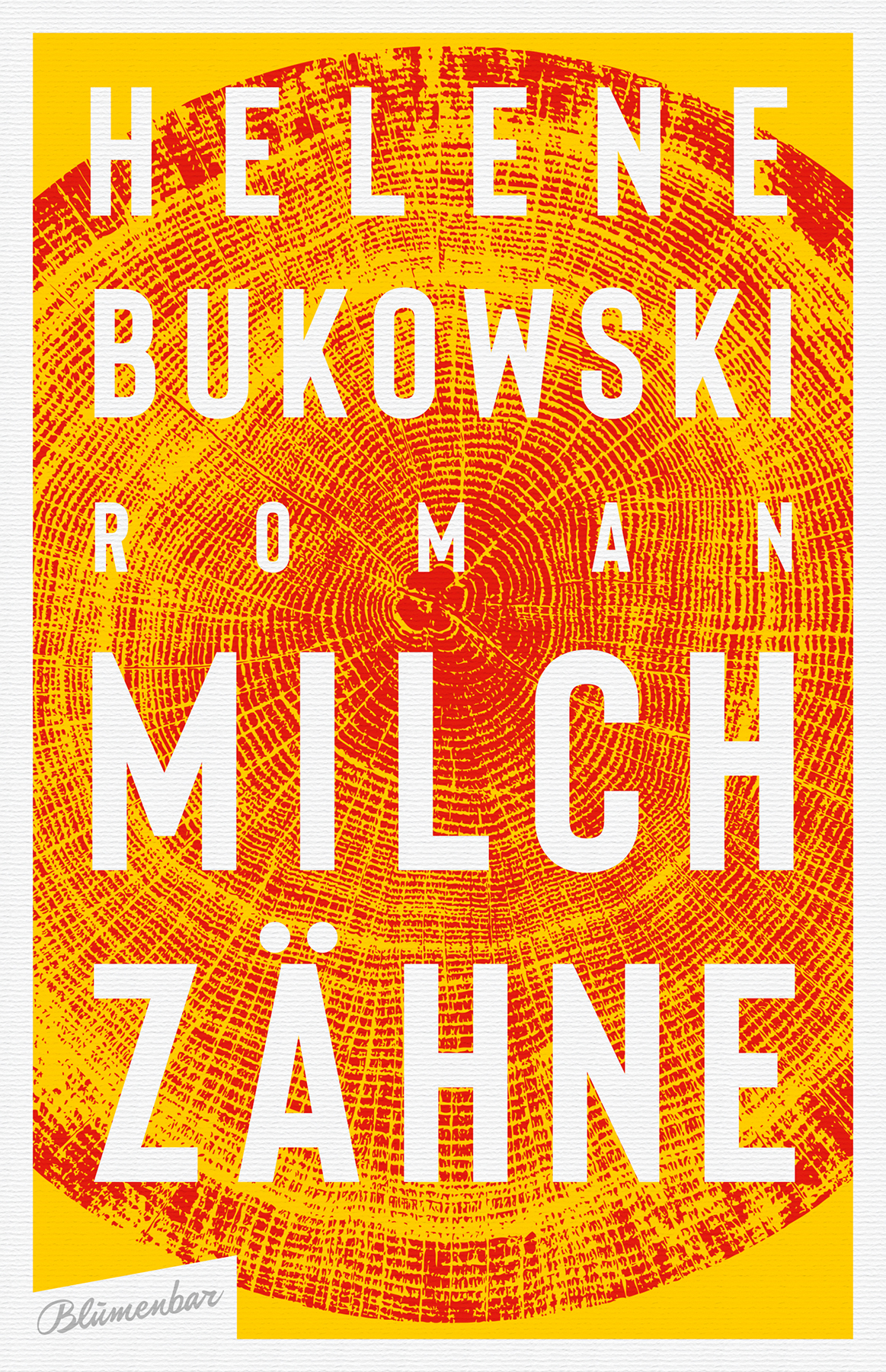
Der Schein trügt: In ihrem Debütroman Milchzähne erzählt Helene Bukowski vom Umschlagen einer Idylle in ihr brutales Gegenteil.
Nur wenige sind übrig geblieben, sie leben am Rand des „toten Gebiets“, ein reißender Fluss auf der anderen Seite begrenzt die Gegend, in der sie sich sicher fühlen. Die Brücke auf die andere Seite haben sie abgerissen.
So richtig klar wird nie, was der Auslöser für den Ausnahmeszustand war, in den die kleine Dorfgemeinschaft geraten ist, von der Helene Bukowski in ihrem ersten Roman erzählt. Fest steht: Die Ressourcen sind knapp geworden, man hat Vorräte angelegt und unterstützt sich gegenseitig durch Tauschgeschäfte.
Aus den Fugen gerät dieser Selbstversorger-Mikrokosmos durch ein Kind, das – „rote Haare, wie angezündet“ – vom einen auf den anderen Tag zu der Gemeinschaft stößt. Und mit einem Mal blitzt die Brüchigkeit des solidarischen Lebensmodells auf: Fremde sind nicht erwünscht, denn sie bringen alles durcheinander, so die Formel, so die Prämisse, um die dieser Roman kreist, während die Atmosphäre langsam bedrohlicher wird.
Denn bald stellt sich heraus, dass auch Skalde, die Erzählerin, die sich auf kleinen Notizzetteln ihre eigenen Gedanken zum Geschehen macht, und auch ihre Mutter Edith eigentlich Außenstehende, von außen Gekommene sind, die mit der Zeit zwar toleriert wurden, aber trotz allem doch nicht so richtig dazugehören. Die Grenzen der Toleranz sind erreicht, als erst Skalde, und dann auch Edith sich für den Verbleib des Kindes Meisis im Dorf einsetzen. Und als die zwei Töchter eines Dorfbewohners verschwinden, schlägt das Misstrauen in offene Feindseligkeit um.

Foto: Rabea Edel
Mit wenigen Strichen skizziert Helene Bukowski den Mikrokosmos einer Gesellschaft, die sich völlig von der Außenwelt abgekapselt hat und sich von allem, was von außen kommt, bedroht fühlt. Das „Zurück zur Natur“ wird zur faden Illusion, denn es geht einher mit Engstirnigkeit und Fremdenhass. Eine klassische Geschichte wird hier noch einmal ganz neu erzählt, sprachlich von einer nahezu biblischen Urwüchsigkeit. Die oft nur ganz kurzen Kapitel folgen dabei sich langsam zuziehenden Schlinge um Skalde, Meisis und Edith; gleichzeitig wird durch die „Notizzettel“ noch ein Text im Text mitgeliefert, in dem Skalde zaghaft Worte für die sie umgebende Welt zu finden versucht.
Vieles bleibt schließlich offen: So wie der Auslöser für den Ausnahmezustand der Dorfbewohner, bleiben auch die Chancen auf eine Flucht über das Meer, wie sie im Prolog beschrieben wird, unbestimmt. Wie Traum in Albtraum, Idylle in Bedrohung und Solidarität in Terror umschlagen können, führt dieser Roman hingegen beispielhaft vor.
Helene Bukowski: Milchzähne, Blumenbar Verlag, 256 Seiten, 20 €
Von Nähmaschinen und Wachspüppchen
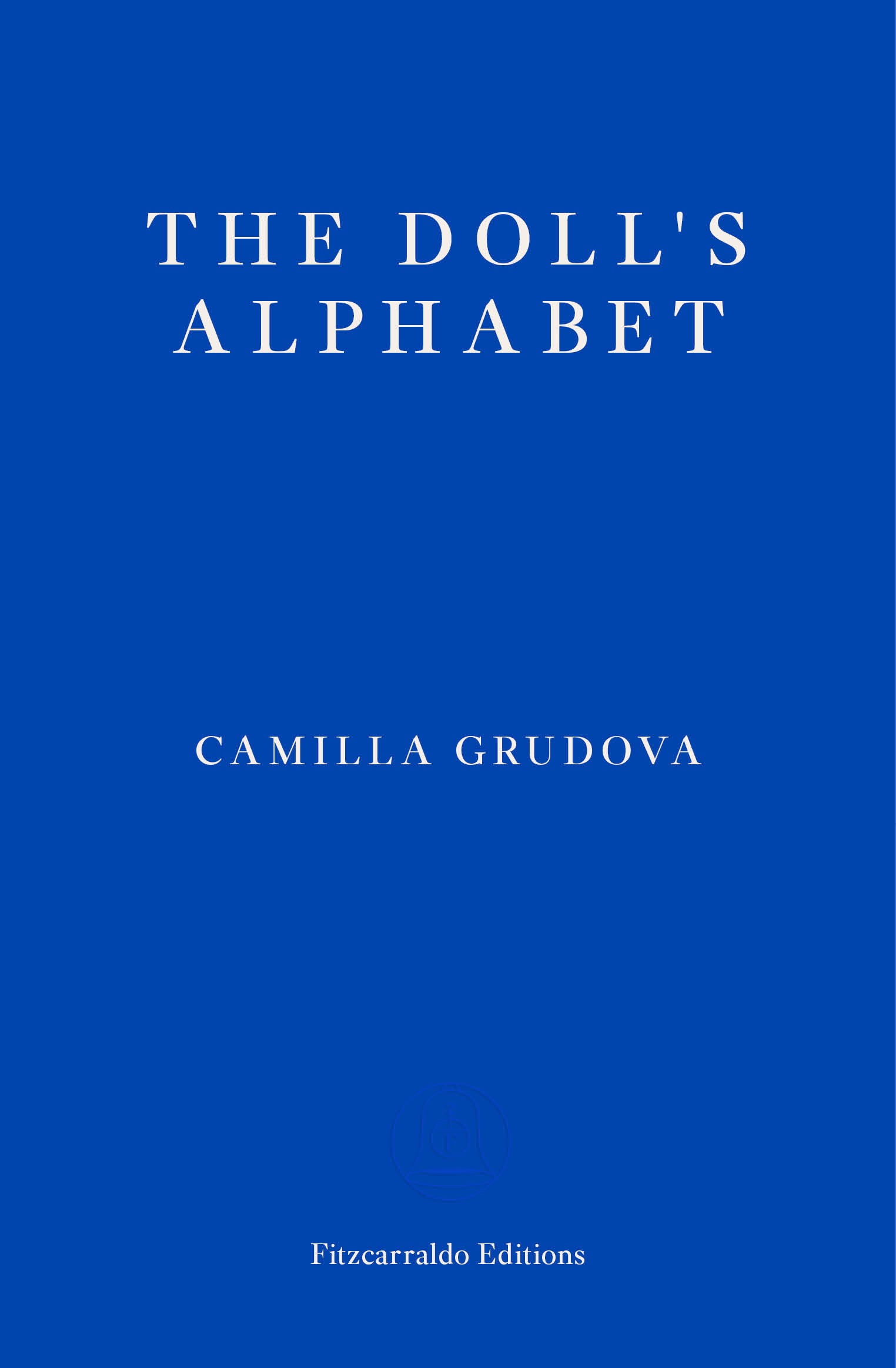
Nach der Veröffentlichung von zwei Kurzgeschichten in den Magazinen Granta und The White Review brachte der britische Independent-Verlag Fitzcarraldo Editions, der mit englischen Übersetzungen von Matthias Enard, Olga Tokarczuk und, ja, auch Rainald Goetz‘ Irre ein gut sortiertes internationales Programm pflegt, 2017 den Debütband The Doll’s Alphabet der in Toronto lebenden Autorin heraus, über die nicht viel mehr bekannt ist, als dass sie einen Abschluss in Kunstgeschichte und Germanistik hat.
Irgendwo zwischen düsteren Märchen und surrealer Dystopie mit einem Schuss feinem Humor liegen die dreizehn sehr unterschiedlich langen Erzählungen in diesem Buch: Ob es die Erlebnisse einer Frau sind, die beschließt, sich die Haut abzustreifen und auf einmal eine neue Freiheit fernab der Zwänge des äußeren Erscheinungsbilds genießt („Unstitching“) oder die Geschichte einer Welt, in der eine „Gothic Society“ Streetart in Form von Styropor-Wasserspeiern und Bleiglas-Verzierungen produziert – Camilla Grudova bedient sich stets des klassischen Effekts der fantastischen Literatur, genau ein Detail der Wirklichkeit zu verändern und diese Veränderung dann konsequent zu Ende zu denken. Die Besonderheit ist die dezidiert – und vielleicht entfernt vergleichbar mit Margaret Atwood – weibliche Perspektive, die sie dabei einnimmt. Am besten zeigt sich das in der längsten Geschichte des Bandes, „Waxy“, die ein düsteres Szenario schildert, in der Frauen hart in Nähmaschinen-Fabriken arbeiten, um ihre unselbstständigen Männer zu versorgen, die in regelmäßigen Abständen rätselhafte „Prüfungen“ absolvieren müssen. Das gesamte Zusammenleben von Mann und Frau ist auf Funktionalität ausgerichtet und von Gewalt geprängt, Lebensmittel sind rationiert, Gefühle haben keinen Platz.

„Waxy“ ist auf Deutsch, übersetzt von Rebecca DeWald, unter dem Titel „Wachspüppchen“ in der aktuellen Ausgabe der Edit erschienen. Die Geschichte „Unstitching“ kann man im Original bei Lemonhound nachlesen. Eine deutsche Übersetzung von The Doll’s Alphabet ist bislang noch nicht angekündigt. Vielleicht wird ja der eine oder andere Verlag im Rahmen des Kanada-Schwerpunkts der Frankfurter Buchmesse im nächsten Jahr hellhörig?
Camilla Grudova: The Doll’s Alphabet. Fitzcarraldo Editions, 192 Seiten, ca. 12 €
Erzählen, ohne zu erzählen
Patrick Savolainen legt mit Farantheiner ein Romandebüt vor, das geschickt die Lesererwartungen durchkreuzt.
Texte von Patrick Savolainen konnte man, wenn man Glück hatte und dabei war, bei der legendären, einmal im Jahr zur Leipziger Buchmesse stattfindenden Lyriknacht „Auch dieser Raum ensteht durch Gebrauch“ hören. Zu lesen war er bislang unter anderem in der Fabrikzeitung. Neben dem Schreiben arbeitet der 1988 in Malaga Geborene als Gestalter. Jetzt ist im Schweizer Independent-Verlag die brotsuppe sein erstes Buch erschienen.
Wovon Farantheiner handelt, ist eigentlich gar nicht so schwer zu beschreiben: Ein junger und ein alter Mann reiten durch die Prärie, es geht um ein Testament, später kommen noch eine junge Frau und ein Pferdedieb ins Spiel – tatsächlich ist der Stoff dieses Romans in einem etwas freieren Verständnis des unkreativen Schreibens dem erotischen Heftroman Für eine Nacht ohne Tabus der Autorin Sandy Steen entlehnt, der in der Reihe „Tiffany exklusiv“ des Cora Verlags erschienen ist (leider nicht mehr lieferbar). Der Inhalt wird auf der Verlagsseite wie folgt beschrieben:
Belle riskiert es! Binnen 30 Tagen muss sie heiraten, sonst verfällt ihr Erbe. Zum Glück ist der auffallend gut aussehende Cowboy Cade McBride bereit, das Spiel zum Schein mitzuspielen. Allerdings unter einer Bedingung: er fordert von Belle eine Nacht. Ohne jedes Tabu.
Patrick Savolainen bearbeitet diese Vorlage nach allen Regeln der Kunst, indem er verschiedene Formen der Nacherzählung erprobt: Mal ist es, als höre man jemandem zu, der sich versucht, an die Handlung zu erinnern; dann wiederum liest sich der Text wie ein monotones Protokoll der Ereignisse, oder es werden verschiedene Varianten desselben Satzes aufgereiht.
Auf diese Weise entsteht mit der Zeit eine Art Vakuum: Dadurch, dass der große Handlungsbogen schon vorgegeben ist, muss Savolainen keine Rücksicht mehr auf die Erzählökonomie legen und kann nach Belieben Szenen ausdehnen, komprimieren, überspringen oder in Zeitlupe ablaufen lassen. So werden die knapp 200 Seiten von Farantheiner zum literarisches Experimentierfeld, das mehr ist als nur eine Fingerübung. Ein Kapitel besteht nur aus der äußerst poetischen Wiedergabe von Träumen der handelnden Personen, an vielen Stellen montiert Savolainen immer wieder, typografisch kunstvoll hervorgehoben, den Originaltext von Sandy Steen ein und liest ihn gegen den Strich.
Farantheiner findet einen eleganten Weg, den Erwartungen an einen klassischen Debütroman aus dem Weg zu gehen. Am Schluss bleibt eine ebenso überraschende wie einfache Erkenntnis: Dass Erzählen manchmal am besten gelingt, wenn man gar nichts erzählen muss.
Patrick Savolainen: Farantheiner. Verlag Die Brotsuppe, 194 Seiten, 24 €