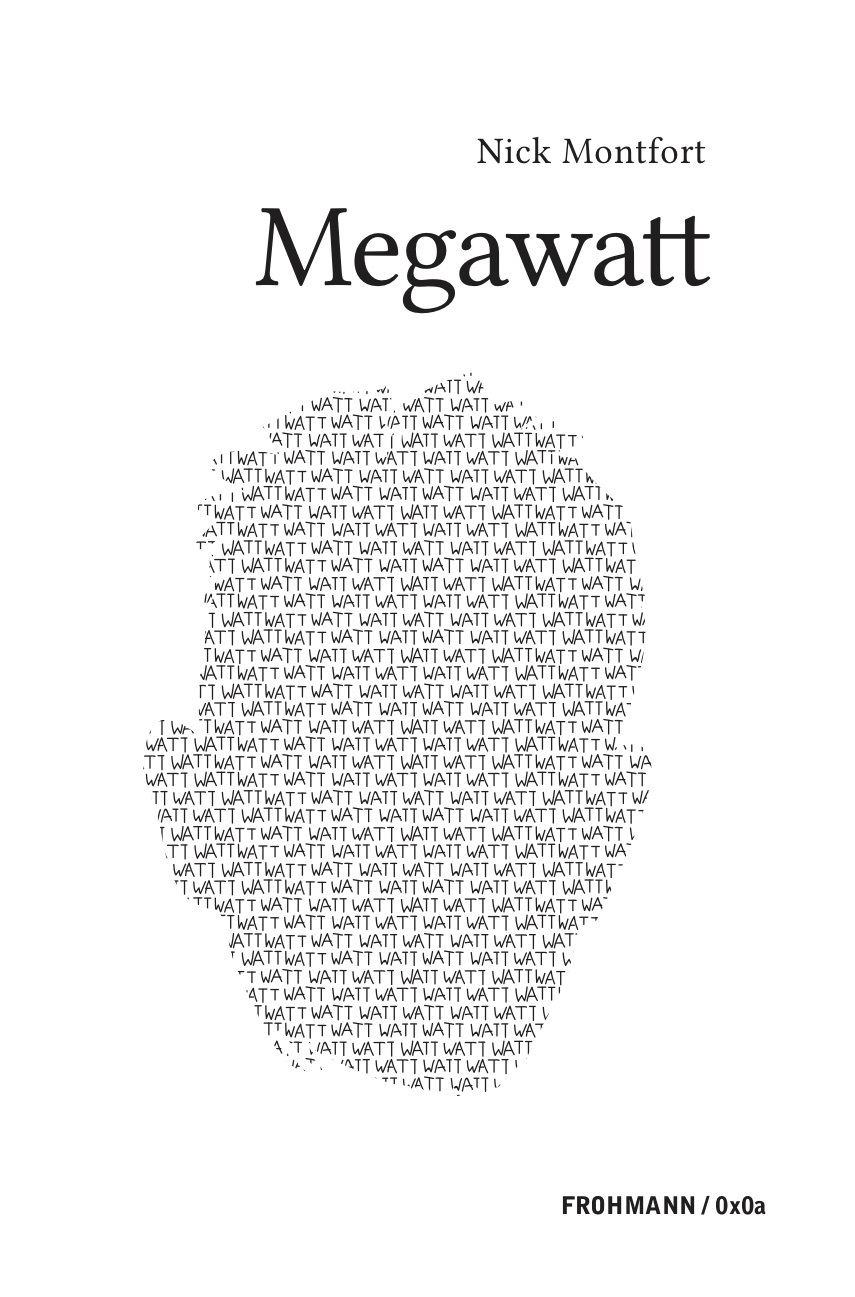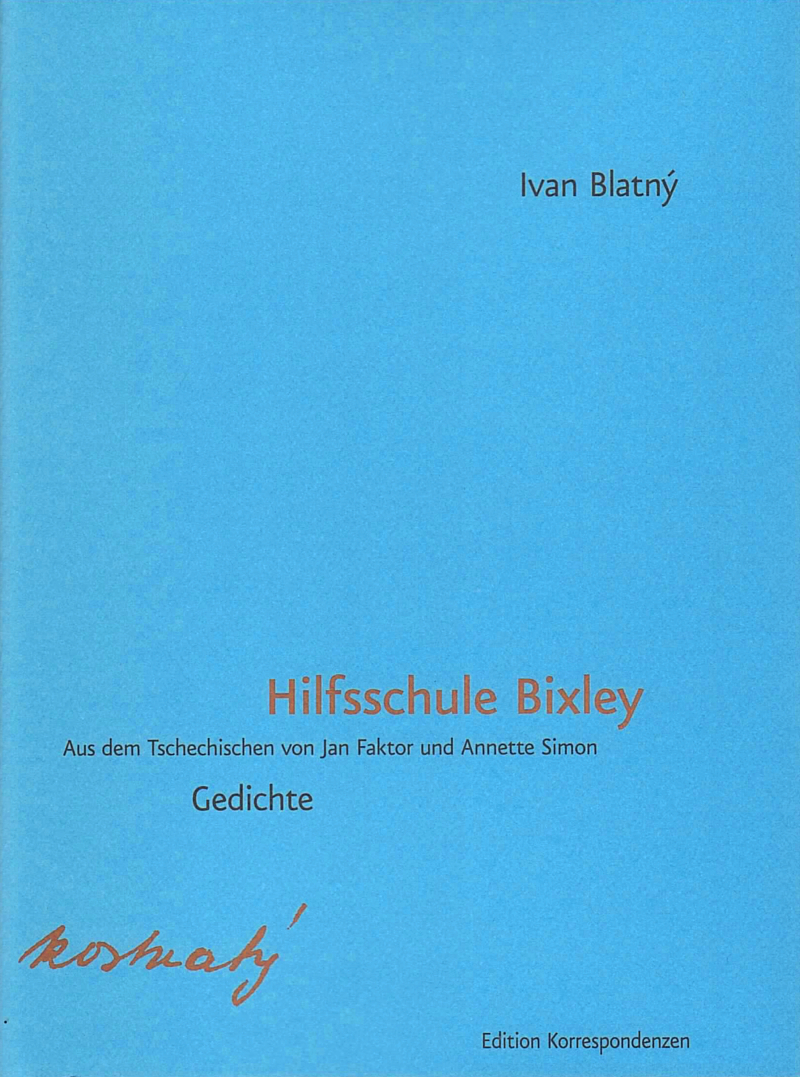Eine Plattform, ein Netzwerk, ein Archiv, und im Mittelpunkt die Übersetzung von Texten: Das ist die Edition Bahia. Im Interview stellen sich Clara Sondermann, Karl Clemens Kübler und Peter Wolff aus dem Gründerteam vor.
Was ist euer Wunsch für die Edition Bahia?
Karl Clemens: Unser Projekt ist ein Webportal, auf dem Übersetzer übersetzte Texte auf Deutsch vorstellen können, um neuen Autoren aus der ganzen Welt im deutschsprachigen Raum ein zentrales Medium zu geben und ihre Texte bekannt zu machen. Bahia ist eine Website, die zum Lesen einlädt. Auszüge aus Romanen, kurze Formen und Essays sollen kurz von den Übersetzern vorgestellt und sozusagen als Promotion für den oder die noch unbekannte AutorIn zugänglich gemacht werden. So sollen interessierte Leser, Übersetzer, Autoren und im besten Fall Verlage an einem schönen Ort im Internet zusammengebracht werden. Bahia soll einen Raum schaffen, in dem Übersetzung als eigene Kunstform wahrgenommen wird.
Das heißt, es gibt so einen Raum bisher noch nicht?
Clara: Es gibt so viele Übersetzungen, die nicht gesehen werden. An denen lange gearbeitet wurde, mitunter auch im Rahmen von Werkstätten. Es ist nicht leicht, diese Texte als noch nicht etablierte Übersetzerin an Verlage zu vermitteln. Programme vom Deutschen Übersetzerfonds helfen dabei sehr. Dennoch ist es so: Wenn das so genannte „Alleinstellungsmerkmal“ eines Textes in einer Mail an die von Einsendungen überfluteten Lektorinnen nicht binnen weniger Minuten ausgemacht werden kann ist, besteht das Risiko, dass etwas Gutes in der Versenkung verschwindet. Ich möchte weder jammern noch verallgemeinern; ganz im Gegenteil habe ich gleich viel Verständnis für beide Seiten und könnte viele Gegenbeispiele anführen. Doch warum nicht einen dritten Raum schaffen, der dieser Marktspannung nicht ausgetzt ist. Es gibt sehr viel zwischen Suhrkamp-Übersetzerin ohne Nebenjobs und dem Übersetzer, der ein halbes Jahr lang ein erstes Gedicht übersetzt (und auch von den beiden möchten wir natürlich Einsendungen!).
Natürlich sind wir uns auch der Tatsache bewusst, dem unterbezahlten Übersetzen von Literatur damit nichts entgegensetzen zu können. Es ist natürlich prekär, doch wenn schon so viel Arbeit in einer Übersetzung steckt, die meist auch nicht bezahlt wurde, verdienen Text und Übersetzer doch Sichtbarkeit mit der Aussicht, am Ende von den richtigen Menschen gefunden zu werden.
Es gibt bei Bahia auch einen festen Bildteil. Wie fügt sich dieser in die Idee ein?
Peter: Was ich generell mit den Fotobeiträgen erreichen will, ist derselbe Austausch. Da man als Fotograf natürlich keinen Übersetzer braucht, könnte die Übersetzung darin liegen, dass der Fotograf nicht in seinem Umfeld ist, sondern im Ausland. Kristin ist ja z.B. Deutsche und fotografiert in Rio.
Wie seid ihr auf die Idee gekommen, das Ganze im Internet stattfinden zu lassen?
Karl Clemens: Peter Wolff und ich hatten vor längerem die Idee, gemeinsam eine Publikation zu machen. Er ist Fotograf und ich mache so Sachen mit Text. Irgendwann kamen wir darauf, dass es eigentlich schon genug Magazine gibt, die schön aussehen und auch irgendwie gute Texte bieten. Seit 2015 etwa beschäftige ich mich intensiver mit dem Thema Übersetzung und wollte dem seither eigenes Gewicht geben. Zu uns stießen dann Clara und Alex und wir kamen übereins, dass wir unseren Raum lieber im Internet aufbauen wollen.
Clara: Ich finde, es kann nicht genug schöne Magazine geben. Aber dass Bahia eine Website ist, macht es einfacher, mehr Beiträge zusammenzubringen. Und uns interessiert natürlich auch, was andere machen! Bei Treffen von Übersetzern kriegt man das schon mit, aber das ist uns zu wenig. Wir möchten mitbekommen können, woran die anderen arbeiten.
Gibt es schon ähnliche Projekte in anderen Ländern, plant ihr Kooperationen?
Karl Clemens: So weit sind wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Aber wir sind in jedem Fall offen für Kooperation.
Auf bahiabahia.de ist am 22. Juli das erste Material online gegangen: Eine Übersetzung von Max Czollek, der Gedichte von Adi Keissar aus dem Hebräischen übertragen hat, ein Fotobeitrag aus Rio de Janeiro von Kristin Bethge sowie die Dokumentation eines Übersetzungsprozesses zwischen Elisabeth Bauer und Nikita Safonov.
Gefällt mir:
Gefällt mir Wird geladen...