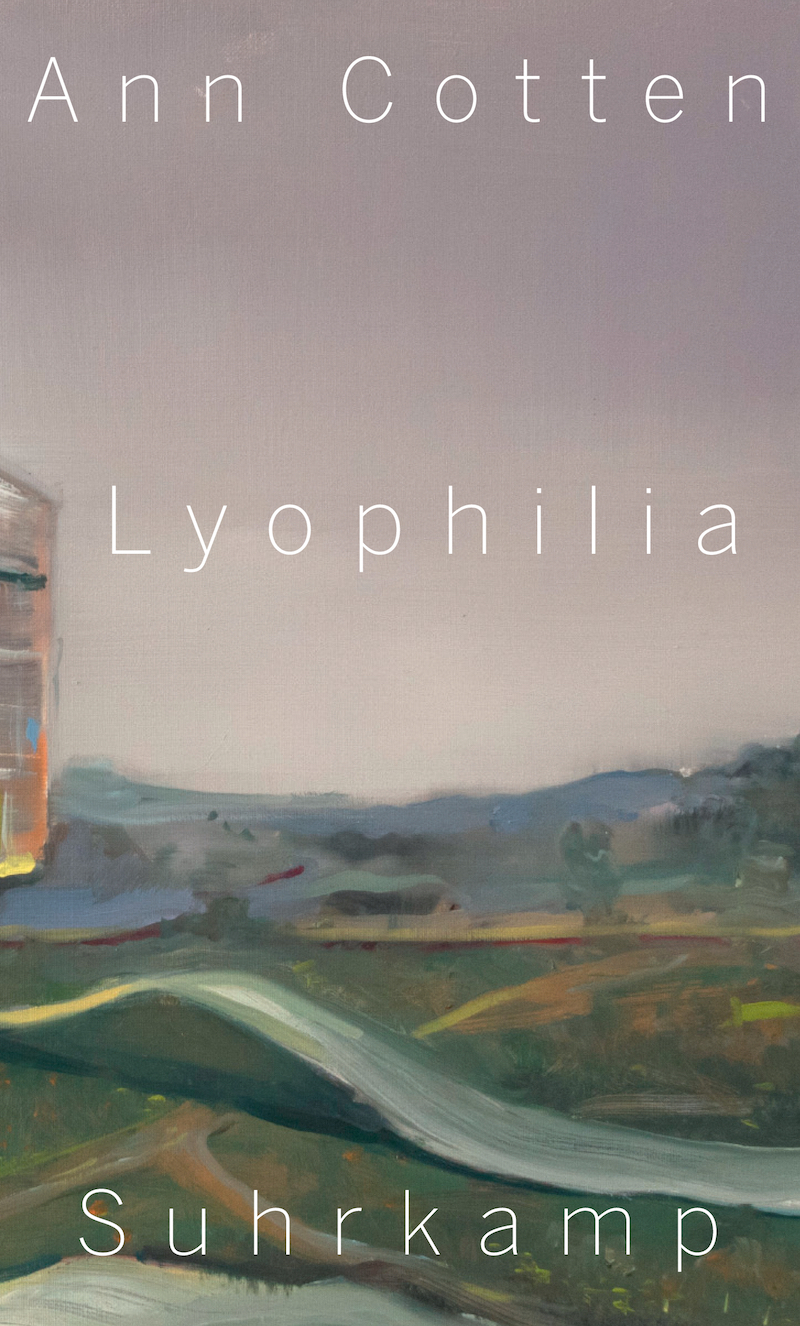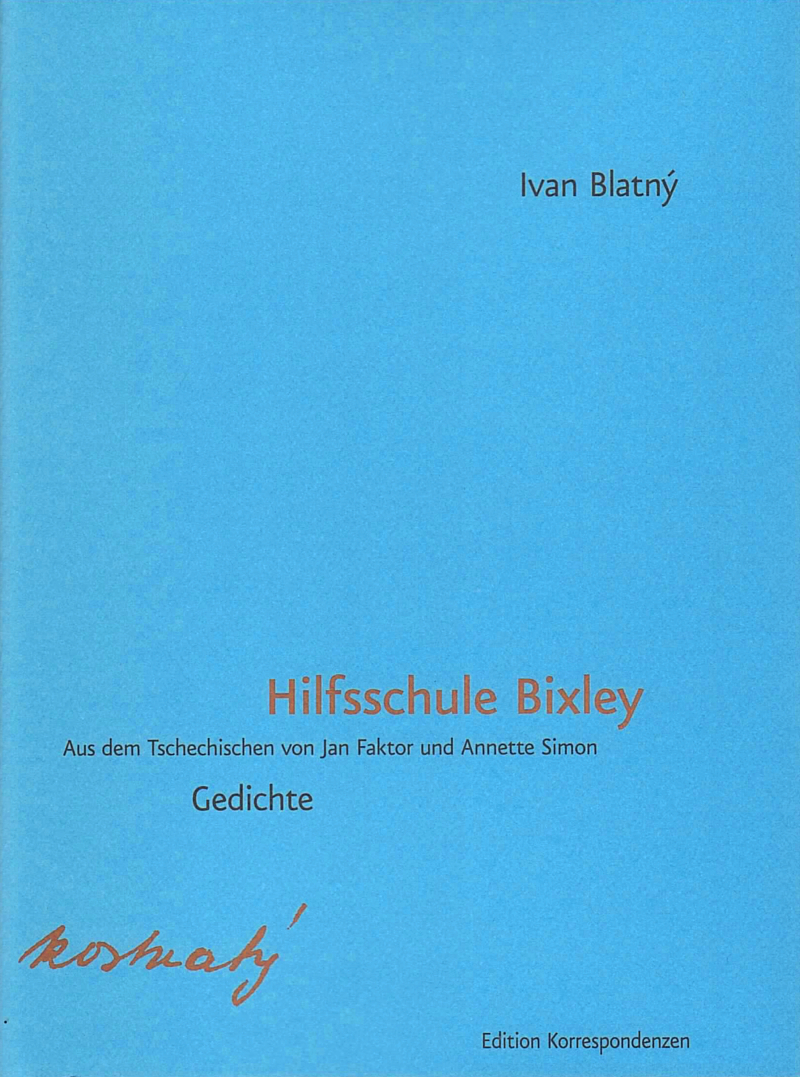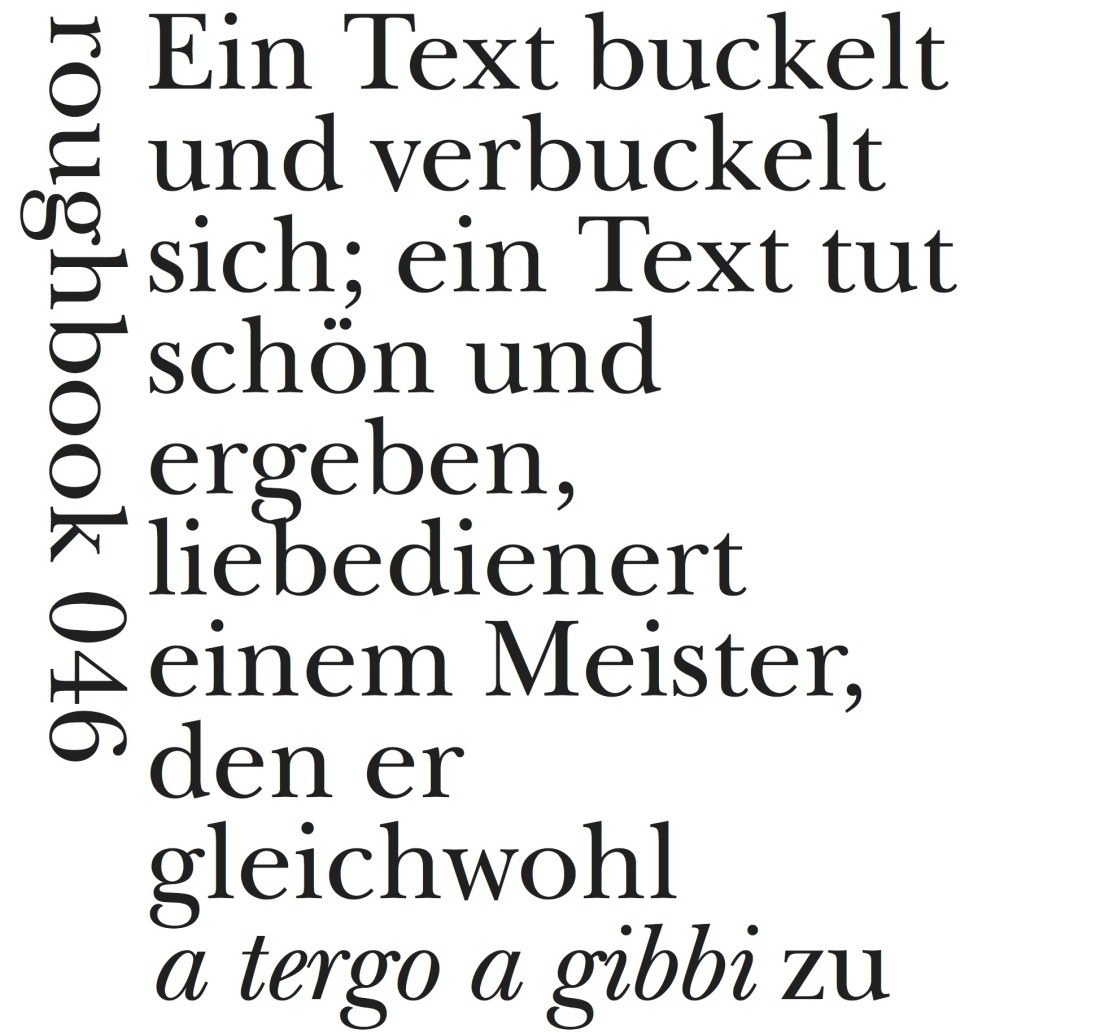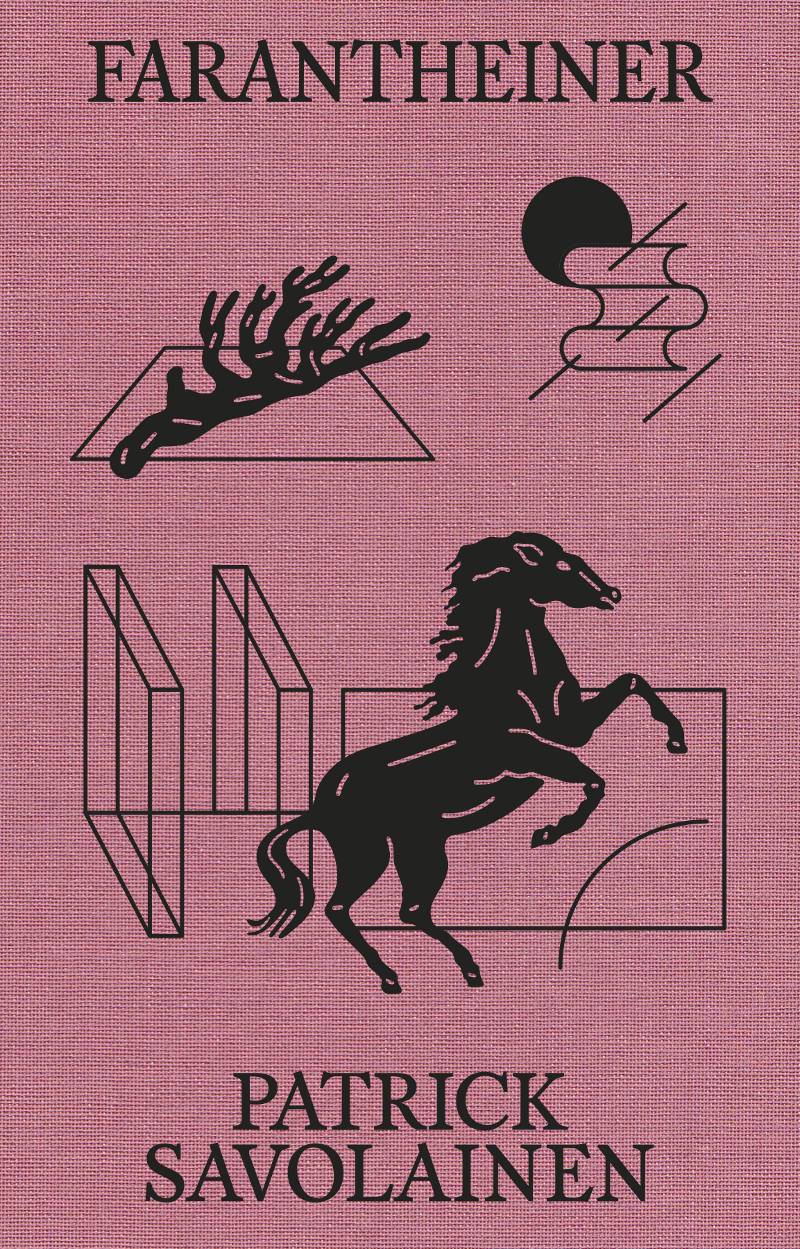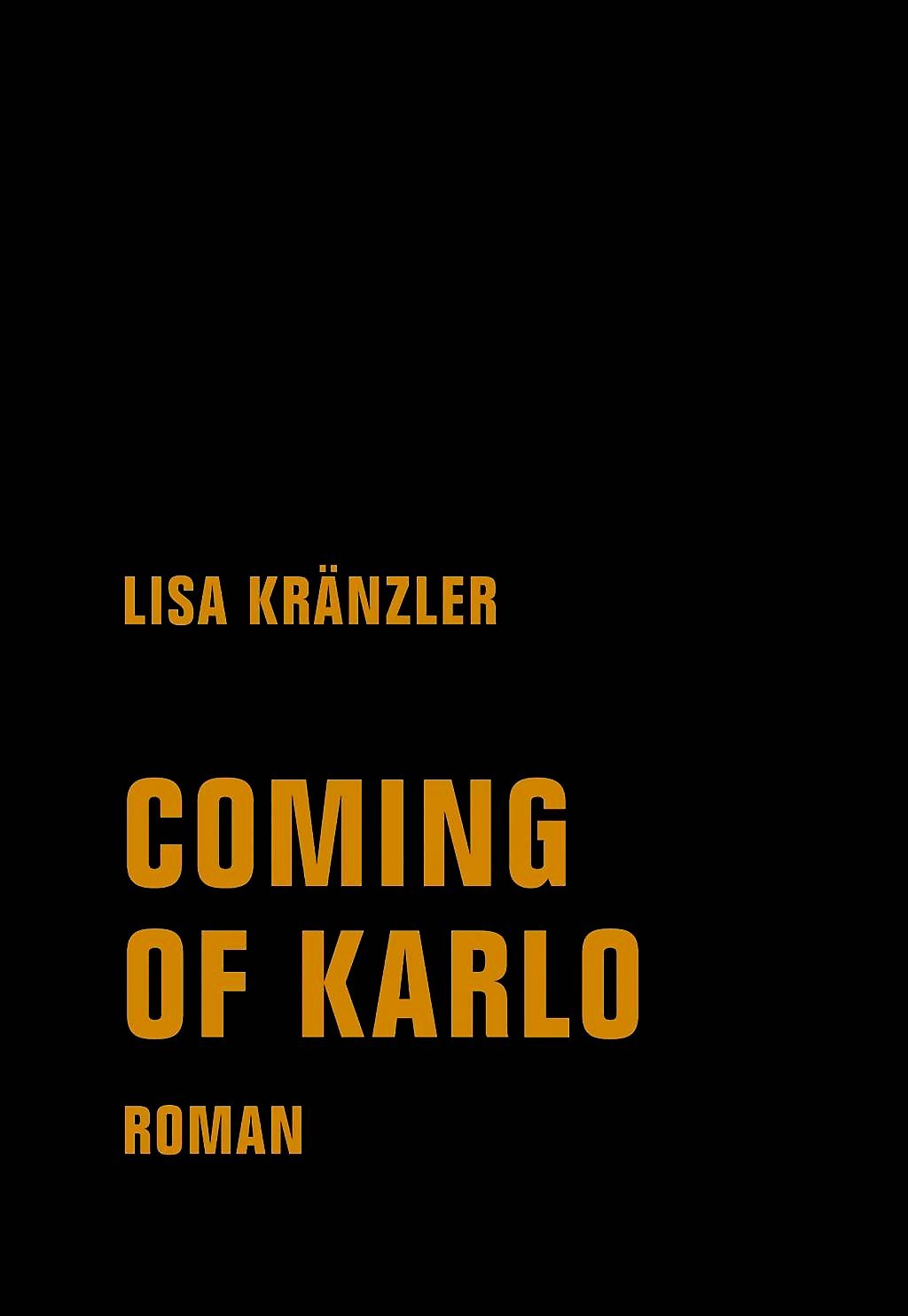
Lisa Kränzler ist wieder da. Und wie! Im hyperrealistisch-expressionistischen Überschwang lässt sie mit ihrem vierten Roman Coming of Karlo alle literarischen Konventionen weit hinter sich.
Kurz zurückgeblickt: Nachdem sie bereits als Malerin in Erscheinung getreten war, veröffentlichte Lisa Kränzer 2012 ihren ersten Roman Export A über den traumatischen Kanada-Aufenthalt einer Austauschschülerin, las beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb und gewann den 3sat-Preis. Im Jahr darauf folgte der Roman Nachhinein, in dem die Freundschaft zweier Mädchen gewaltsam eskaliert. Noch ein Jahr später dann der dritte Roman Lichtfang, berührende Geschichte eines Wahns, den die Liebe nicht retten kann. Das künstlerische Schaffen Lisa Kränzlers äußerte sich wieder stärker in den beiden folgenden Bänden Manifest (mit Tomaso Carnetto) und dem als Katalog konzipierten Kränzler, Lisa, wo sich Text und Bild vereinten. Jetzt ist im Verbrecher Verlag Lisa Kränzlers neuer, vierter Roman Coming of Karlo erschienen. Mit über 600 Seiten ist es ihr bislang längster – und auch ihr avanciertester.
Ich laufe nicht, ich fliege – und für Momente ist alles, wie es sein soll: schwere- und beschwerdelos. Voll funktionstüchtige Freude, die rennt, was sie kann: Das bin ich. Der Verbund aus Knochen, Muskeln, Sehnen weiß schon, wohin, braucht keine Befehle, kennt meinen Willen und nimmt ihn, wie er ist: nervenfasernackt und vollkommen wortgewandlos, hat keinen Begriff aber Zugriff, schreitet zur Tat, wenn diese noch keinen Namen hat, verwirklicht das Unsagbare.
Lauf, lauf, lauf!
Wer weiß, was Laufen ist? Wer kann sagen, was er da tut und wie er es gelernt hat?
Nicht denken, Karlo! Nicht den natürlichen Ablauf durcheinanderbringen! Lass es machen, einfach machen, bevor – da setzt sie ein, die Erinnerung, und mit ihr das Bewusstsein, das mich in Schrecken setzt: Ich weiß, wo ich bin und was geschehen wird …
Lisa Kränzlers Sprache ist von einer Plastizität, wie man sie in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur kaum findet. Ohne falsche Bescheidenheit lässt sie ihre Figuren innere Monologe abspulen, geizt nicht mit Ausrufezeichen, Fragezeichen, Auslassungspunkten und eigenwilligen Adjektiv- und Substantivkonstruktionen, die sich aber alle in ein Großes und Ganzes fügen, das sich am ehesten vielleicht als expressionistischer Hyperrealismus beschreiben lässt. Hier ist jede Szene bis ins letzte Detail ausgeleuchtet, jede Emotion wird aufs Schärfste beschrieben – und auch das Geschehen treibt unaufhaltsam ins Extreme: Karlo, der triebgesteuerte Teenager, der sich nur ansatzweise unter Kontrolle hat, stellt seine Familiengeschichte in Frage, seinen – von einer Fußballverletzung außer Gefecht gesetzten – Körper auf eine Belastungsprobe nach der anderen, und seine Sexualität steht ihm wie ein riesiger Klotz im Weg.

Foto: Nane Diehl
Es fühlt sich an wie ein Rausch, diesen atemlos, in vielen kleinen Kapiteln, Unterkapiteln und Fußnoten erzählten Roman zu lesen. Wie Stoppschilder tauchen aus dem Nichts heraus schwarze Seiten auf, dann Beschleunigungsstreifen, gegen Ende wird es ganz wild, mit typografisch variierenden Dialogzeilen, Diablochromen, Märchenzeilen und schwarzer Magie.
Lisa Kränzler hat sich mit einem Paukenschlag zurückgemeldet. Coming of Karlo schlägt wie ein gefährlicher Komet in den Bücherfrühling ein.
Lisa Kränzler: Coming of Karlo. Verbrecher Verlag, 624 Seiten, 29 €
Buchpremiere am 14. April 2019 um 20 Uhr in der Fahimi Bar, Skalitzer Straße 133, 10999 Berlin