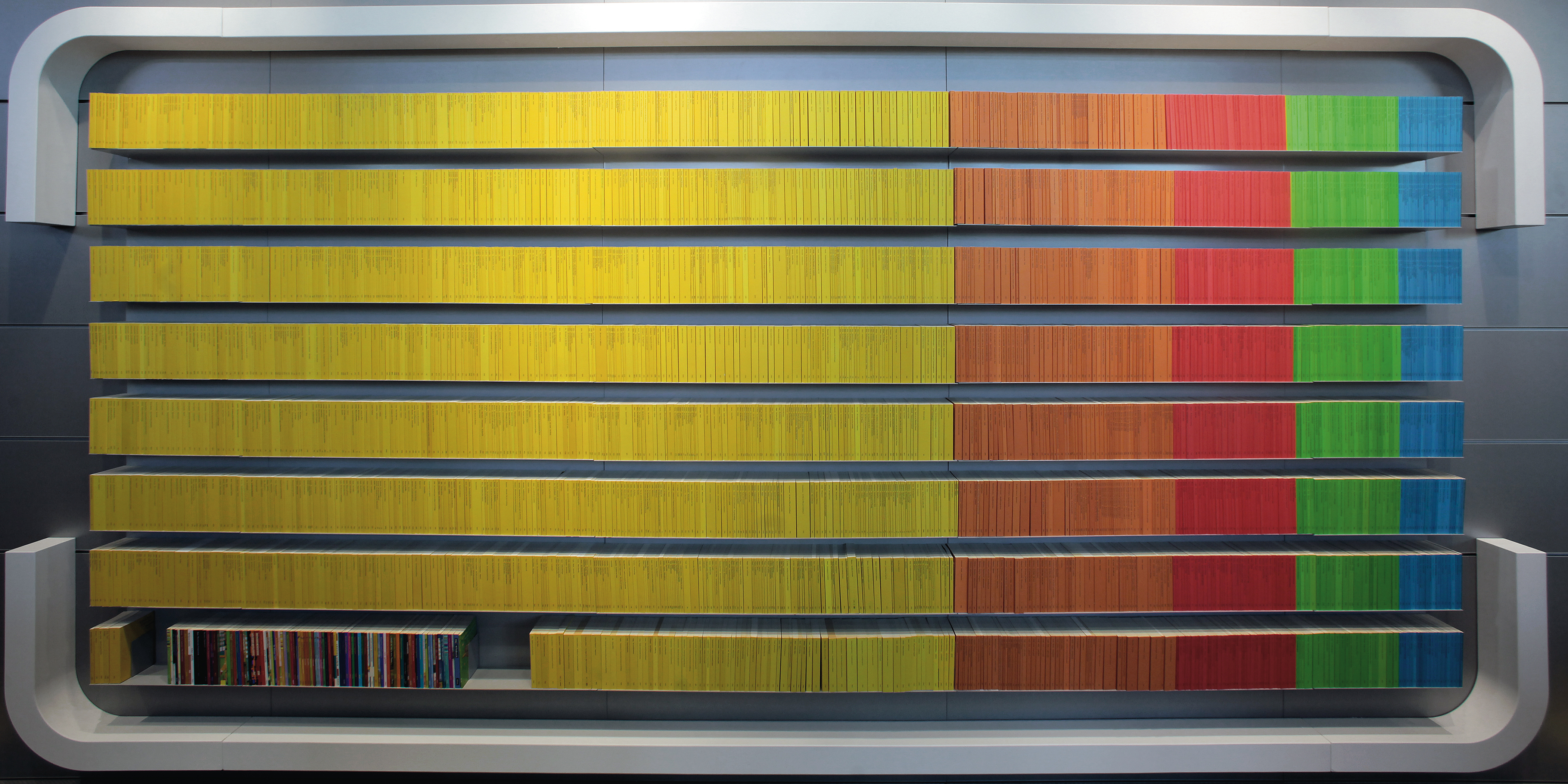In stundenlanger, emsiger Kleinarbeit konnte der Verfasser des vorliegenden Beitrages folgende Liste von sogenannten Generationenbüchern zusammentragen:
- Michael Adler (2011), Generation Mietwagen
- Marcel Althaus (2017), Try Hard!: Generation YouTube
- Sabine Asgodom/Bilen Asgodom (2010), Generation Erfolg
- Roland Baader (1999), Die belogene Generation
- Gabriele Bartsch/Raphael Gaßmann (2010), Generation Alkopops
- Ulrich Beck (2007), Generation Global
- Bernhard von Becker (2014), Babyboomer: Die Generation der Vielen
- Peter Bergh (2003), Generation Golfkrieg
- Hans Bertram/Carolin Deufhard (2014), Die überforderte Generation
- Benjamin Bidder (2016), Generation Putin
- Liane von Billerbeck (1999), Generation Ost
- Herwig Birg (2006), Die ausgefallene Generation
- Heike Bleuel (2007), Generation Handy
- Stefan Bonner/Anne Weiss (2008), Generation Doof
- Stefan Bonner/Anne Weiss (2016), Wir Kassettenkinder
- Sascha Brinkmann/Joachim Hoppe (2010), Generation Einsatz: Fallschirmjäger berichten aus Afghanistan
- Gisela Bruschek/Günter Keil (2008), Generation Kinderlos
- Christina Bylow/Kristina Vaillant (2014), Die verratene Generation
- Christian Cohrs/Eva Oer (2016), Generation Selfie
- Dantse Dantse (2017), Burnout Generation
- Annina Dessauer/Mirko Koch (2012), Generation Burn Out
- Ursula Engelen-Kefer (2013), Eine verlorene Generation? Jugendarbeitslosigkeit in Europa
- Gerhard Falschlehner (2014), Die digitale Generation
- Susanne Finsterer/Edmund Fröhlich (2007), Generation Chips. Computer und Fastfood
- Kathrin Fischer (2012), Generation Laminat
- Leo Fischer (2012), Generation “Gefällt mir”
- Erika Folges/Gerald Gatterer (2005), Generation 50 plus
- Milan Freudenberg (2016), Generation Smartphone
- Ines Geipel (2014), Generation Mauer
- Christa Geissler/Monika Held (2007), Die Generation Plus lebt ihre Zukunft
- Johannes Gernert (2010), Generation Porno
- Manfred Gerspach (2014), Generation ADHS
- Uta Glaubitz (2006), Generation Praktikum
- Alina Gromova (2013), Generation »koscher light«
- Meredith Haaf (2011), Heult doch: Über eine Generation und ihre Luxusprobleme
- Michael Hacker/Stephanie Maiwald (2012), Dritte Generation Ost
- Johnny Haeusler/Tanja Haeusler (2015), Netzgemüse: Aufzucht und Pflege der Generation Internet
- Horst Hanisch (2016), Die flotte Generation Z im 21. Jahrhundert
- Andreas Hock (2018), Generation Kohl
- Ernst Hofacker/Meinrad Grewenig (2014), Generation Pop!
- Klaus Hurrelmann/Erik Albrecht (2016), Die heimlichen Revolutionäre: Wie die Generation Y unsere Welt verändert
- Katja Kullmann (2002), Generation Ally: Warum es heute so kompliziert ist, eine Frau zu sein
- Philipp Ikrath/Bernhard Heinzlmaier (2013), Generation Ego
- Florian Illies (2001), Generation Golf
- Florian Illies (2003), Generation Golf zwei
- Veronika Immler/Antje Steinhäuser (2010), Generation Yps
- Maren Jahnke/Karen Schulz (2016), Schnellkochtopf: Die neue Generation
- Oliver Jeges (2014), Generation Maybe
- Sven Kuntze (2014), Die schamlose Generation
- Daniel Kurth (2017), Generation Unverbindlich
- Birgitta vom Lehn (2010), Generation G8
- Theo Länge/Barbara Menke (2007), Generation 40plus
- Claudia Langer (2012), Die Generation Man-müsste-mal
- Roman Machens/Christoph Eydt (2015), Generation Sodbrennen
- Ahmad Mansour (2017), Generation Allah
- Rolf Meyer (2017), Generation der gewonnenen Jahre
- Caren Miosga/Wolfgang Büscher (2011), Generation Wodka
- Reinhard Mohr (2015), Generation Z
- Jürgen Müller (2007), Generation Gold
- Matthias Müller-Michaelis (2008), Generation Pleite
- Michael Nast (2016), Generation Beziehungsunfähig
- Paul Nolte (2005), Generation Reform
- Michael Odent/Tanja Ohlsen (2014), Generation Kaiserschnitt
- Nina Pauer (2011), Wir haben keine Angst: Gruppentherapie einer Generation
- Christoph Quarch/Evelin König (2013), Wir Kinder der 80er
- Hugo Ramnek (2017), Meine Ge-Ge-Generation
- Martin Reichert (2008), Wenn ich mal groß bin: Das Lebensabschnittsbuch für die Generation Umhängetasche
- Philipp Riederle (2013), Wer wir sind und was wir wollen: Ein Digital Native erklärt seine Generation
- Jens Schneider et al. (2014), generation mix: Die superdiverse Zukunft unserer Städte
- Christian Scholz (2014), Generation Z
- Dirk Schunk (2004), Einführung in die Generation: Counter Strike
- Stephanie Schwenkenbecher/Hannes Leitlein (2017), Generation Y
- Michel Serres (2013), Erfindet euch neu! Eine Liebeserklärung an die vernetzte Generation
- Hilal Sezgin (2006), Typisch Türkin? Porträt einer neuen Generation
- Anna Spangenberg/Heike Kleffner (2016), Generation Hoyerswerda
- Klaus Tauber (2008), Generation Fußnote
- Gerlinde Unverzagt (2017), Generation ziemlich beste Freunde
- Joachim Voss (2017), Generation Boxster S
- Philippe Wampfler (2014), Generation “Social Media”
- Katharina Weiß (2010), Generation Geil
- Gülcin Wilhelm (2011), Generation Koffer: Die Pendelkinder der Türkei
- Markus Willinger (2013), Die identitäre Generation
- Bernhard Winkler (2013), So nicht! Anklage einer verlorenen Generation
Unschwer lässt sich erkennen, dass inzwischen quasi jeder Lebensaspekt in diesem nun immerhin auch schon über 15 Jahre alten Genre der deutschen Literatur (Generationenbücher vor Generation Golf zählen als Generationenbücher avant la lettre) abgebildet wird. Meine persönlichen Favoriten sind Generation Wodka, Generation Sodbrennen und Generation Laminat. Für die hiesige Sachbuchverriss-Rubrik plane ich derzeit, von denjenigen dieser Bücher, die für Centbeträge gebraucht zu bekommen sind (und das sind nicht wenige), die mit den lustigsten Titeln oder AutorInnennamen anzuschaffen und kurz zu rezensieren.
Bereits jetzt darf ich versprechen: Es wird dabei auch durchweg darum gehen, dass der Gebrauch des Ausdrucks »Generation« bei solchen Büchern und ganz allgemein bei »Generationentexten« sehr oft falsch und anmaßend ist; vgl. dazu auch die Kollegin Herrmann in ihrer Rezension zu Simon Strauß’ »Generationenroman« Sieben Nächte.



 Ein Buch mit dem Untertitel »Dichter und Denker zur Bundestagswahl 2017« wäre peinlich. Irgendjemand unter den Herausgebern (Joachim Helfer, Marco Meyer und Klaus Wettig) oder jemand beim Steidl-Verlag hat das noch rechtzeitig gemerkt, daher ist der 340-seitige Sammelband nicht mit dem verräterischen Untertitel, den man in der Artikelvorschau bei Amazon sehen konnte, erschienen, sondern heißt nun »Wenn ich mir etwas wünschen dürfte. Intellektuelle zur Bundestagswahl 2017«.
Ein Buch mit dem Untertitel »Dichter und Denker zur Bundestagswahl 2017« wäre peinlich. Irgendjemand unter den Herausgebern (Joachim Helfer, Marco Meyer und Klaus Wettig) oder jemand beim Steidl-Verlag hat das noch rechtzeitig gemerkt, daher ist der 340-seitige Sammelband nicht mit dem verräterischen Untertitel, den man in der Artikelvorschau bei Amazon sehen konnte, erschienen, sondern heißt nun »Wenn ich mir etwas wünschen dürfte. Intellektuelle zur Bundestagswahl 2017«.

 Mit Erzählungen ist der schmale Band des Schweizer Verlages
Mit Erzählungen ist der schmale Band des Schweizer Verlages