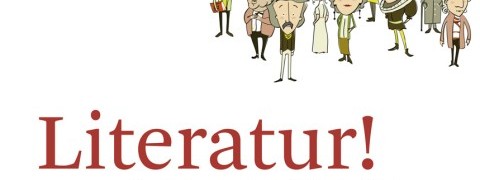Ich hoffe alle haben Weihnachten gut überstanden.
Neben meinen Neuerwerbungen und den Geschenken, die nachher noch einen eigenen kurzen Eintrag bekommen sollen, möchte ich kurz eine Rezension eines Buches einschieben, das es mir sehr angetan hat.
Literatur!: Eine Reise durch die Welt der Bücher von Katharina Mahrenholtz, illustriert von Dawn Parisi.
War mir beim Stöbern bereits aufgefallen und ich hatte es mir vermerkt. Nun hat es sich tatsächlich meine Mutter zu Weihnachten gekauft und damit nicht nur sich, sondern auch mich beschenkt.
Es wird nur so durch den Kanon der klassischen Weltliteratur galoppiert. Die Hauptartikel umfassen nicht mehr als eine Seite und zu besonders wichtigen Autoren und ausgewählten Exoten oder Lieblingen gibt es noch eine Seite Biographie obendrauf. Den Anfang macht “Die Göttliche Komödie” und den Schlusspunkt setzen “Die Korrekturen” . Kurze Inhaltsangaben, die auch große Werke nicht schonen und in denen auch offen zugegeben wird, dass die Schwierigkeit einer solchen von “Auf der Suche nach der verlorenen Zeit” nicht unbedingt (nur) die ungeheure Zahl an Seiten ist, sondern eben auch “dass es seitenlag gar keine Handlung gibt, sondern eher so etwas wie gedankliche Abschweifungen.” Launige Kategorien wie “Smalltalk-Info” oder “Für Einsteiger” enthalten interessante Querverweise auf andere Werke des Autors, den geschichtlichen Hintergrund, die gesellschaftlichen Strukturen zu der Zeit oder der Rezeption des Werks.
Garniert wird das ganze mit eingeschobenen Doppelseiten “Kurz, wichtig” mit halbseitigen Kurzrezensionen anderer Werke der Zeit, Tipps für verschiedene Lesetypen oder auch eine Auswahl schöner Buchanfänge. Als Beispiel für den Mut der Autorin zählt hier zum Beispiel, dass sie mit seinem “Nachts, im Mondschein, lag auf einem Blatt ein kleines Ei” mal eben “Die kleine Raupe Nimmersatt” von Eric Carle in den Kanon der Weltliteratur schummelt. Und eben dieser Mut ist es, der dieses Buch so großartig macht, keine Scheu davor zu haben, dass manche Werke nicht leicht zu lesen sind, manche vielleicht keine Handlung haben oder alles in allem eine schlechte Story, versehen mit der Erläuterung warum diese aber trotzdem in ein Kompendium der Weltliteratur gehören.
Wenn über der Garnitur noch ein i-Tüpfelchen erlaubt sein darf, die Illustrationen sind witzig und karikaturesk, aber nicht albern und die teilweise auf einer Seite zeichnerisch dargestellten Gesamthandlungen eines ganzen Romans großartig.
Obendrauf, in dem Fall eher untendrauf, gibt es eine Zeitleiste die fortlaufend auf jeder Seite veranschaulich, was zum Zeitpunkt der Veröffentlichung in der Geschichte sonst so los war, hierzu gehört eben durchaus auch das Patent für das Weckglas und die Rolltreppe 1892, aber ebenso das Erscheinen anderer wichtiger Werke in Literatur, Kunst oder Musik.
Das Buch eignet sich für alle! Für den Einsteiger in die Lektüre von Klassikern, weil es Appetit auf mehr macht, für den der neue Anregungen braucht, natürlich auch für den Besserwisser, der gerne mit Wissen über (Nicht)gelesenes prahlen will, aber selbst der Vielleser lernt hier neues. Es macht Spaß die frotzelnden Texte auch über eigene Lieblingsbücher zu lesen und besonders erfreut einen dann noch, dass Bücher wie “Emil und die Detektive” oder die “Fünf Freunde” Erwähnung finden.
Ein alles in allem wundervolles, schön gemachtes Buch!
Aber Achtung! Viele neue Tipps, Anregungen und wieder- oder neuentdeckte Interessen oder Bücher, die man unbedingt lesen muss, haben halt auch viele neue Wünsche zur Folge. Bis jetzt bei mir neu auf die Wunschliste geschafft haben es schon:
Alma Mahler-Werfel – Mein Leben
Klaus Mann – Der Wendepunkt
Ernest Hemingway – Paris, ein Fest fürs Leben
Wolfgang Borchert – Das Gesamtwerk