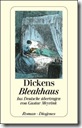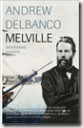Harte Zeiten ist 1854 im Anschluss an Bleakhaus entstanden. Erzählt wird hauptsächlich die Geschichte des Geschwisterpaares Louisa und Tom Gradgrind, die von ihrem Vater nach einem streng rationalen Programm erzogen werden: Fantasie, Märchen, überhaupt Gefühle aller Art sind verpönt, stattdessen werden die Wissenschaften, insbesondere aber Mathematik – genauer: die Statistik – und Logik hoch gehalten. Die Kinder geraten dementsprechend: Louisa heiratet den Bankier und Webereidirektor Josiah Bounderby, der ihr gänzlich gleichgültig ist, weil sie hofft, damit ihrem Bruder Tom das Leben erleichtern zu können, der in Bounderbys Bank als Angestellter beschäftigt ist. Tom verfällt aber, sobald er dem väterlichen Regime entflohen ist, nahezu sofort der Spielleidenschaft und häuft rasch drückende Schulden an.
Harte Zeiten ist 1854 im Anschluss an Bleakhaus entstanden. Erzählt wird hauptsächlich die Geschichte des Geschwisterpaares Louisa und Tom Gradgrind, die von ihrem Vater nach einem streng rationalen Programm erzogen werden: Fantasie, Märchen, überhaupt Gefühle aller Art sind verpönt, stattdessen werden die Wissenschaften, insbesondere aber Mathematik – genauer: die Statistik – und Logik hoch gehalten. Die Kinder geraten dementsprechend: Louisa heiratet den Bankier und Webereidirektor Josiah Bounderby, der ihr gänzlich gleichgültig ist, weil sie hofft, damit ihrem Bruder Tom das Leben erleichtern zu können, der in Bounderbys Bank als Angestellter beschäftigt ist. Tom verfällt aber, sobald er dem väterlichen Regime entflohen ist, nahezu sofort der Spielleidenschaft und häuft rasch drückende Schulden an.
In dieser Situation kommt der weltgewandte, aber tief gelangweilte Dandy James Harthouse nach Coketown, einer kleinen, fiktiven Industriestadt, in der der Roman spielt, um sich um einen Parlamentssitz in der Gegend zu bewerben. Er wird als Parteifreund auch im Hause Bounderbys empfangen und entschließt sich gleich bei ihrer ersten Begegnung, Louisa zu verführen. Um ihr Vertrauen zu gewinnen, kümmert er sich um den haltlosen Tom, der gerade zu dieser Zeit einen Einbruch in die Bank vortäuscht, um seine eigene Veruntreuung zu vertuschen. Harthouse nimmt sich Toms als vorgeblicher Freund an, um sich das Vertrauen Louisas zu erwerben, die sich schließlich vor seinen Verführungskünsten, denen sie ebenso wenig entgegenzusetzen hat wie ihren eigenen Gefühlen für diesen Mann, verzweifelt ins elterliche Heim flüchtet. Am Ende scheitern beide Geschwister: Tom muss ins Ausland fliehen, wo er im Elend stirbt, und Louisa wird von ihrem scheinheiligen und angeberischen Ehemann verstoßen und geschieden.
Als Nebenstrang dient die Geschichte Stephen Blackpools, eines Coketowner Arbeiters, der vom Schicksal arg gebeutelt wird: Seine Frau ist Alkoholikerin, die Frau, die er liebt, Rachael, ist genau wie er selbst zu moralisch, um eine außereheliche Beziehung zu beginnen, er ist ein Außenseiter unter den Arbeitern, da er nicht bereit ist, sich ihrem Arbeitskampf anzuschließen und schließlich wird er von seinem Chef Bounderby auch noch entlassen, weil der Blackpools Einstellung nicht versteht. So verlässt Blackpool die Stadt, nicht ohne dass Tom zuvor durch einen kleinen Trick den Verdacht auf ihn lenkt, für den Bankraub verantwortlich zu sein. In dieser Nebenhandlung kommen nicht nur die nicht nur für Dickens typischen aufrechten, hoch moralischen und bitter armen Idealtypen vor, sondern sie wird von ihm auch dazu benutzt, ein erschreckendes Bild von der Industriearbeit seiner Zeit zu zeichnen. Ergänzt wird dieses Bild durch die Figur Slackbridge, der als gewerkschaftlicher Redner und Arbeiterführer an zwei Stellen zu Wort kommt. Dickens ist für die Figur Slackbridges zu Recht scharf kritisiert worden, da er mit seinen letztlich naiven Gutmenschen Blackpool und Rachael die soziale und gesellschaftliche Problematik seiner Zeit eindeutig unterläuft.
Besonders der erste Teil des Romans lebt von Dickens scharfer und witziger Satire gegen den Glauben an eine reine Rationalität, wie sie im Utilitarismus Jeremy Benthams oder John Stuart Mills zum Ausdruck kommt. Sicherlich spitzt Dickens Musterfamilie Gradgrind die Thesen der Utilitaristen polemisch zu, aber der Kritik, die aus den von Dickens aufgezeigten Konsequenzen einer seelen- und mitleidslosen Rationalität folgt, kann sich der Utilitarismus nur schlecht entziehen. Es ist schlicht falsch, zwischenmenschliche Beziehungen auf ein statistisches Rechenexempel reduzieren zu wollen, und wer dergleichen versucht, missversteht wesentlich, worum es im menschlichen Miteinander geht.
Insgesamt sicherlich nicht der gelungenste Roman von Dickens, aber gerade aufgrund seines polemischen Gehalts unterhaltsam und lesenswert. Die Übersetzung von Christiane Hoeppener ist recht korrekt – wenn es auch einzelne Unsicherheiten bei den verwendeten Anreden gibt –, macht aber insgesamt einen eher steifen Eindruck.
Charles Dickens: Harte Zeiten. Aus dem Englischen von Christiane Hoeppener. Rowohlt Jahrhundert, Bd. 10. Reinbek: Rowohlt Taschenbuch Verlag, 1987. 382 Seiten. – Diese Übersetzung ist derzeit nur antiquarisch lieferbar.
Lieferbare Alternativ-Ausgabe: Charles Dickens: Harte Zeiten. Aus dem Englischen von Paul Heichen. Insel Taschenbuch 955. Frankfurt/M.: Insel Taschenbuch Verlag, 1986 ff. 433 Seiten mit Illustrationen v. F. Walker u. Maurice Greiffenhagen. 11,50 €.
 Ein mit 36 Briefen dünner Briefwechsel dieser beiden prominentesten Schweizer Autoren des vergangenen Jahrhunderts, den ich aus didaktischem Anlass wieder einmal aus dem Schrank geholt habe. Natürlich erklärt sich der geringe Umfang hauptsächlich daraus, dass Frisch und Dürrenmatt sehr vieles mündlich verhandelt haben bzw. sich später nur noch wenig zu sagen hatten. Man merkt beiden am Ende die gute Absicht an, mit der der jeweils andere nichts mehr anzufangen weiß. Dennoch waren sie wohl bis zum Schluss mit dem Gegenüber innerlich mehr beschäftigt, als es die äußerlich bleibenden Briefe ahnen lassen.
Ein mit 36 Briefen dünner Briefwechsel dieser beiden prominentesten Schweizer Autoren des vergangenen Jahrhunderts, den ich aus didaktischem Anlass wieder einmal aus dem Schrank geholt habe. Natürlich erklärt sich der geringe Umfang hauptsächlich daraus, dass Frisch und Dürrenmatt sehr vieles mündlich verhandelt haben bzw. sich später nur noch wenig zu sagen hatten. Man merkt beiden am Ende die gute Absicht an, mit der der jeweils andere nichts mehr anzufangen weiß. Dennoch waren sie wohl bis zum Schluss mit dem Gegenüber innerlich mehr beschäftigt, als es die äußerlich bleibenden Briefe ahnen lassen.