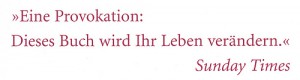Die Alpen stehen im übrigen in einem Mißverhältnis zu unserem Individuum. Zu groß, um uns nützlich zu sein.
Gustave Flaubert an Ivan Turgenev
Kategorie: F
Anne Fadiman: Ex Libris
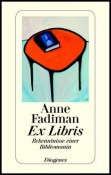 Anne Fadiman dürfte in Deutschland vor diesem Buch nur einigen wenigen Fachleuten, Soziologen und Medizinern, aufgrund ihres Buches »The Spirit Catches You and You Fall Down« bekannt gewesen sein. Sie ist die Tochter des in den Vereinigten Staaten bekannten Autors und Radiomoderators Clifton Fadiman, der unter anderem zahlreiche Anthologien und einen weitverbreiteten Lesekanon herausgegeben hat. Auch ihre Mutter ist Journalistin und Autorin. Anne Fadiman entstammt also einer Familie von Lesern, und sie hat diese Tradition mit ihrer eigenen Familie fortgesetzt: Sie hat einen Leser geheiratet und ihre Kinder zeigen alle Anzeichen dafür, dass sie dieses Erbe fortsetzen werden.
Anne Fadiman dürfte in Deutschland vor diesem Buch nur einigen wenigen Fachleuten, Soziologen und Medizinern, aufgrund ihres Buches »The Spirit Catches You and You Fall Down« bekannt gewesen sein. Sie ist die Tochter des in den Vereinigten Staaten bekannten Autors und Radiomoderators Clifton Fadiman, der unter anderem zahlreiche Anthologien und einen weitverbreiteten Lesekanon herausgegeben hat. Auch ihre Mutter ist Journalistin und Autorin. Anne Fadiman entstammt also einer Familie von Lesern, und sie hat diese Tradition mit ihrer eigenen Familie fortgesetzt: Sie hat einen Leser geheiratet und ihre Kinder zeigen alle Anzeichen dafür, dass sie dieses Erbe fortsetzen werden.
Und genau das ist das Kernthema der meisten der 17 kurzen Essays, die der Band versammelt: Eine Familie von Lesern und ihre Abenteuer mit Bücher, ihre Verhältnisse mit (nicht »zu«!) Büchern, ihre Freuden und Leiden. Für die deutsche Ausgabe hat man den schönen englischen Untertitel »Confessions of a Common Reader«, der sich auf einen Buchtitel Virginia Woolfs stützt, in das etwas reißerische »Bekenntnisse einer Bibliomanin« verwandelt, denn wer will heutzutage schon ein »gewöhnlicher Leser« oder gar ein »gemeiner Leser« sein. Allerdings muss man auch zugestehen, dass Anne Fadiman Selbstbezeichnung höchstens noch als kokett durchgeht, denn ihre Essays machen wenigstens eines deutlich: Sie ist eine obsessive Leserin und eine passionierte Sammlerin antiqarischer Bücher.
Wie schon gesagt, nimmt ein Großteil der Essays bei sehr persönlichen Erfahrungen Fadimans seinen Anfang: Die Vereinigung ihrer eigenen Bibliothek mit der ihres Mannes (nachdem die beiden bereits fünf Jahre lang miteinander verheiratet waren und noch länger zusammen lebten), ihre Freude an ausgefallenen und langen Wörtern, die bereits in ihrer Kindheit angeregt und gefördert wurde, ihre Neigung, alle gelesenen Texte zugleich auch Korrektur zu lesen, ihre Neigung dazu, Kataloge zu lesen, die unterschiedlichen Lesertypen in ihrer Verwandt- und Bekanntschaft usw. usf. Das alles ist unterhaltsam und leicht geschrieben, ohne seicht zu werden. Immer ist Fadimans breiter Lektürehintergrund zu erkennen, ihre lebenslange Auseinandersetzung mit der englischen und nordamerikanischen Literatur.
Nur einmal holt Fadiman richtig aus: Mit »Nichts Neues unter der Sonne« schreibt sie einen Essay zum Thema Plagiat, der voller Zitate und Plagiate steckt, die sie selbst fein säuberlich in Fußnoten nachweist. Das ist sehr virtuos gemacht, denn jede im Essay beschriebene Form des Plagiats findet sich zugleich auch in ihm umgesetzt.
Eine vergnügliche Lektüre für obsessive Bücherfreunde und jene Vielleser, die es werden wollen.
Anne Fadiman: Ex Libris. Bekenntnisse einer Bibliomanin. Aus dem Amerikanischen von Melanie Walz. Diogenes Taschenbuch 23646. Zürich, 2007. 8,90 €.

P. S.: Bei der in Fußnote 25 auf S. 146 unbekannten Quelle handelt es sich natürlich um Robert Mertons Buch »Auf den Schultern von Riesen«.
P. P. S.: An zwei Stellen (S. 111 u. 113) benutzt die Übersetzerin für das mit Apostroph abgetrennte Genitiv-s (im Volksmund auch »Deppen-Apostroph«) die nicht unpassende Bezeichnung »sächsischer Genitiv«. Hat einer das Original zur Hand und kann sagen, welche englische Phrase dem gegenübersteht?
Allen Lesern ins Stammbuch (4)
Interviewer: Manche Leute sagen, Ihre Bücher seien selbst nach zwei- oder dreimaligem Lesen nicht zu verstehen. Nehmen wir an, irgendeiner kommt mit dieser Klage direkt zu Ihnen, was würden Sie ihm sagen?
William Faulkner: Viermal lesen.
Deutsche Geschichte
 Die Digitale Bibliothek hat ihr ohnehin schon breites Angebot an elektronischen Werken zur Geschichte um die 10 grundlegenden Bände der »Deutschen Geschichte« aus dem Verlag Vandenhoeck & Ruprecht ergänzt. Diese Bände gehören seit Jahrzehnten zur studentischen Grundaustattung der meisten Historiker und decken die deutsche Geschichte von den Anfängen bis zum Jahr 1945 ab. Die CD-ROM enthält die vollständigen Texte aller Bände mit zusammen etwa 2.500 Buchseiten in den aktuellen, derzeit lieferbaren Auflagen zu einem unschlagbaren Preis.
Die Digitale Bibliothek hat ihr ohnehin schon breites Angebot an elektronischen Werken zur Geschichte um die 10 grundlegenden Bände der »Deutschen Geschichte« aus dem Verlag Vandenhoeck & Ruprecht ergänzt. Diese Bände gehören seit Jahrzehnten zur studentischen Grundaustattung der meisten Historiker und decken die deutsche Geschichte von den Anfängen bis zum Jahr 1945 ab. Die CD-ROM enthält die vollständigen Texte aller Bände mit zusammen etwa 2.500 Buchseiten in den aktuellen, derzeit lieferbaren Auflagen zu einem unschlagbaren Preis.
Highlight der Buchreihe war und ist mit Sicherheit Band 9, Hans-Ulrich Wehlers »Das Deutsche Kaiserreich 1871–1918«, der für das historische Verständnis dieser Zeit Maßstäbe gesetzt hat:
Über zwei Jahrzehnte lang hieß es an historischen Seminaren deutscher Universitäten ehrführchtig nur ›das blaue Buch‹. Niemand, der sich auf akademische Weise mit neuerer deutscher Vergangenheit beschäftigen wollte, kam daran vorbei. […] Mit dem ›blauen Buch‹ vollzog Wehler den vielleicht folgenreichsten Paradigmenwechsel in der (alt-)bundesrepublikanischen Geschichtswissenschaft […].
Sven Felix Kellerhoff, Die Welt
Zu dem Preisvorteil von knapp 80,– € kommen die üblichen Vorteile von Ausgaben der Digitalen Bibliothek hinzu: Eine ausgereifte, professionelle Software, die Volltextsuche, Paste & Copy auch längerer Passagen (mit exakter Seitenreferenz zur gedruckten Ausgabe), Lesezeichen, farbliche Textmarkierungen, das Ablegen von Notizen und Ausdrucke in individueller Formatierung erlaubt; dies ermöglicht ein intensives und zeitsparendes Arbeiten mit den Texten. Zusätzlich verfügt die elektronische Ausgabe über ein Gesamtregister der in allen Bänden verwendeten Abkürzungen. Diese CD-ROM ist auch geeignet, um eventuell bereits vorhandene Einzelbände der Reihe zu ergänzen.
Deutsche Geschichte. Hg. v. Joachim Leuschner. Digitale Bibliothek Band 151. Berlin: Directmedia Publishing in Kooperation mit Vandenhoeck & Ruprecht, 2006. 1 CD-ROM. Systemvoraussetzungen: PC ab 486; 32 MB RAM; Grafikkarte ab 640×480 Pixel, 256 Farben; CD-ROM-Laufwerk; MS Windows (98, ME, NT, 2000 oder XP) oder MAC ab MacOS 10.3; 128 MB RAM; CD-ROM-Laufwerk. Empfohlener Verkaufspreis: 30,– €.
Eine Software für Linux-User kann von der Homepage der Digitalen Bibliothek heruntergeladen werden.
Prinz Eisenherz – Die ersten Jahre
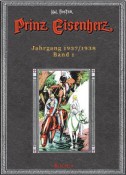 Im Jahr 1937 erschienen die ersten Seiten einer Comic-Serie, die sich bis heute in ihrer Besonderheit erhalten hat. Erzählt werden seit nun beinahe 70 Jahren die Abenteuer von Prinz Valiant – in der deutschen Ausgabe Prinz Eisenherz –, einer Figur, die der Zeichner und Autor der Serie, Hal Foster, in den Mythenkreis um den Hof von König Artus in Camelot hineinerfunden hat. Eine neue Gesamtausgabe des Fosterschen »Eisenherz« bei Bocola liefert im ersten Band in ansprechender Druckqualität die farbigen Originale der beiden ersten Jahrgänge zusammen mit einer deutschen Übersetzung.
Im Jahr 1937 erschienen die ersten Seiten einer Comic-Serie, die sich bis heute in ihrer Besonderheit erhalten hat. Erzählt werden seit nun beinahe 70 Jahren die Abenteuer von Prinz Valiant – in der deutschen Ausgabe Prinz Eisenherz –, einer Figur, die der Zeichner und Autor der Serie, Hal Foster, in den Mythenkreis um den Hof von König Artus in Camelot hineinerfunden hat. Eine neue Gesamtausgabe des Fosterschen »Eisenherz« bei Bocola liefert im ersten Band in ansprechender Druckqualität die farbigen Originale der beiden ersten Jahrgänge zusammen mit einer deutschen Übersetzung.
Was »Prinz Eisenherz« so besonders machte und wahrscheinlich bis heute überleben ließ – die Reihe wird noch immer durch neue Abenteuer ergänzt! – sind wahrscheinlich zwei Eigenschaften: Zum einen die sorgfältigen Zeichnungen Fosters und zum anderen sein Humor.
Da »Prinz Eisenherz« nur einmal in der Woche mit einer kompletten großformatigen Seite erschien, konnte Foster 40 bis 50 Arbeitststunden für jede Seite inverstieren. Das ermöglichte ihm, einen sehr sorgfältigen und detailverliebten Zeichenstil zu pflegen, der die Serie aus der damaligen Comic-Produktion deutlich heraushob. Zum anderen hatte Foster genügend Zeit, sich mit den historischen Hintergründen seiner Geschichte auseinanderzusetzen.
Um keine Mißverständnisse aufkommen zu lassen: In Bezug auf das, was man über die Zeit des frühen Mittelalters in England weiß, ist Fosters »Prinz Eisenherz« in etwa so exakt wie jeder beliebige Ritterfilm aus Hollywood. Aber Foster war sich dieser Tatsache durchaus bewusst. Er musste sich den Erwartungen seiner Leser anpassen, die sich König Artus und seinen Hof im hochmittelalterlichen Kostüm vorstellten und einen Artus im Bärenfell, mit den Fragmenten einer römischen Rüstung angetan, einfach abgelehnt hätten. Also wird auch bei Foster Camelot ein idealer Hof des Hochmittelalters, so wie man ihn sich seit eben dieser Zeit immer und immer wieder ausgemalt hat. Aber darin eben hudelt Foster nicht, sondern wendet große Sorgfalt und Detailliebe für seinen Artushof und die Geschichte seines Prinzen auf.
Das andere aber ist Fosters Humor. Da »Prinz Eisenherz« von Anfang an als illustrierter Roman und nicht als Sprechblasen-Comic angelegt war, entwickelte Foster eine ganz eigene, leicht ironische Distanz zu seiner Erfindung. Er nimmt seine Helden in ihren großen Posen nie so ganz ernst, setzt auch die besten Ritter immer wieder einmal außer Gefecht und gibt Dummheit, Ungeschicklichkeit, Übermut und menschlicher Fehlerhaftigkeit ihren Raum. Zudem nutzt Foster die Möglichkeit, Bilder und Text, die ja beide aus seiner Feder stammen, einander spiegeln und widerspiegeln zu lassen. Das macht »Prinz Eisenherz« zu einem besonderen Comic, vielleicht dem frühesten Beispiel für einen Comic, der die Grenze zur ernstzunehmenden Literatur hin überschreitet.
Bocola hat nun den ersten Band einer auf 18 Bände angelegten Gesamtausgabe des Forsterschen »Prinz Eisenherz« vorgelegt. Der Band ist mit großer Sorgfalt zusammengestellt und durchgehend nach den Erstdrucken koloriert. Eröffnet wird er durch ein kluges und kenntnisreiches Vorwort von Wolfgang J. Fuchs. Band 1 umfasst die 98 Blätter der Jahre 1937 und 1938; Band 2 mit den Jahren 1939 und 1940 soll im Februar 2007 folgen.
Hal Foster Gesamtausgabe, Bd. 1: Prinz Eisenherz. Jahrgang 1937/1938. Bocola Verlag, 2006. Pappband, 32 cm hoch, fadengeheftet. 19,90 €.
Werner Fuld: Wilhelm Raabe
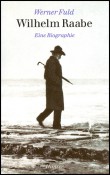 Wilhelm Raabe kann man heute zu den beinahe vergessenen Schriftstellern des 19. Jahrhunderts zählen. Zwar existiert noch eine umfassende Werkausgabe – die »Braunschweiger Ausgabe« –, und es sind noch erstaunlich zahlreiche Titel in Reclams Universal-Bibliothek lieferbar, aber einen Klassiker-Status hat Raabe nie wirklich erlangt. Vielleser schwärmen einander dann und wann von einem Titel aus dem Spätwerk vor – der »Stopfkuchen« und »Die Akten des Vogelsangs« nehmen hier eine hervorragende Stellung ein –, aber dennoch bleibt Raabe eine Randfigur. Dabei hat Thomas Mann noch viel von ihm gelernt – ohne die »Akten« wäre der »Doktor Faustus« wahrscheinlich ein ganz anderes Buch geworden – und Kurt Tucholsky soll die 18-bändige Raabe-Ausgabe bei Hermann Klemm in seinem Marschgepäck mit in den Großen Krieg geschleppt haben, der damals noch nicht Erster Weltkrieg hieß. Aber auch das scheint nicht wirklich geholfen zu haben.
Wilhelm Raabe kann man heute zu den beinahe vergessenen Schriftstellern des 19. Jahrhunderts zählen. Zwar existiert noch eine umfassende Werkausgabe – die »Braunschweiger Ausgabe« –, und es sind noch erstaunlich zahlreiche Titel in Reclams Universal-Bibliothek lieferbar, aber einen Klassiker-Status hat Raabe nie wirklich erlangt. Vielleser schwärmen einander dann und wann von einem Titel aus dem Spätwerk vor – der »Stopfkuchen« und »Die Akten des Vogelsangs« nehmen hier eine hervorragende Stellung ein –, aber dennoch bleibt Raabe eine Randfigur. Dabei hat Thomas Mann noch viel von ihm gelernt – ohne die »Akten« wäre der »Doktor Faustus« wahrscheinlich ein ganz anderes Buch geworden – und Kurt Tucholsky soll die 18-bändige Raabe-Ausgabe bei Hermann Klemm in seinem Marschgepäck mit in den Großen Krieg geschleppt haben, der damals noch nicht Erster Weltkrieg hieß. Aber auch das scheint nicht wirklich geholfen zu haben.
Die Biographie von Werner Fuld steht, soweit ich sehe, allein auf weiter Flur. Sie ist jetzt 13 Jahre alt, und es scheint nicht so, als würde sie in Kürze Konkurrenz bekommen. Fuld Lebensbeschreibung ist sorgfältig und basiert auf einer gründlichen Quellenarbeit. Was die Faktenlage und die grundsätzliche Darstellung von Leben und Werk angeht, scheint sie mir tadellos zu sein. Der strenggläubige Germanist könnte kritisieren, dass Fuld etwas zu oft dazu neigt, Figurenäußerungen aus Büchern Raabes als Selbstaussagen des Autors zu lesen, da sich aber alles in allem ein geschlossenes Gesamtbild ergibt, könnte diese Kritik auch schlicht ins Leere laufen. Bei all dem muss ich allerdings betonen, dass ich selbst alles andere als ein Raabe-Kenner bin.
Spannend ist Fulds These, der junge Raabe habe unter einer latenten Schizophrenie gelitten, die er mit Hilfe seines Schreibens therapiert habe. Fulds Belege dafür sind dünn, und wenn er in der weiteren Lebensbeschreibung immer wieder den inneren Zwiespalt Raabes zwischen seiner bürgerlichen Existenz und seinen künstlerischen Ansprüchen mit der These von der Raabeschen Schizophrenie in Zusammenhang bringt, handelt es sich dabei wohl um eine ein wenig leichtfertige Vermischung von sozialen und pathologischen Kategorien. Aber diese These steht keineswegs im Zentrum von Fulds Raabe-Biographie und kann vom Leser getrost ruhen gelassen werden.
Ein lesenswertes Buch und eine solide Einführung in das schriftstellerische Werk Wilhelm Raabes.
Werner Fuld: Wilhelm Raabe. Hanser Verlag, 1993. Leinen, fadengeheftet; 383 Seiten.
Lieferbare Ausgabe: dtv, 2006. ISBN: 3-423-34324-9. 15,00 €.
Richard P. Feynman: Was soll das alles?
 Drei Vorträge, die Richard Feynman 1963 als Gast an der University of Washington gehalten hat, und die 1998 aus dem Nachlass veröffentlicht wurden. Ihr englischer Übertitel »The Meaning of It All« macht das Missverhältnis von Anspruch und Ausführung noch krasser deutlich, als seine doppeldeutige deutsche Übersetzung.
Drei Vorträge, die Richard Feynman 1963 als Gast an der University of Washington gehalten hat, und die 1998 aus dem Nachlass veröffentlicht wurden. Ihr englischer Übertitel »The Meaning of It All« macht das Missverhältnis von Anspruch und Ausführung noch krasser deutlich, als seine doppeldeutige deutsche Übersetzung.
Der erste Vortrag beschäftigt sich mit »Ungewißheit in der Wissenschaft« und ist der einzige, dessen Lektüre man einigermaßen empfehlen kann. Feynman weist auf einem sehr populären Niveau auf die Notwendigkeit des Zweifels für alle wissenschaftliche Arbeit hin und darauf, dass die Grundeinsicht in die Vorläufigkeit aller Erkenntnis und die Unabgeschlossenheit des Forschungsprozesses Grundvoraussetzungen für eine erfolgreiche und produktive Wissenschaft sind.
Der zweite Vortrag beginnt mit unsystematischen Überlegungen dazu, inwieweit die Beschäftigung mit den Naturwissenschaften Einfluss auf die religiösen Gefühle eines Menschen hat, um dann völlig unvermittelt in eine Philippika gegen die Sowjetunion überzugehen.
Den dritte Vortrag beginnt Feynman mit dem Bekenntnis, das worüber er habe reden wollen, sei bereits gesagt. Daher sage er nun, was ihm sonst noch so einfalle, und er selbst gäbe nicht viel darauf, was nun folge. Da hatte er Recht! Der dritte Vortrag ist eine Gemengelage zumeist unverbundener Themen, zu denen Feynman mehr oder weniger Platitüden zum Besten gibt. Einzig die Bemerkungen zur Erhebung und wissenschaftlichen Relevanz von Stichproben sind von einigem Interesse.
Insgesamt ein enttäuschendes und überflüssiges Buch und eine typische Nachlassveröffentlichung, von deren Lektüre fast ausnahmslos abgeraten werden kann. Das wenige Interessante, das zu finden ist, lässt sich anderswo ebensogut und besser finden.
Feynman, Richard P.: Was soll das alles? Gedanken eines Physikers
Piper, Sonderausgabe 2002. ISBN 3-492-04472-7
Gebunden – 153 Seiten – 9,90 Eur[D]
Richard P. Feynman: »Sie belieben wohl zu scherzen, Mr. Feynman!«
 Eine anekdotische Lebensgeschichte Feynmans, von ihm selbst erzählt. Seine wissenschaftliche Karriere kommt natürlich auch vor, aber eher in den äußerlichen Umständen, weniger in den zahlreichen herausragenden Entdeckungen, die Feynman im Verlauf seines Lebens gemacht hat. Das Buch ist amüsant, hier und da etwas selbstgefällig, was mich aber nicht wirklich gestört hat, eine nette Lektüre. Feymans Leben erweist sich als äußerst vielfältig und reichhaltig: Schon früh autodidaktisch an Mathematik interessiert, beschäftigt er sich mit allen drei großen Naturwissenschaften, studiert nicht nur Physik, sondern hospitiert auch in der Chemie und Biologie, und landet schließlich als Theoretiker im Team um Oppenheimer in Los Alamos. Dort betätigt er sich umfänglich als Safeknacker – auch dies hauptsächlich Zeugnis seiner unstillbaren, eigenwilligen Neugier, die ihn dazu geführt hat, sich im Laufe seines Lebens mit sehr unterschiedlichen Themen zu beschäftigen. Feynman ist dabei von erfrischender Offenheit und Ehrlichkeit, zögert auch nicht, die Grenzen seines Verständnisses sichtbar werden zu lassen.
Eine anekdotische Lebensgeschichte Feynmans, von ihm selbst erzählt. Seine wissenschaftliche Karriere kommt natürlich auch vor, aber eher in den äußerlichen Umständen, weniger in den zahlreichen herausragenden Entdeckungen, die Feynman im Verlauf seines Lebens gemacht hat. Das Buch ist amüsant, hier und da etwas selbstgefällig, was mich aber nicht wirklich gestört hat, eine nette Lektüre. Feymans Leben erweist sich als äußerst vielfältig und reichhaltig: Schon früh autodidaktisch an Mathematik interessiert, beschäftigt er sich mit allen drei großen Naturwissenschaften, studiert nicht nur Physik, sondern hospitiert auch in der Chemie und Biologie, und landet schließlich als Theoretiker im Team um Oppenheimer in Los Alamos. Dort betätigt er sich umfänglich als Safeknacker – auch dies hauptsächlich Zeugnis seiner unstillbaren, eigenwilligen Neugier, die ihn dazu geführt hat, sich im Laufe seines Lebens mit sehr unterschiedlichen Themen zu beschäftigen. Feynman ist dabei von erfrischender Offenheit und Ehrlichkeit, zögert auch nicht, die Grenzen seines Verständnisses sichtbar werden zu lassen.
Was man bedauern könnte, ist, dass Feynman mit allem was er erzählt, den Bereich des Privaten kaum verlässt: Politik und erfahrene Historie kommen so gut wie gar nicht vor, Begegnungen mit anderen Physikern nur am Rande etc. Man sollte also keine »Erinnerungen« oder »Bekenntnisse« in diesem Band voller »Abenteuer« erwarten.
Feynmans Anekdotensammlung ist ganz unabhängig davon, ob man sich für Physik oder die Naturwissenschaften überhaupt interessiert, eine sehr kurzweilige, wenn auch letztendlich etwas belanglose Lektüre.
Feynman, Richard P.: »Sie belieben wohl zu scherzen, Mr. Feynman!« Abenteuer eines neugierigen Physikers
Piper, Sonderausgabe 2005. ISBN 3-492-04726-2
Gebunden – 464 Seiten – 14,90 Eur[D]
Richard P. Feynman: Sechs physikalische Fingerübungen
 Laut Vorwort des amerikanischen Originalverlages handelt es sich bei dem Buch um die »sechs einfachsten Kapitel« der »Lectures on Physics«, die unter den Einführungen für Physikstudenten eine Art Kultstatus inne haben. Dass die Originalausgabe dieser Auswahl 1995 erschienen ist, also 30 Jahre nachdem Feynman den Physik-Nobelpreis erhalten hat, zeugt von der ungebrochenen Popularität, die er in den Vereinigten Staaten besitzt. Es gibt zahlreiche Zeugnisse dafür, dass Feynman als akademischer Lehrer und als Persönlichkeit zahlreiche Menschen beeinflusst und tief beeindruckt hat.
Laut Vorwort des amerikanischen Originalverlages handelt es sich bei dem Buch um die »sechs einfachsten Kapitel« der »Lectures on Physics«, die unter den Einführungen für Physikstudenten eine Art Kultstatus inne haben. Dass die Originalausgabe dieser Auswahl 1995 erschienen ist, also 30 Jahre nachdem Feynman den Physik-Nobelpreis erhalten hat, zeugt von der ungebrochenen Popularität, die er in den Vereinigten Staaten besitzt. Es gibt zahlreiche Zeugnisse dafür, dass Feynman als akademischer Lehrer und als Persönlichkeit zahlreiche Menschen beeinflusst und tief beeindruckt hat.
Durch die Auswahl sind die Kapitel natürlich wenig miteinander verbunden und auch was den Anspruch an das Verständnis der Leser recht unterschiedlich. Das Büchlein beginnt mit einem Kapitel, das sich auf einem sehr allgemeinen Niveau mit der Tatsache auseinandersetzt, dass die Welt aus Atomen zusammengesetzt ist, es folgt ein Kapitel zur Entwicklung der Quanten- und Elementarteilchenphysik, eines zum Verhältnis der Physik zu anderen Naturwissenschaften – mit einem Schwerpunkt auf der Biologie, mit der sich Feynman im Laufe seiner wissenschaftlichen Karriere ebenfalls intensiver beschäftigt hat –, eines zum Energieerhaltungssatz, eines zur Gravitationstheorie und ein letztes, doch schon recht anspruchsvolles, zur Quantenmechanik und der Heisenbergschen Unschärferelation.
Für naturwissenschaftlich Interessierte, die ihre Schulphysik einmal wieder auffrischen und vielleicht auch etwas erweitern wollen, eine anregende und lohnende Lektüre. Für die allermeisten Nichtphysiker wird der eine oder andere anregende Gedanke oder neue Perspektive abfallen. Mir etwa ist nie zuvor die enge Abhängigkeit zwischen Quantenmechanik und der Unschärferelation auf so einfache und einleuchtende Art klar gemacht worden.
Feynman, Richard P.: Sechs physikalische Fingerübungen
Piper, Sonderausgabe 2004. ISBN 3-492-04665-7
Gebunden – 224 Seiten – 12,90 Eur[D]
Harry G. Frankfurt: Bullshit
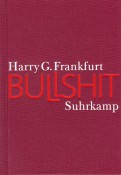 Eine sprachphilosophische Annäherung an den Begriff Bullshit, der – wie einige andere sprachliche Details – zum Glück unübersetzt bleibt. Nur der Titel ist etwas irreführend gewählt; das englische »On Bullshit« trifft den Inhalt des Büchleins genauer. Methodisch steht die Untersuchung Wittgensteins Spätphilosophie nahe, was sich aber in keiner Weise negativ auf die Verständlichkeit des Textes auswirkt. Insgesamt bestätigt der kurze Text wieder einmal das Vorurteil, dass der angelsächsischen Philosophie oft eine Leichtigkeit der Darstellung eigen ist, die in der deutschen Tradition nur selten erreicht wird. Der Autor nimmt weder sich, noch seinen Essay, noch sein Thema übermäßig ernst. Er schließt sich bewußt an eine Vorläuferuntersuchung an: Max Black: »The Prevalence of Humbug« (Ithaca, 1985). Frankfurts sprachphilosophische Reflexionen münden schließlich in einigen einfachen, aber treffenden Überlegungen zu Wahrheit und Lüge und inwieweit der Bullshitter in einem ambivalenten Verhältnis zu beiden steht. Von hier aus ließe sich die Untersuchung leicht in das Gebiet der klassischen Rhetorik und Philosophie verlängern, vielleicht beginnend mit Platons »Gorgias«.
Eine sprachphilosophische Annäherung an den Begriff Bullshit, der – wie einige andere sprachliche Details – zum Glück unübersetzt bleibt. Nur der Titel ist etwas irreführend gewählt; das englische »On Bullshit« trifft den Inhalt des Büchleins genauer. Methodisch steht die Untersuchung Wittgensteins Spätphilosophie nahe, was sich aber in keiner Weise negativ auf die Verständlichkeit des Textes auswirkt. Insgesamt bestätigt der kurze Text wieder einmal das Vorurteil, dass der angelsächsischen Philosophie oft eine Leichtigkeit der Darstellung eigen ist, die in der deutschen Tradition nur selten erreicht wird. Der Autor nimmt weder sich, noch seinen Essay, noch sein Thema übermäßig ernst. Er schließt sich bewußt an eine Vorläuferuntersuchung an: Max Black: »The Prevalence of Humbug« (Ithaca, 1985). Frankfurts sprachphilosophische Reflexionen münden schließlich in einigen einfachen, aber treffenden Überlegungen zu Wahrheit und Lüge und inwieweit der Bullshitter in einem ambivalenten Verhältnis zu beiden steht. Von hier aus ließe sich die Untersuchung leicht in das Gebiet der klassischen Rhetorik und Philosophie verlängern, vielleicht beginnend mit Platons »Gorgias«.
Am schönsten an der deutschen Ausgabe ist die Bauchbinde, mit der der Suhrkamp Verlag das Buch ausliefert:
Dies Zitat ist wahrscheinlich als praktische Übung für die Leser gedacht, denn nachdem man das Buch gelesen hat, weiß man mit einiger Sicherheit, was man schon geahnt hat: Bei diesem Satz handelt es sich um einen klassischen Fall von Bullshit, um so mehr wenn er als Werbeslogan gerade auf diesem Buch daherkommt.
Frankfurt, Harry G.: Bullshit
Suhrkamp, 2006. ISBN 3-518-58450-2
Leinen, gelumbeckt – 73 Seiten – 8,00 Eur[D]