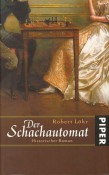Übrigens: Wussten Sie schon, dass die Alpen einen ganz erbärmlichen Anblick bieten, wenn man sich die Berge einmal wegdenkt?
Loriot
Kategorie: L
Allen Lesern ins Stammbuch (2)
Ein Buch ist ein Spiegel, wenn ein Affe hineinguckt, so kann freilich kein Apostel heraus sehen. Wir haben keine Worte mit dem Dummen von Weisheit zu sprechen. Der ist schon weise der den Weisen versteht.
Georg Christoph Lichtenberg
Sudelbücher (E 215)
Zum Welttag des Buches
Schreibt man denn Bücher bloß zum Lesen? oder nicht auch zum Unterlegen in die Haushaltung? Gegen eins, das durchgelesen wird, werden Tausende durchgeblättert, andere Tausend liegen stille, andere werden auf Mauslöcher gepreßt, nach Ratzen geworfen, auf andern wird gestanden, gesessen, getrommelt, Pfefferkuchen gebacken, mit andern werden Pfeifen angesteckt, hinter dem Fenster damit gestanden.
Georg Christoph Lichtenberg
Sudelbücher (E 311)
Deutsche Geschichte
 Die Digitale Bibliothek hat ihr ohnehin schon breites Angebot an elektronischen Werken zur Geschichte um die 10 grundlegenden Bände der »Deutschen Geschichte« aus dem Verlag Vandenhoeck & Ruprecht ergänzt. Diese Bände gehören seit Jahrzehnten zur studentischen Grundaustattung der meisten Historiker und decken die deutsche Geschichte von den Anfängen bis zum Jahr 1945 ab. Die CD-ROM enthält die vollständigen Texte aller Bände mit zusammen etwa 2.500 Buchseiten in den aktuellen, derzeit lieferbaren Auflagen zu einem unschlagbaren Preis.
Die Digitale Bibliothek hat ihr ohnehin schon breites Angebot an elektronischen Werken zur Geschichte um die 10 grundlegenden Bände der »Deutschen Geschichte« aus dem Verlag Vandenhoeck & Ruprecht ergänzt. Diese Bände gehören seit Jahrzehnten zur studentischen Grundaustattung der meisten Historiker und decken die deutsche Geschichte von den Anfängen bis zum Jahr 1945 ab. Die CD-ROM enthält die vollständigen Texte aller Bände mit zusammen etwa 2.500 Buchseiten in den aktuellen, derzeit lieferbaren Auflagen zu einem unschlagbaren Preis.
Highlight der Buchreihe war und ist mit Sicherheit Band 9, Hans-Ulrich Wehlers »Das Deutsche Kaiserreich 1871–1918«, der für das historische Verständnis dieser Zeit Maßstäbe gesetzt hat:
Über zwei Jahrzehnte lang hieß es an historischen Seminaren deutscher Universitäten ehrführchtig nur ›das blaue Buch‹. Niemand, der sich auf akademische Weise mit neuerer deutscher Vergangenheit beschäftigen wollte, kam daran vorbei. […] Mit dem ›blauen Buch‹ vollzog Wehler den vielleicht folgenreichsten Paradigmenwechsel in der (alt-)bundesrepublikanischen Geschichtswissenschaft […].
Sven Felix Kellerhoff, Die Welt
Zu dem Preisvorteil von knapp 80,– € kommen die üblichen Vorteile von Ausgaben der Digitalen Bibliothek hinzu: Eine ausgereifte, professionelle Software, die Volltextsuche, Paste & Copy auch längerer Passagen (mit exakter Seitenreferenz zur gedruckten Ausgabe), Lesezeichen, farbliche Textmarkierungen, das Ablegen von Notizen und Ausdrucke in individueller Formatierung erlaubt; dies ermöglicht ein intensives und zeitsparendes Arbeiten mit den Texten. Zusätzlich verfügt die elektronische Ausgabe über ein Gesamtregister der in allen Bänden verwendeten Abkürzungen. Diese CD-ROM ist auch geeignet, um eventuell bereits vorhandene Einzelbände der Reihe zu ergänzen.
Deutsche Geschichte. Hg. v. Joachim Leuschner. Digitale Bibliothek Band 151. Berlin: Directmedia Publishing in Kooperation mit Vandenhoeck & Ruprecht, 2006. 1 CD-ROM. Systemvoraussetzungen: PC ab 486; 32 MB RAM; Grafikkarte ab 640×480 Pixel, 256 Farben; CD-ROM-Laufwerk; MS Windows (98, ME, NT, 2000 oder XP) oder MAC ab MacOS 10.3; 128 MB RAM; CD-ROM-Laufwerk. Empfohlener Verkaufspreis: 30,– €.
Eine Software für Linux-User kann von der Homepage der Digitalen Bibliothek heruntergeladen werden.
Eine dumme Geschichte
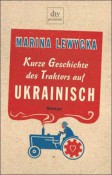 Wieder einmal habe ich mich durch einen originellen Titel auf der Bestsellerliste verführen lassen: Kurze Geschichte des Traktors auf Ukrainisch ist verführerisch, leider ist es auch schon das Originellste am ganzen Buch! Marina Lewycka erzählt die Geschichte einer »späten Liebe«: Der 84-jährige, verwitwete Nikolai Majevski, gebürtiger Ukrainer, ehemaliger Ingenieur und nach dem Zweiten Weltkrieg englischer Staatsbürger geworden, verliebt sich in eine 36-jährige Ukrainerin Valentina, die sich von ihrem ukrainischen Ehemann, mit dem sie einen Sohn hat, scheiden lässt, um Nikolai zu heiraten. Offensichtlich hat es Valentina auf einen Tausch abgesehen: Sie prostituiert sich ein wenig und erhält im Gegenzug dafür einen – in ihren Augen – begüterten Ehemann und die englische Staatsbürgerschaft für ihren Sohn und sich. Soweit ist das nichts besonderes.
Wieder einmal habe ich mich durch einen originellen Titel auf der Bestsellerliste verführen lassen: Kurze Geschichte des Traktors auf Ukrainisch ist verführerisch, leider ist es auch schon das Originellste am ganzen Buch! Marina Lewycka erzählt die Geschichte einer »späten Liebe«: Der 84-jährige, verwitwete Nikolai Majevski, gebürtiger Ukrainer, ehemaliger Ingenieur und nach dem Zweiten Weltkrieg englischer Staatsbürger geworden, verliebt sich in eine 36-jährige Ukrainerin Valentina, die sich von ihrem ukrainischen Ehemann, mit dem sie einen Sohn hat, scheiden lässt, um Nikolai zu heiraten. Offensichtlich hat es Valentina auf einen Tausch abgesehen: Sie prostituiert sich ein wenig und erhält im Gegenzug dafür einen – in ihren Augen – begüterten Ehemann und die englische Staatsbürgerschaft für ihren Sohn und sich. Soweit ist das nichts besonderes.
Erzählt wird die Geschichte durch Nadia, eine der beiden Töchter Nikolais, die sich nach anfänglichem Zögern mit ihrer Schwester Vera verbündet, um der neuen Ehe ihres Vaters ein rasches Ende zu bereiten. Die beiden Schwestern intrigieren, so gut sie können; Valentinas ungezügelter Egoismus tut das seine dazu, und das schließliche Auftauchen von Valentinas Ex-Ehemann, der als Deus ex machina nach einigen belanglosen Verwicklungen Valentina und ihren Sohn wieder mit sich zurück in die Ukraine nimmt, lässt alles »ein gutes Ende« nehmen.
Bis hierhin möchte das alles einigermaßen angehen und einen halbwegs akzeptablen Unterhaltungsroman abgeben. Was das Buch über weite Strecken ungenießbar macht, ist die rücksichtslose Verwendung von Klischees durch die Autorin. Am schlimmsten trifft es Valentina, der keine Dummheit erspart wird, kein menschlich-sympatischer Zug auch nur für einen einzigen Moment gegönnt wird. Das Peinlichste am Buch aber ist, dass der durchgespielte Konflikt durch den uneingeschränkten »Sieg« der beiden Schwestern über die unerwünschte Rivalin aufgelöst wird. Valentina erscheint als Täterin, die schließlich ihre gerechte Strafe erhält: Autorin, Erzählerin und Figuren geben sie der Lächerlichkeit preis, die sie selbst ihr zugeschrieben haben. Das ist so plan und einfallslos, zugleich so unmenschlich und selbstgerecht wie ein Buch nur sein kann. Leider überlagert diese Dummheit des Textes all das, was hätte gelingen können: Den Versuch der Tochter, sich in die Lebensgeschichte ihrer Eltern einzufühlen, die Versöhnung der Schwestern miteinander, die durch die gemeinsame Opposition gegen Valentina eingeleitet wird, das aus Naivität und schmerzlicher Erinnerung gespeiste Buch Nikolais über die Geschichte des Traktors und schließlich auch jeden Hauch von Humor, den das Buch vielleicht hätte haben können.
Marina Lewycka: Kurze Geschichte des Traktors auf Ukrainisch. Deutscher Taschenbuch Verlag, 2006. Broschur, 359 Seiten. 14,– €.
David Lodge: Autor, Autor
 David Lodge, englischer Literaturwissenschaftler und Schriftsteller, hat sein neues Buch einem Klassiker der englischsprachigen Literatur gewidmet: Es erzählt die Lebensgeschichte des amerikanischen Autors Henry James (1843–1916). Doch »Autor, Autor« ist keine Biografie, sondern ein Roman, der sich aber in nahezu allen Details an die Tatsachen hält.
David Lodge, englischer Literaturwissenschaftler und Schriftsteller, hat sein neues Buch einem Klassiker der englischsprachigen Literatur gewidmet: Es erzählt die Lebensgeschichte des amerikanischen Autors Henry James (1843–1916). Doch »Autor, Autor« ist keine Biografie, sondern ein Roman, der sich aber in nahezu allen Details an die Tatsachen hält.
Henry James hat heute in der englischsprachigen Welt in etwa den Status, den Theodor Fontane in der deutschsprachigen Literatur einnimmt: eine der wichtigen Stationen auf dem Weg zum modernen Roman. Das war aber nicht immer so. David Lodge konzentriert sich im Hauptteil seines Buches auf eine Zeit der Krise im Leben von Henry James, der seit Ende 1876 hauptsächlich in London lebte. Ende der 1880er Jahre ist sein Ruhm als Autor im Schwinden begriffen, der Absatz seiner Bücher geht von Jahr zu Jahr zurück und James sieht sich auf lange Sicht einer ernsthaften finanziellen Notlage gegenüber.
Da kommt es ihm gerade recht, dass er Ende 1888 die Anfrage einer englischen Theatertruppe bekommt, die ihn bittet, seinen Roman »Der Amerikaner« zu einem Theaterstück umzuarbeiten. Nach anfänglichem Zögern begreift James dieses Angebot als Chance, seine finanzielle Lage dauerhaft abzusichern. Er geht nicht nur auf das Angebot ein, sondern entwirft zugleich den Plan, eine Karriere als Bühnenautor zu beginnen. Erst nach mehr als fünf Jahren wird James die Fruchtlosigkeit seiner Versuche endgültig einsehen. Lodge beschreibt die Hoffnungen, Anstrengungen, Erfolge und Niederlagen, die James in diesen Jahren durchlebt, mit großer Sensibilität und Empathie.
Begleitet wird die Erzählung dieser Lebensphase von der Darstellung zweier wichtiger Freundschaften mit anderen Autoren: George du Maurier (dem Großvater von Daphne du Maurier), eigentlich Zeichner, der 1894 mit seinem Roman »Trilby« einen Megaseller schreibt, und Constance Fenimore Woolson, der Frau, die dem lebenslang keuschen Henry James wohl am nächsten stand; auch sie war als Autorin kommerziell wesentlich erfolgreicher als James.
Dieser Hauptteil wird durch die Erzählung der letzten Wochen gerahmt, die Henry James durchlebt: Seinem langsamen geistigen Verfall nach einem Schlaganfall, der Ehrung durch das englische Königshaus mit dem Order of Merit, seinem Tod und schließlich einem Ausblick auf seinen Nachruhm, der in der englischsprachigen Welt bis heute anhält.
Lodges »Autor, Autor« ist ein ruhig und sorgfältig erzählter Roman, was seinem Inhalt auch ganz angemessen ist. An einer Stelle macht sich Lodge beinahe ein wenig lustig über Henry James und zugleich über sich selbst:
Das Thema […] war reizvoll, aber er gab bereitwillig zu, daß der Roman mit zu vielen Kommentaren behaftet und im Tempo zu gemächlich war. [S. 137]
Doch wer ein wenig Geduld für das Buch aufbringt und sich für Schriftsteller und das späte 19. Jahrhundert interessiert, sollte »Autor, Autor« auf jeden Fall lesen.
David Lodge: Autor, Autor. Gerd Haffmans bei Zweitausendeins, 2006. Fadenheftung; 544 Seiten. 17,90 €.
Thomas Lehr: 42
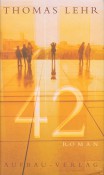 Erzählt wird die Geschichte von Adrian Haffner, einem Münchner Journalisten, der zusammen mit einer größeren Besuchergruppe einen Detektor des Kernforschungszentrums CERN besichtigt und bei seiner Rückkehr an die Erdoberfläche zusammen mit 70 anderen Chronifizierten feststellen muss, dass derweil die Zeit stehengeblieben ist. Nur für die besagten 70 existiert die Zeit in ihrer nächsten Umgebung weiter, sie tragen eine Chronosphäre um sich herum; das ganze übrige Universum steht still. Man kann sich denken, dass dies einige Verwirrung auslöst. So ist dann der Roman auch geworden.
Erzählt wird die Geschichte von Adrian Haffner, einem Münchner Journalisten, der zusammen mit einer größeren Besuchergruppe einen Detektor des Kernforschungszentrums CERN besichtigt und bei seiner Rückkehr an die Erdoberfläche zusammen mit 70 anderen Chronifizierten feststellen muss, dass derweil die Zeit stehengeblieben ist. Nur für die besagten 70 existiert die Zeit in ihrer nächsten Umgebung weiter, sie tragen eine Chronosphäre um sich herum; das ganze übrige Universum steht still. Man kann sich denken, dass dies einige Verwirrung auslöst. So ist dann der Roman auch geworden.
»42« gehört nicht zu der Sorte von Büchern, die ich normalerweise lese; ich bin mir auch nicht sicher, ob es überhaupt zu einer Sorte von Büchern gehört, aber es mag sein, dass dort draußen inzwischen eine neue Art von Literatur existiert, mit der ich hier erstmalig in Berührung gekommen bin. Das erstaunlichste an dem Buch war für mich die nahezu komplette Weltlosigkeit des Textes, anders gesagt: Das ganze Buch, seine Handlung, seine Gespräche, seine Figuren sind vollständig dem Kopf des Autors entsprungen. Dass reale Orte wie Genf, Zürich, München, Berlin oder Florenz im Buch vorkommen, ist gänzlich zufällig und gleichgültig; wichtig an diesen Orten ist auch nicht ihr Da- oder So-sein, sondern nur ihre Entfernung voneinander, die der Ich-Erzähler zu Fuß zurücklegt, damit er überhaupt irgendetwas zu tun hat außer die ewig gleichen wirren Gedankengänge zu Papier zu bringen.
Das Buch hat insgesamt wenig zu erzählen, viel zu wenig für die 368 Seiten, die der Autor letztendlich gefüllt hat. Es verbreitet daher über weite Strecken die fürchterlichste Langeweile: Immer erneut wird beschrieben, wie irgendwelche als »Fuzzis« bezeichneten Menschen regungslos irgendwo herumstehen, wie sich das sich nicht verändernde Licht nicht verändert und die gleichbleibende Hitze gleich bleibt. Zwischendurch ein, zwei sexistische Phantasien und dann geht es mit der nächsten wirren Reflexionskaskade weiter. Und was vielleicht das schrecklichste ist: Das Buch ist weitgehend humorfrei – »die Nullzeit ist ernst.« [S. 191]
Sehr merkwürdig erscheint mir allerdings, dass der Autor sich die Mühe macht, seinen doch recht dünnen Phantasieanlass – die Zeit bleibt stehen und nur einige wenige Menschen sind nicht betroffen – überhaupt mit einer pseudonaturwissenschaftlichen Rahmung zu versehen, da er selbst recht bald einsehen muss, dass es auch nicht den Hauch einer möglichen wissenschaftlichen Erklärung für das phantasierte Ereignis geben könnte. Ob nun CERN oder ein falsch montierter Haushaltsmixer die Katastrophe verursacht haben soll, ist für das Buch völlig unerheblich. Am merkwürdigsten dann schließlich das gänzlich unsinnige Geschwurbel, mit dem das Buch endet und das noch weniger einleuchtend wäre als alles Vorangegangene, wenn das denn überhaupt möglich wäre. Aber ich will nicht zu viel verraten!
Nur an einer Stelle hat mir der Autor so recht aus dem Herzen gesprochen: »Mir ist völlig rätselhaft und auch ziemlich gleichgültig, weshalb er ausgerechnet mir etwas anvertrauen möchte« [S. 336].
Lehr, Thomas: 42
Aufbau-Vlg, 2005. ISBN 3-351-03042-8
Gebunden – 368 Seiten – 21,5 × 12,5 cm – 22,90 Eur[D]
Gert Loschütz: Dunkle Gesellschaft
 Ein ungewöhnliches Buch, auf das ich über die Shortlist des Deutschen Buchpreises gestoßen bin.
Ein ungewöhnliches Buch, auf das ich über die Shortlist des Deutschen Buchpreises gestoßen bin.
Loschütz arbeitet mit dem bewährten Muster von Rahmen- und Binnenerzählungen: In der Rahmenhandlung lebt der Erzähler und Protagonist Thomas in einem kleinen Dorf, das er in nächtlichen Spaziergängen erkundet. Beherrschendes Element des Rahmens ist der kontinuierliche Regen, der schließlich in einer Flutkatastrophe kulminiert, aus der der Erzähler mit den anderen Bewohnern des Dorfes in ein Flüchtlingslager gerettet wird. Während seiner nächtlichen Gänge durchs Dorf erinnert sich der Erzähler an zehn Episoden aus seinem bewegten Leben, beginnend mit seiner Ausbildung zum Schiffskapitän in der Nähe von London, über unterschiedlichste Beschäftigungen auf diversen Schiffen und an unterschiedlichen Orten bis hin zur Affäre mit einer Nachbarin in dem Dorf, das schließlich überflutet wird.
Allen zehn Binnenerzählungen ist gemeinsam, dass sie rätselhafte Elemente enthalten: Phantastisches, Unheimliches, Ominöses, Traumhaftes – jede Erzählung präsentiert eine andere Spielart des Mysteriösen. Keines dieser Elemente wird aufgelöst, keine der Episoden wird erklärt oder erklärt eine andere. Verbunden sind sie bloß als Erinnerungen des Erzählers und Protagonisten; eigentlich kann der Leser nicht einmal sicher sein, dass es sich tatsächlich in allen Details um Erinnerungen handelt und nicht um Phantasien, die die Erinnerungen überlagern.
Ich muss zugeben, dass mir Literatur dieser Art nicht sehr liegt; ich habe eine Abneigung gegen Erzählungen, die aus dem Umbestimmten und Undeutlichen versuchen, Stimmungen zu erzeugen und damit einen Mangel an konkreten Inhalten, an Handlung und Gedanken zu überspielen. Aber dieser erste Eindruck (wahrscheinlich genährt aus meinem Vorurteil) hat sich im Laufe der Lektüre verloren, was auch daran liegen mag, dass die Variation von Stimmungen, Motiven und Erzählton in den Binnenerzählungen und die immer detaillierter werdende Rahmenerzählungen eine gelungene Mischung von Abwechslung und Kontinuität bilden.
Wie gesagt: Ein ungewöhnliches Buch, das im Laufe der Lektüre gewinnt und dem man deshalb einige Seiten mehr als gewöhnlich Kredit einräumen sollte, falls es einen nicht gleich zu Anfang packt.
Loschütz, Gert: Dunkle Gesellschaft. Roman in zehn Regennächten
FVA, 2005; ISBN 3-627-00129-X
Gebunden
219 Seiten – 19,90 Eur[D]