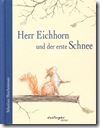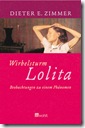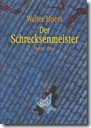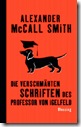Bereits im letzten Jahr ist Michael Maars Solus Rex erschienen. Der Titel ist der eines Romanfragments Nabokovs aus dem Jahr 1939, zugleich aber auch der Name einer bestimmten Art von Schachproblem, bei der ein schwarzer König allein einer weißen Armee gegenübersteht. Aber der Leser braucht sich keine Sorgen zu machen: Außer bei dieser einen Erklärung kommt Nabokov als Schachspieler und Problemkomponist in diesem Buch nicht vor.
Bereits im letzten Jahr ist Michael Maars Solus Rex erschienen. Der Titel ist der eines Romanfragments Nabokovs aus dem Jahr 1939, zugleich aber auch der Name einer bestimmten Art von Schachproblem, bei der ein schwarzer König allein einer weißen Armee gegenübersteht. Aber der Leser braucht sich keine Sorgen zu machen: Außer bei dieser einen Erklärung kommt Nabokov als Schachspieler und Problemkomponist in diesem Buch nicht vor.
Maar ist einer breiteren Öffentlichkeit bekannt geworden, als er im März 2004 unter großer öffentlicher Anteilnahme die Entdeckung einer mutmaßlichen Anregung zu Nabokovs Roman Lolita publizierte. Maar hat später in seinem Büchlein Lolita und der deutsche Leutnant versucht, dass dadurch provozierte Missverständnis wieder gerade zu rücken, was ihm aber wahrscheinlich eher nicht gelungen ist.
Solus Rex ist ein motivisch lockerer Gang durch das erzählerische Werk Nabokovs, wobei Maar Themen behandelt wie etwa Nabokovs Auseinandersetzung mit Thomas Mann – wobei die Erzählung Der Kartoffelelf als Antwort auf Manns Der kleine Herr Friedemann gelesen wird –, seine Homophobie und das daraus resultierende zuerst schwierige, dann schuldbeladene Verhältnis zu seinem Bruder, das Auftauchen von Geistern im Werk und anderes mehr. Es werden zahlreiche motivische Verbindungen innerhalb des Werks und zu zahlreichen anderen Schriftstellern gezogen, und es ist durchaus vergnüglich dieser Schlenderei zu folgen. Wie erschließend und hilfreich das alles am Ende ist, wird sich nur demjenigen eröffnen, der selbst bereit ist, die Originale gründlich zu studieren und sich auf die eigentümliche Welt Nabokovs einzulassen. Nabokov ist nun einmal kein Autor für eine Lektüre en passant.
Der Leser sollte also keine Biografie oder systematische Einführung in das Werk Nabokovs erwarten, sondern sich mit einem interessanten, aber essayistischen Zugriff zufrieden geben können.
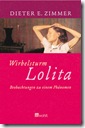 Dieter E. Zimmer ist als sein langjähriger Übersetzer und Herausgeber der Werkausgabe bei Rowohlt sicher einer der besten deutschen Kenner Nabokovs, wenn nicht der beste. Sein gerade erschienenes Buch Wirbelsturm Lolita beleuchtet dieses Hauptwerk Nabokovs aus verschiedenen Blickwinkeln: Publikationsgeschichte, Übersetzungen, die Frage nach dem vorgeblich pornografischen oder unmoralischen Charakter des Buches, aber auch zahlreiche inhaltliche Aspekte werden unprätentiös und frei von jedem literaturwissenschaftlichen Jargon spannend und gut lesbar präsentiert. Dabei hat nicht jedes Kapitel das gleiche Gewicht: So mag man Zimmers Reflexionen über die verschiedenen Schutzumschläge nicht in jedem Urteil nachvollziehen wollen oder den Bericht über die detektivische Arbeit, die nötig war, Humbert Humberts Fahrtroute in allen Details zu klären, für weniger gehaltvoll halten als deren Ergebnisse. Insgesamt aber ergibt sich ein hochinteressantes thematisches Panorama, das zahlreiche Missverständnisse über dieses wichtige Buch gerade rückt und entscheidende Hinweise zu seinem Verständnis gibt. Kennern wird der Band wahrscheinlich nur hier und da Neues bringen – so etwa die Geschichte der deutschen Übersetzung –, aber jedem, der einen Einstieg zu Nabokov sucht, sei die Lektüre dieses Buches dringend empfohlen! Oder, um es einmal mehr mit Lichtenberg zu sagen:
Dieter E. Zimmer ist als sein langjähriger Übersetzer und Herausgeber der Werkausgabe bei Rowohlt sicher einer der besten deutschen Kenner Nabokovs, wenn nicht der beste. Sein gerade erschienenes Buch Wirbelsturm Lolita beleuchtet dieses Hauptwerk Nabokovs aus verschiedenen Blickwinkeln: Publikationsgeschichte, Übersetzungen, die Frage nach dem vorgeblich pornografischen oder unmoralischen Charakter des Buches, aber auch zahlreiche inhaltliche Aspekte werden unprätentiös und frei von jedem literaturwissenschaftlichen Jargon spannend und gut lesbar präsentiert. Dabei hat nicht jedes Kapitel das gleiche Gewicht: So mag man Zimmers Reflexionen über die verschiedenen Schutzumschläge nicht in jedem Urteil nachvollziehen wollen oder den Bericht über die detektivische Arbeit, die nötig war, Humbert Humberts Fahrtroute in allen Details zu klären, für weniger gehaltvoll halten als deren Ergebnisse. Insgesamt aber ergibt sich ein hochinteressantes thematisches Panorama, das zahlreiche Missverständnisse über dieses wichtige Buch gerade rückt und entscheidende Hinweise zu seinem Verständnis gibt. Kennern wird der Band wahrscheinlich nur hier und da Neues bringen – so etwa die Geschichte der deutschen Übersetzung –, aber jedem, der einen Einstieg zu Nabokov sucht, sei die Lektüre dieses Buches dringend empfohlen! Oder, um es einmal mehr mit Lichtenberg zu sagen:
Wer zwei Paar Hosen hat, mache eins zu Geld und schaffe sich dieses Buch an.
In diesem Sinne könnte es sich bei Zimmers Buch um die wichtigste deutschsprachige Sekundär-Veröffentlichung zu Lolita überhaupt handeln, aber es steht zu befürchten, dass die Deutschen Zimmers Buch noch viel weniger lesen werden, als sie bereit sind, dem Original eine sorgfältige und verständige Lektüre angedeihen zu lassen. Wahrscheinlich wird Zimmers Buch als Merkstein des breiten – und nicht nur deutschen – Unverständnisses für dieses Meisterwerk stehen bleiben.
Nabokov sind mehr und immer bessere Leser überall auf der Welt zu wünschen, und Zimmers Buch ist die derzeit beste deutsche Werbeschrift für Buch und Autor. Vielleicht, wenn Rowohlt sich noch entschließen könnte, zum 50. Jubiläum der deutschen Ausgabe von Lolita auch die Biografie von Bryan Boyd im Taschenbuch erscheinen zu lassen, dass es in Deutschland zu einer breiten Wertschätzung des Meisters käme. Es wäre allmählich an der Zeit …
Michael Maar: Solus Rex. Die schöne böse Welt des Vladimir Nabokov. Berlin: Berlin Verlag, 2007. Pappband mit Lesebändchen, 205 Seiten. 22,– €.
Dieter E. Zimmer: Wirbelsturm Lolita. Auskünfte zu einem epochalen Roman. Reinbek: Rowohlt, 2008. Pappband mit Lesebändchen, bedruckte Vorsätze, 222 Text- + 24 Bildseiten mit zahlreichen farbigen Abbildungen. 19,90 €.
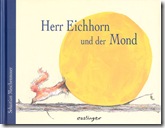 Wie versprochen, hier der Hinweis auf die erste Geschichte vom Herrn Eichhorn und seinen Freuden. Herr Eichhorn hat das Problem, dass er eines Tages vor seiner Wohnung den Mond findet, der direkt vom Himmel gefallen zu sein scheint. Herr Eichhorn macht sich große Sorgen, dass er beschuldigt werden könnte, den Mond gestohlen zu haben und versucht deshalb, ihn möglichst rasch los zu werden. Man kann sich denken, dass das nicht so einfach ist, besonders weil auch der Igel und der Bock und schließlich auch noch eine Gruppe von Mäusen in die Affäre verwickelt werden – wonach sich der Mond, offen gesprochen, in keinem guten Zustand mehr befindet. Mehr soll hier nicht verraten werden; aber das Buch wird ebenso wie Herr Eichhorn und der erste Schnee dringend zur Lektüre empfohlen.
Wie versprochen, hier der Hinweis auf die erste Geschichte vom Herrn Eichhorn und seinen Freuden. Herr Eichhorn hat das Problem, dass er eines Tages vor seiner Wohnung den Mond findet, der direkt vom Himmel gefallen zu sein scheint. Herr Eichhorn macht sich große Sorgen, dass er beschuldigt werden könnte, den Mond gestohlen zu haben und versucht deshalb, ihn möglichst rasch los zu werden. Man kann sich denken, dass das nicht so einfach ist, besonders weil auch der Igel und der Bock und schließlich auch noch eine Gruppe von Mäusen in die Affäre verwickelt werden – wonach sich der Mond, offen gesprochen, in keinem guten Zustand mehr befindet. Mehr soll hier nicht verraten werden; aber das Buch wird ebenso wie Herr Eichhorn und der erste Schnee dringend zur Lektüre empfohlen.