Der »Kodex« (diese Bezeichnung findet man zum erstenmal bei Bassett in seinem monumentalen De Selby Compendium) ist eine Sammlung von etwa zweitausend Seiten Kanzleipapier, beidseitig eng mit der Hand beschrieben. Auffälligstes Merkmal des Manuskripts ist der Umstand, daß kein Wort der Schrift lesbar ist. Versuche verschiedener Kommentatoren, gewisse Passagen, die weniger furchterregend erschienen, zu entziffern, waren durch phantastische Meinungsverschiedenheiten gekennzeichnet, die sich nicht an der Bedeutung der Passagen entzündeten (die ohnehin nicht zur Debatte stand), sondern an dem blühenden Unsinn, der sich dabei entfaltete. Eine Passage, von Bassett als »eindringliches Traktat über das Alter« beschrieben, wird von Henderson (dem Biograph Bassetts) als »eine durchaus reizvolle Beschreibung des Lämmerwerfens auf einem nicht näher bezeichneten Bauernhof« erwähnt. Solche Widersprüche tragen, ich muß es gestehen, nicht gerade zum Ruf beider Autoren bei.
Flann O’Brien
Der dritte Polizist
Kategorie: O
Jahresrückblick 2011
In news:de.rec.buecher wird zum Jahresende regelmäßig die Frage nach den drei besten und drei schlechtesten Büchern gestellt, die man im vergangenen Jahr gelesen habe. Da ich drb inzwischen nicht mehr verfolge, werde ich von nun an meinen Jahresrückblick hier publizieren.
Die drei besten Lektüren des Jahres 2011:
- Judith Schalansky: Der Hals der Giraffe – solche Bücher erscheinen einmal in zehn, vielleicht auch nur einmal in zwanzig Jahren.
- Wolfgang Koeppen: Trilogie des Scheiterns – eine der wenigen gelungenen deutschsprachigen Fortsetzungen der frühen europäischen Moderne nach dem zweiten Weltkrieg.
- Fernando Pessoa: Das Buch der Unruhe – ein erstaunlich vielfältiges Buch auf gewollt reduzierter Basis.
Die drei schlechtesten Lektüren des Jahres 2011:
- Michel Onfray: Anti-Freud – redundante und dumme Polemik gegen eine missverstandene Vaterfigur.
- Matthias Matussek: Wir Deutschen – »Ein Buch von einer so guten Laune, dass man sich gleich übergeben möchte.«
- Janne Teller: Nichts – hybrider und banaler Versuch über den Nihilismus.
Michel Onfray: Anti Freud
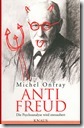 Ich habe mich sehr schwer getan, zu diesem Buch etwas zu schreiben, auch überlegt, ob ich es nicht einfach stillschweigend übergehen sollte, da es ein sehr schlechtes Buch ist und ich die Lektüre nach 150 Seiten eingestellt habe, weil kein neuer, geschweige denn ein origineller Gedanke mehr zu erwarten war. Ich selbst bin als Fachmann für Arno Schmidt auch ein halber, vielleicht auch nur ein drittel Fachmann für Freud geworden, weshalb mich die Auseinandersetzung mit ihm immer noch interessiert, während mir der Rest der psychoanalytischen Literatur inzwischen weitgehend gleichgültig ist.
Ich habe mich sehr schwer getan, zu diesem Buch etwas zu schreiben, auch überlegt, ob ich es nicht einfach stillschweigend übergehen sollte, da es ein sehr schlechtes Buch ist und ich die Lektüre nach 150 Seiten eingestellt habe, weil kein neuer, geschweige denn ein origineller Gedanke mehr zu erwarten war. Ich selbst bin als Fachmann für Arno Schmidt auch ein halber, vielleicht auch nur ein drittel Fachmann für Freud geworden, weshalb mich die Auseinandersetzung mit ihm immer noch interessiert, während mir der Rest der psychoanalytischen Literatur inzwischen weitgehend gleichgültig ist.
Um das Buch angemessen zu rezensieren, ist es leider notwendig, zuvor einige Sätze zu meiner eigenen Position in der Sache zu schreiben, damit man meine Kritik an Onfray nicht als ein Plädoyer für die Psychoanalyse missversteht. Die Psychoanalyse Sigmund Freuds ist eine der bedeutendsten Begründungen einer Weltanschauung (um nicht Religion zu schreiben) des 20. Jahrhunderts. Das in ihr implizit und explizit zum Ausdruck kommende Menschenbild hat einen nicht zu unterschätzenden weltweiten Einfluss auf die Kulturentwicklung gehabt, und niemand kann hoffen, die Entwicklung der westlichen Kultur in den letzten gut 100 Jahren zu verstehen, wenn er diesen Einfluss zu ignorieren versucht. In Freuds Denken fokussieren sich bedeutende geistige Strömungen des 19. Jahrhunderts: die Säkularisierung der Kultur, die Verbreitung atheistischen Denkens, der naive Glaube an die Erklärungsmächtigkeit rationaler Wissenschaft, das romantische Bewusstsein vom notwendig widersprüchlichen Charakter unseres Selbst und nicht zuletzt die Einsicht, dass es sich beim Bild vom Menschen als autarkem Herrn im eigenen Haus um eine weit verbreitete Selbsttäuschung handelt. Das Freudsche und in der Folge dann psychoanalytische Menschenbild im Allgemeinen hat das von Christentum und Humanismus geprägte der Neuzeit soweit gewandelt und aufgelöst, dass grundlegende Thesen der Psychoanalyse heute so weit zum selbstverständlichen und weitgehend popularisierten Grundbestand der westlichen Kultur gehören, dass sich selbst prinzipiell konkurrierende Glaubenssysteme (wie etwa das Christentum) dem anzupassen gezwungen sind.
Dies ist allerdings nicht der einzige Aspekt, unter dem die Psychoanalyse zu betrachten ist: Wie die meisten Weltanschauungen enthält auch die Psychoanalyse ein Heilsversprechen. In ihrem Fall ist dies erst sekundär ein gesellschaftliches oder soziales, primär ist es eines, das auf das Individuum zielt. Die Psychoanalyse versteht sich selbst in erster Linie als Therapie, und ihr wichtigstes Kriterium für die Richtigkeit des eigenen Menschen- und Weltbildes ist der therapeutische Erfolg. (Ob sich ein solcher nachweisen lässt oder nicht, ist eine so komplexe Frage, das sie hier nicht thematisiert werden kann.)
Dass es sich bei der Psychoanalyse nicht um eine Wissenschaft in dem Sinne handelt, wie sich dieser Begriff in den letzten beiden Jahrhunderten herausgemendelt hat, ist – auch entgegen den Ansprüchen einiger ihrer Adepten – offensichtlich und durch die Arbeiten von Wissenschaftstheoretikern wie Adolf Grünbaum hinreichend eindeutig nachgewiesen worden. Insbesondere die freie und freizügige Verwendung der logischen Negation, durch die in der psychoanalytischen Interpretation am Ende beinahe alles beinahe alles andere bedeuten kann, desavouiert die psychoanalytische Methode in den Augen empirischer Wissenschaftler. Im Gegensatz zu ihrem weit verbreiteten Selbstverständnis untersucht die Psychoanalyse nicht empirisch vorhandene Phänomene, sondern sie erzeugt wesentlich den Gegenstand ihrer Untersuchung im Vollzug dieser Untersuchung selbst. Sie ist daher – und bereits Sigmund Freud wusste dies sehr genau – eher eine historische als eine empirische Wissenschaft. Als Gegengewicht zu dieser sehr grundsätzlichen Kritik sollte man sich allerdings an die Einsicht des Aristoteles erinnern, dass von jeder Wissenschaft nur jener Grad von Genauigkeit erwartet werden sollte, den der behandelte Gegenstand tatsächlich hergibt (Nikomachische Ethik, 1094b).
Nach diesem ungewöhnlich langen Vorwort nun endlich zu Michel Onfrays Buch. Onfrays Kritik an Freud ist kein Versuch einer objektiven Einschätzung des wissenschaftlichen Anspruchs seiner Theorie oder ihrer Rolle in der Kultur des 20. Jahrhunderts. Vielmehr handelt es sich um eine Polemik, die versucht, Freuds Person zu verleumden und dadurch seine Theorie zu entwerten. Zu diesem Zweck wiederholt Onfray etwa alle fünf Seiten seine Behauptung, dass Freud seine Theorie zum einen hauptsächlich bei Nietzsche abgeschrieben habe, zum anderen aus seiner persönlichen psychischen Disposition abgeleitet und verallgemeinert habe. Diese Verallgemeinerung sei unzulässig, da Freud dadurch von ihm als universell ausgegebene psychische Gesetzmäßigkeiten von einem einzigen, noch dazu seinem eigenen Fall ableite.
Diese beiden Behauptungen werden von Onfray mit großer rhetorischen Beharrlichkeit immer erneut abgewandelt. Zwischen diesen Wiederholungen des ewig Selben beschuldigt Onfray in der Hauptsache Anna Freud, Ernest Jones und Peter Gay der systematischen Legendenbildung im Fall Freuds. Dies alles wird in einem Ton vorgebracht, als würden hier große Neuigkeiten verkündet, was wahrscheinlich nur diejenigen Leser Onfrays überzeugen wird, auf die das Buch zielt. Jeder dagegen, der sich auch nur oberflächlich mit der Literatur zu Freud beschäftigt hat, weiß, dass der Einfluss der Geistesgeschichte des 19. Jahrhunderts und insbesondere Nietzsches auf Freud inzwischen breit dokumentiert und diskutiert wurde. Onfray rennt hier unter großem Gebrüll Türen ein, die bereits seit mehreren Jahrzehnten weit offen stehen.
Was die methodologische Kritik angeht, so bemerkt Onfray offenbar nicht (oder er will es nicht bemerken), dass seine Kritik gänzlich ins Leere geht: Zum einen hat Freud nie bestritten, dass er selbst und die Angehörigen seiner Familie bevorzugte Objekte seiner Studien waren, zum anderen ist es nicht verwunderlich, dass Freud allgemein gültige psychische Gesetzmäßigkeiten auch an sich selbst feststellen kann. Onfrays Argument folgt in etwa der Struktur, dass Newtons Gravitationsgesetz nicht gültig gewesen wäre, hätte Newton es bloß dadurch herausgefunden, dass er es an der Schwere seiner eigenen Person studiert hätte. Wollte Onfray tatsächlich nachweisen, dass hier ein Fehler vorliegt, so müsste er – wie dies andernorts durchaus fruchtbar praktiziert worden ist – zuerst auf empirischem oder logischem Weg nachweisen, dass die von Freud als allgemein gültig angesehen psychischen Gesetzmäßigkeiten diesem Anspruch nicht genügen, um dann Freuds Schluss von sich auf andere als Fehlschluss nachweisen zu können. Selbstverständlich macht sich der Philosoph Onfray die Mühe eines solchen Nachweises nicht, besonders auch weil dessen langwierige Erarbeitung und detaillierte Darstellung am Interesse seiner Zielgruppe gänzlich vorbeigehen würde.
Von der logischen Schwierigkeit, dass Onfrays Argument gegen Freud auf ihn selbst zurückschlägt und so seine Kritik Freuds als nichts anderes erscheinen muss als ein Ausfluss seiner – Onfrays – persönlichen psychischen Disposition, wollen wir hier ganz schweigen; ein beschämendes Bild mangelnder Reflexion für einen, der sich als Philosophen ausgibt. Bleibt nur noch festzuhalten, dass Onfray eine Diskussion des wichtigen Arguments, dass sich die Richtigkeit der psychoanalytischen Theorie letztlich nur an den Erfolgen bzw. Misserfolgen der therapeutischen Praxis entscheiden wird (eine Entscheidung, die noch lange nicht gefallen ist und wahrscheinlich auch erst fallen wird, wenn sie vollständig unerheblich geworden ist), in keiner einzigen Zeile auch nur versucht.
Insgesamt lässt sich das Buch völlig ausreichend beurteilen, wenn man einen Blick auf das Cover der deutschen Ausgabe wirft: Da hat ein frecher, kleiner Junge dem Papa Sigmund Hörner, eine Brille und eine herausgestreckte Zunge angemalt und eine Teufelsgabel in die Hand gedrückt. Man kann das witzig finden, aber es ist weder ein Argument gegen die Psychoanalyse, noch wird Freud auf diese Weise tatsächlich zum Teufel. Das Buch ist ein alberner und etwas kindischer Versuch Onfrays, mit einem seiner geistigen Väter abzurechnen – und es folgt damit so klassisch dem Freudschen Mythos vom Vatermord, dass es schon wieder lächerlich ist.
Michel Onfray: Anti Freud. Die Psychoanalyse wird entzaubert. Aus dem Französischen von Stephanie Singh. München: Knaus, 2011. Pappband, Lesebändchen, 540 Seiten. 24,99 €.
Stewart O’Nan: Das Glück der anderen
 Erzählt wird die Geschichte der Stadt Friendship und ihres Sheriffs, Predigers und Totengräbers Jacob Hansen, über die binnen weniger Tage gleich zwei Katastrophen hereinbrechen: Zum einen eine Diphtherie-Epidemie, zum anderen ein verheerendes Großfeuer, das sich aufgrund eines langanhaltenden trockenen Sommers unaufhaltsam ausbreitet. Weder die Zeit noch der Ort der Handlung werden präzise bezeichnet, doch offensichtlich handelt es sich um eine amerikanische Kleinstadt Ende des 19. Jahrhunderts: Der Telegraph ist schon etabliert, aber nicht das Telefon, Jacob Hansen fährt schon Fahrrad, aber es gibt noch keine Autos. Der Leser darf annehmen, dass O’Nan die Handlung absichtlich in die Zeit unmittelbar vor den ersten Erfolgen bei der Bekämpfung der Diphtherie in den 1890er Jahren gelegt hat.
Erzählt wird die Geschichte der Stadt Friendship und ihres Sheriffs, Predigers und Totengräbers Jacob Hansen, über die binnen weniger Tage gleich zwei Katastrophen hereinbrechen: Zum einen eine Diphtherie-Epidemie, zum anderen ein verheerendes Großfeuer, das sich aufgrund eines langanhaltenden trockenen Sommers unaufhaltsam ausbreitet. Weder die Zeit noch der Ort der Handlung werden präzise bezeichnet, doch offensichtlich handelt es sich um eine amerikanische Kleinstadt Ende des 19. Jahrhunderts: Der Telegraph ist schon etabliert, aber nicht das Telefon, Jacob Hansen fährt schon Fahrrad, aber es gibt noch keine Autos. Der Leser darf annehmen, dass O’Nan die Handlung absichtlich in die Zeit unmittelbar vor den ersten Erfolgen bei der Bekämpfung der Diphtherie in den 1890er Jahren gelegt hat.
Dabei geht es O’Nan nur in zweiter Linie um die Beschreibung der Folgen einer solchen Epidemie für eine Kleinstadt, sondern in der Hauptsache um die Auswirkungen auf seinen Protagonisten: Jacob Hansen verliert durch die Diphtherie bereits sehr früh im Roman seine kleine Tochter und seine Frau, bleibt aber dennoch bis zum Ende unermüdlich für seine Stadt tätig. Dies gelingt ihm durch eine Ablösung von der Realität des Geschehens, die er erst aufgibt, als das Ende der Stadt unmittelbar bevorsteht. Unterstützt wird die Beschreibung dieser Ablösung durch die durchgehende Verwendung der literarisch sehr seltenen Du-Erzählung: Der Erzähler – dass er mit dem Protagonisten identisch ist, kann nur vermutet werden – spricht den Protagonisten stets mit »Du« an. Diese Sonderform des personalen Erzählens erlaubt es O’Nan, eine deutliche Distanz zwischen Erzähler und Protagonist aufzubauen, ohne dabei auf einen auktorialen Erzähler zurückgreifen zu müssen. In dieser Hinsicht stellt das Buch ein interessantes erzähltechnisches Experiment dar.
Der Originaltitel des Buches A Prayer for the Dying setzt doch einen etwas anderen Ton als das etwas altruistische Das Glück der anderen, das der deutsche Verlag dem Buch aufs Titelblatt gepresst hat. Vielleicht war ihnen der Originaltitel zu negativ für ein Buch, in dem mehr oder weniger alle Figuren am Ende tot sind. Der Originaltitel weist darauf hin, dass die Katastrophe bei Jacob Hansen auch eine religiöse Krise auslöst. Überhaupt ist die Hauptfigur recht differenziert und vollständig erfunden: Sein Umgang mit den Toten geht bis auf seine Zeit als Soldat im Amerikanischen Bürgerkrieg zurück, aus der auch seine Aversion gegen Pferde – daher das Fahrrad als Fortbewegungsmittel – stammt. Seit langer Zeit von Toten umgeben, sind für ihn die Unterschiede zwischen den Lebenden und den Toten geringer als für einen Alltagsmenschen. Hansens Glaube ist nur ein weiterer Aspekt dieser Verbundenheit des Lebenden mit den Toten.
Alles in allem ein interessanter Roman mit einer außergewöhnlichen, aber überzeugend eingesetzten Erzählperspektive.
Stewart O’Nan: Das Glück der anderen. Aus dem Amerikanischen von Thomas Gunkel. Lizenzausgabe. Hamburg: Gruner + Jahr, 2006. Leinenrücken, Lesebändchen, 235 Seiten. 10,– €.
Stewart O’Nan: Last Night at the Lobster
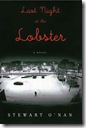 Auch Stewart O’Nan ist mir bislang vollständig entgangen, obwohl er seit mehr als 20 Jahre publiziert und seit über 10 Jahren seine Bücher auch auf Deutsch erscheinen. Nun ist mir aber endlich von meinem aufmerksamen Buchhändler sein in diesem Jahr auf Deutsch erschienenes Letzte Nacht empfohlen worden, wobei sich herausstellte, dass die englische Hardcover-Ausgabe preiswerter ist als die deutsche.
Auch Stewart O’Nan ist mir bislang vollständig entgangen, obwohl er seit mehr als 20 Jahre publiziert und seit über 10 Jahren seine Bücher auch auf Deutsch erscheinen. Nun ist mir aber endlich von meinem aufmerksamen Buchhändler sein in diesem Jahr auf Deutsch erschienenes Letzte Nacht empfohlen worden, wobei sich herausstellte, dass die englische Hardcover-Ausgabe preiswerter ist als die deutsche.
Das Buch ist ein Musterstück einer Pars-pro-toto-Erzählung: Erzählt wird von einem einzigen Abend in einem Restaurant der Kette »Red Lobster«. Es ist kurz vor Weihnachten, und das Restaurant hat seinen letzten Öffnungstag. Es wird wegen angeblich mangelnder Rentabilität geschlossen. Im Mittelpunkt der personalen Erzählung steht Manny, der Manager des Restaurants, der mit einer zusammengeschrumpften Belegschaft diesen letzten Tag ordentlich über die Bühne bringen möchte. Einerseits ist er bemüht, es als einen Tag wie jeden anderen zu nehmen, andererseits liegt in jeder Handlung das melancholische Bewusstsein, dass dies alles zu Ende geht.
Draußen schneit es den ganzen Tag, und gegen Abend entwickelt sich ein regelrechter Schneesturm, so dass es mittags für einen Samstag ruhig ist und zum Abendessen nur ein älteres Ehepaar vorbeikommt, das auf der Durchreise ist. Manny hat also, obwohl er den ganzen Tag über beschäftigt ist, genug Zeit, um nachzudenken und Erinnerungen nachzuhängen.
Das Buch enthält eine ungewöhnlich ruhig und gelassen erzählte Geschichte, deren Höhepunkte in Missgeschicken, kleinen Unfällen, ungewöhnlichen Begebenheiten bestehen. In einem wesentlichen Sinne passiert in diesem Buch nichts als das Alltägliche in seinen ewig wiederkehrenden Variationen. Hier und da sprengt etwas diesen Rahmen, aber insgesamt ist dieses Buch sensationell alltäglich. Es bezeichnet das große erzählerische Talent O’Nans, dass er für all dies einen Erzählton und ein -tempo gefunden hat, die die Erzählung in einer erstaunlichen Balance halten. Hinzukommt ein Detailrealismus, der dem Leser eine genaue Vorstellung der Abläufe im Restaurant vermittelt. Obwohl in diesem Buch nichts im traditionellen Sinne Spannendes vorkommt, habe ich mich keine Sekunde bei der Lektüre gelangweilt.
Ein erstaunlich artistisches und zugleich unauffällig daherkommendes Buch. Allen Lesern gediegener und unaufgeregter Prosa nachdrücklich empfohlen.
Stewart O’Nan: Last Night at the Lobster. New York: Viking, 2007. Pappband, 147 Seiten. Ca. 12,– €.
Włodzimierz Odojewski: Ein Sommer in Venedig
 Es ist nicht ganz einfach, dieser Erzählung gerecht zu werden, wenn man über ein rein emotionales Urteil hinauskommen will. Erzählt wird eine Episode im Sommer 1939, in deren Mittelpunkt der neunjährigen Marek steht, der in einer gutbürgerlichen Familie Polens aufwächst. Seine Familie hat eine lange Tradition von Reisen nach Venedig, die bereits von den Großeltern begonnen wurde. Im Sommer 39 soll endlich auch Marek zusammen mit seiner Mutter die Lagunenstadt besuchen, eine Reise auf die er sich seit Langem freut und vorbereitet hat. Venedig ist der Fixpunkt seiner kindlichen Fantasie und Sehnsucht.
Es ist nicht ganz einfach, dieser Erzählung gerecht zu werden, wenn man über ein rein emotionales Urteil hinauskommen will. Erzählt wird eine Episode im Sommer 1939, in deren Mittelpunkt der neunjährigen Marek steht, der in einer gutbürgerlichen Familie Polens aufwächst. Seine Familie hat eine lange Tradition von Reisen nach Venedig, die bereits von den Großeltern begonnen wurde. Im Sommer 39 soll endlich auch Marek zusammen mit seiner Mutter die Lagunenstadt besuchen, eine Reise auf die er sich seit Langem freut und vorbereitet hat. Venedig ist der Fixpunkt seiner kindlichen Fantasie und Sehnsucht.
Allerdings verläuft der Sommer 1939 dann ganz anders: Mareks Mutter entwickelt eine ungewohnte patriotische Betriebsamkeit, und schließlich erhält sein Vater auch noch einen Gestellungsbefehl. Es wird daher beschlossen, die Reise nach Venedig aufzugeben, und stattdessen reisen Mutter und Sohn zur Tante Weronika nach Südpolen. Weronika lebt in einer großen, ländlichen Villa, die einmal zu einem Hotel hatte umgebaut werden sollen, ein Umbau, der aber nie abgeschlossen wurde. Hier vergisst Marek bald seine Enttäuschung über die ausgefallene Reise. Im Weiteren kreist die Erzählung wesentlich um zwei Ereignisse: Auf der einen Seite den Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, der mit apokalyptischen Bildern eines Fliegerangriffs und Flüchtlingsströmen in die ländliche Idylle einbricht, und auf der anderen die Entdeckung einer »Quelle« im Keller der Villa, einem Wasserrohrbruch, der langsam aber sicher den gesamten Keller auffüllt.
Diese »Quelle« und der sich langsam füllende Keller werden zum Anlass einer merkwürdigen Realitätsflucht beinahe der gesamten Familie: Nachdem man sich zuerst ausführliche Gedanken um die Verwandlung der Villa in ein Kurbad mit Mineralquelle macht, führt der immer höhere Wasserstand zur kollektiven Fanatsie, es handele sich beim Keller um eine Art von Venedig. Man schafft Tische hinunter, verbindet sie mit Holzplanken, stellt weitere Möbel auf die Tische und verbringt auf diese Weise eine »Saison in Venedig« (so der polnische Originaltitel der Erzählung). Die Erzählung endet damit, dass ein deutscher Offizier ankommt, um die Villa zu besichtigen – die vermeint- lichen Sieger haben die Zuflucht erreicht und wahrscheinlich hält mit ihnen auch das Realitätsprinzip wieder seinen Einzug.
Die Erzählung ist atmosphärisch dicht, hinterlässt aber den Eindruck, als handele es sich um einen Teil einer größer angelegten Lebens- geschichte. Zahlreiche Motive werden zwar angespielt – sehr auffällig etwa das erotische Erwachen des Protagonisten –, kommen im Weiteren aber in keiner Weise zum Tragen. Auch das Thema Realität versus Fantasie scheint der Autor nur zu probieren, nicht wirklich durchzuführen. Vieles wirkt so unfertig wie die Zimmer der Villa, deren Umbau nie vollendet wurde. Dass dies auch dem Autor bewusst war, manifestiert sich im letzten, erzählerisch dilettantischen Absatz der Erzählung, in dem versucht wird, die Geschichte im Hauruck-Verfahren in die Jetztzeit der Leser hinein zu verlängern.
Inzwischen ist bei SchirmerGraf (einem Verlag mit offenbarem Mangel an Bindestrichen) mit Als der Zirkus kam eine weitere Erzählung Odojewskis erschienen, deren Protagonist ebenfalls Marek zu sein scheint. Mag sein, es rundet sich darin das eine oder andere, das hier offengeblieben ist.
Włodzimierz Odojewski: Ein Sommer in Venedig. Aus dem Polnischen von Barbara Schaefer. München: SchirmerGraf, 2007. Leinenband, Lesebändchen, 126 Seiten. 14,80 €.
Von der Höhe der Alpen (15)
But the Matterhorn of Robert Walmsley’s success was not scaled until he married Alicia Van Der Pool. I cite the Matterhorn, for just so high and cool and white and inaccessible was this daughter of the old burghers. The social Alps that ranged about her – over whose bleak passes a thousand climbers struggled – reached only to her knees. She towered in her own atmosphere, serene, chaste, prideful, wading in no fountains, dining no monkeys, breeding no dogs for bench shows. She was a Van Der Pool. Fountains were made to play for her; monkeys were made for other people’s ancestors; dogs, she understood, were created to be companions of blind persons and objectionable characters who smoked pipes.
O. Henry
George Orwell: 1984
 Zur Wiederlektüre nach über 20 Jahren bin ich auf etwas verschlungenem Weg gekommen: Als ich mir die die Verfilmung des »Merchant of Venice« durch Michael Radford anschaute und mich zu erinnern versuchte, ob ich schon jemals einen anderen Fim dieses Regisseurs gesehen hatte, stellte ich überrascht fest, dass er auch für die Verfilmung von »1984« verantwortlich war. Ich habe dann zuerst den Film nach 22 Jahren noch einmal angeschaut und dann, neugierig wie nah am Buch die Verfilmung wohl sein möchte (sie ist erstaunlich nah am Buch!), das ebenfalls 22 Jahre alte und noch ungelesene Taschenbuch mit der Übersetzung durch Michael Walter aus dem Regal gezogen. Ich hatte noch zu Schulzeiten die ältere Übersetzung von Kurt Wagenseil gelesen, dann im Jahr des Titels brav die neue Übersetzung gekauft, eingestellt und seitdem von Mal zu Mal mit umgezogen.
Zur Wiederlektüre nach über 20 Jahren bin ich auf etwas verschlungenem Weg gekommen: Als ich mir die die Verfilmung des »Merchant of Venice« durch Michael Radford anschaute und mich zu erinnern versuchte, ob ich schon jemals einen anderen Fim dieses Regisseurs gesehen hatte, stellte ich überrascht fest, dass er auch für die Verfilmung von »1984« verantwortlich war. Ich habe dann zuerst den Film nach 22 Jahren noch einmal angeschaut und dann, neugierig wie nah am Buch die Verfilmung wohl sein möchte (sie ist erstaunlich nah am Buch!), das ebenfalls 22 Jahre alte und noch ungelesene Taschenbuch mit der Übersetzung durch Michael Walter aus dem Regal gezogen. Ich hatte noch zu Schulzeiten die ältere Übersetzung von Kurt Wagenseil gelesen, dann im Jahr des Titels brav die neue Übersetzung gekauft, eingestellt und seitdem von Mal zu Mal mit umgezogen.
Weit besser hätt’ ich doch mein weniges verpraßt,
Als mit dem wenigen belastet hier zu schwitzen!
Was du ererbt von deinen Vätern hast,
Erwirb es, um es zu besitzen.
Was man nicht nützt, ist eine schwere Last,
Nur was der Augenblick erschafft, das kann er nützen.
Nun aber zum Buch: Wiedergefunden habe ich nicht, was ich erwartet hatte. Was sich im allgemeinen Bewusstsein festgesetzt und mit den Jahren auch meine frühere Lektüre überlagert hat, ist das Bild eines technisierten Überwachungsstaates. Überwachungsstaat mag gerade noch angehen, von Technisierung aber kann kaum die Rede sein. Überhaupt wird nur ein geringer Anteil der Bevölkerung – hauptsächlich die Mitglieder der »Äußeren Partei« – tatsächlich überwacht und auch bei denen ist der Grad der Kontrolle höchst unklar, was einen nicht unwesentlichen Anteil der von der Partei ausgeübten Macht darstellt.
Vorherrschend aber ist ganz etwas anderes: Not und Elend in einem immerwährenden Kriegszustand, nahezu kompletter Mangel an futuristischer Technik – einzig der »Sprechschreiber« geht wesentlich über den technischen Horizont der 1940er Jahre hinaus –, statt dessen krudeste ideologische und psychologische Methoden, deren Anwendung nicht nur in Bezug auf den Erfolg fraglich erscheinen müsste, sondern auch im fiktionalen Gefüge des Romans eigentlich keinen Platz hat. Wenn die Partei tatsächlich die Vergangenheit so perfekt beherrscht, wie es der Roman vorgibt, so braucht sie auch Märtyrerschaft nicht zu fürchten, da die »vaporisierten« Gedankenverbrecher ja niemals existiert haben. Sie könnte sich daher getrost den mit den Delinquenten betriebenen Aufwand, der dazu führen soll, sie zu linientreuen Genossen zu machen, bevor man sie beseitigt, sparen und die Festgenommenen ohne weiteres ins Jenseits befördern. Geständnisse und Schauprozesse, so man sie denn für die Propaganda benötigt, lassen sich sicherlich unaufwendiger produzieren. Auch bleibt der Versuch unverständlich, die Vergangeheit überhaupt beherrschen zu wollen und immer erneut umzuschreiben anstatt sie einfach auszulöschen. Warum werden denn gedruckte Nachrichten überhaupt noch produziert und ausgeliefert? Wem hat die Partei denn überhaupt etwas zu beweisen? »Doppeldenk« und »Televisor« lassen solchen Aufwand als unnötig erscheinen.
Einzig durch das implizite Menschenbild wird der dritte Teil des Romans interessant: Es existiert in Orwells Utopie kein letzter Zufluchtsort des Individuums in seiner Gedankenwelt, den die Macht nicht erreichen könnte, wenn sie es einmal darauf angelegt hat. Auch der letzte Widerstand des Einzelnen kann gebrochen werden, wenn es die Mächtigen tatsächlich darauf anlegen würden. Insoweit ist Winston Smith eine interessante Gegenfigur zu Kleists Michael Kohlhaas, der sich noch durch das Akzeptieren seines Todes dem Zugriff des Mächtigen entziehen kann.
Erstaunlich, aber dann auch wieder sehr verständlich ist, dass der Roman seine Bedeutung im öffentlichen Bewusstsein der westlichen Welt so ganz verloren zu haben scheint. Das Gespenst des Überwachungsstaates scheint an Bedrohlichkeit eingebüßt zu haben oder seine Form hat sich inzwischen so verändert, dass Orwells Vision nicht mehr greift. Es steht zu befürchten, dass der Roman in den nächsten zehn Jahren gänzlich obsolet werden wird, falls er es nicht heute schon ist.
Aktuelle Ausgabe:
Orwell, George: 1984
Ullstein Taschenbuch. ISBN 3-548-23410-0
Paperback – 320 Seiten – 7,95 Eur[D]
P.S.: Im Anschluss habe ich auch noch einmal Anthony Burgess’ Essay über Orwells »1984« gelesen, der beispielhaft deutlich macht, wie sehr der Roman eine Extrapolation aus der unmittelbaren Lebenswelt Orwells zum Zeitpunkt der Niederschrift ist.