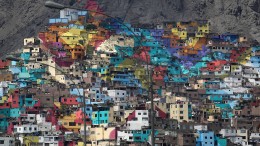Dietmar Dath antwortet auf Maxim Biller : Wenn Weißbrote wie wir erzählen
- -Aktualisiert am
Meine Eltern wollten mich zum Protestanten erziehen, und mein Kirchenaustritt bei Erreichen der Religionsmündigkeit ändert nichts daran, dass ich beim Weihnachtsgottesdienst immer noch wüsste, was wann gesungen und gebetet wird. Damit ist das „habituelle Christentum“ abgedeckt.
Checkpoint 2: Suhrkamp, ein Wappen, das Biller in seinem Text als effektvolles Kürzel für die vorherrschenden Lesegewohnheiten des literaturbetriebslenkenden Bewusstseins einsetzt. Ich kenne das Wappen gut genug. Der Verlag hat Bücher von mir gedruckt, und als er das erste angenommen hatte, war mir tatsächlich einen Moment lang, wie Billers Verwendung des Wimpels nahelegt, als hätte ich zum zweiten Mal das Abitur bestanden und dürfte jetzt hoffen, dem Schicksal vieler Kindheitsfreundinnen und -freunde zu entgehen, die heute von irgendeiner Arbeit leben müssen, bei der sich niemand dafür interessiert, ob sie Hirn, Einfälle oder Träume haben.
Was machen die Iranerin, der Portugiese und der Türke aus meiner südbadischen Kleinstadt-Grundschule heute wohl beruflich, der Serbe, die Liberianerin aus dem Gymnasium? Keine Ahnung, aber wenn sie Künstlerinnen oder Dichter geworden wären, würde ich mich schon wundern, ich kenne ja das Land hier auch. Kontakt pflege ich zu ihnen allen keinen mehr, jetzt, mit Mitte vierzig.
Kontakt pflege ich allerdings - wieder eine Bestätigung von Billers These - zu einigen anderen ehemaligen Schulbekanntschaften, die Biller „indigen“ nennen würde, solche also, deren Großväter mit den meinen vielleicht Fronterinnerungen aus dem Zweiten Weltkrieg hätten austauschen können, hätte ihnen der Sinn danach gestanden. Was die „halbwegs umerzogenen Nazisoldaten“ angeht, steht es bei mir sogar eher schlimmer als in Billers Diagnose: Ich weiß zu wenig über sie, denn beide Großväter sind lange tot, wir haben nicht über die deutschen Verbrechen geredet, erst recht nicht darüber, ob sie sich daran beteiligt haben.
Vor ein paar Jahren traf ich zufällig in einem Metropolen-Klamottenladen den vor einem Vierteljahrhundert von mir sehr bewunderten, weil ungeheuer belesenen - und iranischen - Vater eines lange aus den Augen verlorenen Mitschülers wieder. Der Mann, ein Architekt, erinnerte sich lebhaft an einen meiner Großväter, mit dem er ab und zu auf Elternabenden zusammengetroffen war.
Von diesem schien er, wie mir einer seiner bösen Witze verriet, etwas zu wissen, das in meiner liebenden Erinnerung nur vage gespeichert war, nämlich dass jener Großvater wohl dem Neuheiden-Flügel nationalkonservativer Wagner-Esoterik zugeneigt gewesen war. „Na“, fragte der Iraner melancholisch, „was macht dein Opa, ist er schon in Walhalla?“
Das, Freunde und Nachbarn, ist Bildung - wie viele „gesichtslose Großstadtbewohner mit nichtssagenden Nuller-Jahre-Vornamen“ (Biller), die unsere deutsche Gegenwartsliteratur schreiben oder darin herumlaufen, wissen schon, was „Walhalla“ ist?
Literatur aus dem Ausland statt von Migranten
Keine Ahnung. Nein, das ist keine rhetorische Geste - ich könnte es wirklich nicht sagen, weil ich sehr wenig deutschsprachige Gegenwartsliteratur lese. Das ist nun ein Tatbestand, der in Billers Steckbrief der Privilegierten fehlt: Seit Jahren begegne ich auf Buchmessen, literarischen Tagungen, Abenden zur Würdigung großer Toter und anderen Arbeitsgeselligkeiten jungen bis jüngsten deutschen Autorinnen und Autoren, mit denen man, wenn der Job erledigt ist, den Weihesaal verlässt, um gemeinsam zum Türken, Griechen, Westafrikaner oder Indonesier zu gehen.
Da wird dann von amerikanischen, französischen, japanischen, russischen, niederländischen und indischen Büchern gesprochen, lobend, hasserfüllt, eifernd, sehnsüchtig, leidenschaftlich. Das ist kein Augurentheater, bei dem man sich bedeckt hält, was die Meinungen über die einheimische Konkurrenz angeht.