Durchquerung von Dunkelheit, strahlender Kern
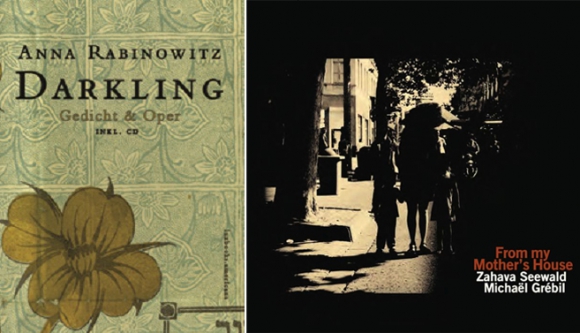 Darkling (luxbooks) & From my Mothershouse (subrosa)
Darkling (luxbooks) & From my Mothershouse (subrosa)
Diese Tage beschäftigen mich gleich zwei Veröffentlichungen vom vergangenen Jahr.
Ich möchte daher diesmal eine Art Doppel-Besprechung wagen, auch auf die Gefahr hin, dass der Text dadurch etwas länger wird. Aber für die beiden Werke, auf die ich hier das Augen- und Ohrenmerk richten werde, Zeit aufzubringen, lohnt sich – versprochen! – allemal. Und eine solche Doppel-Besprechung zu unternehmen, geht natürlich nur, weil diese Beiden etwas sehr starkes verbindet.
Zum einen ist da die CD „From My Mother’s House“, zum anderen das Buch „Darkling“.
Beide sind sie ungefähr zum gleichen Zeitpunkt erschienen, und zwar vor einem Jahr, im Frühjahr 2013 (für „Darkling“ gilt dies allerdings nur für die deutsche Ausgabe, die amerikanische Originalausgabe stammt von 2001). Seit einem Jahr bereits – und es kommt mir wirklich überhaupt nicht wie ein Jahr vor! – liegt „From My Mother’s House“ bei mir, und diese CD beschäftigt mich seither so sehr, hält mich auf so wundersame Weise in Atem, dass auch mehrere Anläufe des Schreibens darüber zunächst Dinge hervorbrachten, die einfach in der Schwebe blieben. Es war, wie als musste sich noch irgendetwas ereignen, um das Schreiben zu diesem Schatz weiter und zu einer Art Ende führen zu können. Die Besprechung von „From My Mother’s House“ war also schon längst überfällig, als – sehr verspätet – „Darkling“ eintraf. Und es war tatsächlich ein bisschen, wie als habe „From My Mother’s House“ nur auf diese ferne Cousine aus New York gewartet … Und das, obwohl – oder gerade weil – beide sehr, sehr unterschiedlich sind.
Was genau sind die Beiden?
„From My Mother’s House“ ist ein Gemeinschaftswerk zweier wunderbarer, in Brüssel ansässiger Künstler, es ist das Werk der Sängerin Zahava Seewald und des Multiinstrumentalisten und Komponisten Michaël Grébil.
„Darkling“ ist zunächst das Einzelwerk einer Person; es ist ein Lyrikband, und er stammt aus der Feder der Dichterin und Librettistin Anna Rabinowitz. In der Folge wurde „Darkling“ dann ebenfalls zu einem Gemeinschaftswerk, allerdings völlig anderer Art als „From My Mother’s House“ (das ja von Anfang an gemeinsam erschaffen wurde).
Die American Opera Projects und der Komponist Stefan Weisman machten in der Folge, zusammen mit Rabinowitz, aus „Darkling“ eine (wie man oft zu lesen bekommt: experimentelle) Oper, und etwas später kam dann die Musik der Oper als CD heraus – als Audio CD (nicht als DVD der Inszenierung). Und seit letztem Jahr liegt eben auch die deutsche Übersetzung von „Darkling“ vor, nebst CDs. Dazu dann gleich noch mehr.
Buch. CD. Wir haben es also bei beiden u.a. mit Text und Musik zu tun.
Was es aber möglich macht, die beiden Werke – bei aller Verschiedenheit – zusammenzurücken, und was mich bewog, sie gemeinsam vorzustellen, ist das, worum es ihnen und in ihnen geht:
Sie sind alle beide eine tiefgründige Hommage an Menschen. An Menschen, die im Krieg gelitten haben und an Menschen, die im Holocaust ermordet wurden. Sie sind zwei (fast möchte man sagen: elliptisch) klingende, bisweilen singende Werke des Gedenkens, die beide sowohl durch zarte Direktheit als auch Eindringlichkeit und wachrüttelnde Heftigkeit Leser und Hörer anzusprechen und mitzunehmen wissen, hinein in ihren jeweiligen Fluss, der bei aller Brüchigkeit dennoch auch immer weiterströmt. Und beide gehen sie dabei äußerst behutsam vor, in beiden verspürt man als (lesender) Hörer oder (hörender) Leser durch das Erklingende hindurch jene sonst so unsagbare Trauer und zugleich jene erstaunliche, weil unerklärlich erscheinende … Freude, die das Leben dennoch birgt – diese Kraft des Dennoch –, man liest und hört den Schmerz ohne Trost und all das Danach wie auch Möglichkeit und Unmöglichkeit des Weitermachens. Hier werden in zwei ganz unterschiedlichen Werken Leben vergegenwärtigt, Leid und gebrochene, vernichtete Leben, aber auch Leben überhaupt, und in „From My Mother’s House“ auch das Überleben, und zugleich ist stets klar, dass diese Vergegenwärtigung ihre Grenzen hat.
Im Folgenden werde ich nun erst eingehender über „From My Mother’s House“ sprechen, dann über „Darkling“.
„From My Mother’s House“ ist eine Produktion des belgischen Labels Sub Rosa. Es kommt in dunkler Aufmachung daher, vorwiegend schwarz. Die CD selbst ist schwarz gehalten, mit sehr vielen winzigen Lichtpunkten darauf, ein wenig einem leicht verhangenen Nachthimmel gleich. Auf dem Cover ist mittig ein Schwarz-Weiß-Bild zu sehen, auf dem wiederum ein Straßenzug zu erkennen ist und – im Vordergrund – eine Frau, die rechts und links von sich zwei Kinder bei den Händen hält. Man erkennt jedoch nur die Silhouetten des oberen Teils der Körper und die Beine; die Gesichter hingegen verschwinden in Schwarz. Alle Fotos von Cover und Booklet stammen von Michaël Grébil, der sich neben seiner Tätigkeit als Musiker und Arrangeur auch gerne auf dem Gebiet der fotografischen und bildnerischen Komposition bewegt.
Schlägt man die CD auf, so stößt man auf einen einem Schlüsselloch nachempfundenen und ansonsten von Schwarz umgebenen Bildausschnitt, der den Blick frei gibt auf ein kleines Mädchen, das dem Betrachter den Rücken zuwendet und davon zu springen scheint, durch Gehölz. Und darunter steht:
Tell me, what did you expect to see in that brain
cut open after the Jewish city had been torn to pieces?
‚Maybe to see the eternal that outlasts death;
I even have a name for it: radiant core.‘Sag mir, was hast du denn erwartet zu sehen in diesem
aufgeschnittenen Hirn, nachdem die jüdische Stadt zerpflückt worden war?
‚Vielleicht, das Ewige zu erblicken, das den Tod überdauert;
Ich habe sogar einen Namen dafür: strahlender Kern.‘
Diese Zeilen stammen von dem auf Jiddisch schreibenden Dichter Abraham Sutzkever und sie sind seinem Gedicht entnommen, das den (englischen) Titel „Tell“ trägt und von Richard J. Fein aus dem Jiddischen ins Englische übertragen wurde. Das schneidend, schwindelerregend und erschreckend Süßbittere dieser Worte kann wohl als einer der Impulsgeber dieser äußerst vielschichtigen Produktion gelesen werden.
„From My Mother’s House“ in Kürze beschreiben zu wollen, erweist sich als gar nicht so einfach. Aber ein paar Fakten können direkt benannt werden: Seewald und Grébil arbeiten u.a. mit Texten und Textausschnitten verschiedener jüdischer Autoren und Autorinnen, darunter – neben Sutzkever – Leyzer Aykhenrand, Rose Ausländer, Paul Celan, Charlotte Delbo, Léa Goldberg und Moyshe-Leyb Halpern. Die Texte oder Textauszüge sind im Booklet abgedruckt. Die Platte ist eine wahre ‚Lyrik-Geschichte‘, sprich: durch die Lyrik hindurch erzählt sie ihre ‚Geschichte‘, die ihren ganz eigenen Gesetzmäßigkeiten folgt. Mir kam bei dieser Art Montage oder Assemblage die „Glaneuse“, die „Ährenleserin“ von Agnès Varda in den Sinn, aber auch an Chris Marker musste ich denken, und das ist kein Zufall: Er ist einer der ganz wichtigen Inspirationsgeber Grébils.
Von Celan finden sich „Corona“, „Psalm“, „Fadensonnen“ und „Kristall“ in das Album aufgenommen, entweder in voller Länge oder jeweils ein paar Zeilen daraus, von Rose Ausländer „Mutter Sprache“, ein weiterer Schlüsseltext des Albums, und von Léa Goldberg das aus dem Hebräischen ins Englische übersetzte Gedicht, das dem Ganzen seinen Namen gibt: „From My Mother’s House“.
Die siebzehn Tracks dieser Platte können getrennt voneinander angewählt und gehört werden, sie sind aber in einem großen Bogen angelegt und gehen fließend ineinander über, so dass gerade das Hören von Anfang bis Ende eine ganz eigene, besonders intensive Hörerfahrung ermöglicht.
„From My Mother’s House“ ist wirklich besonders gut als ein Ganzes zu hören, mit Vorliebe spät abends oder nachts. Es ist ein echtes „Kino für die Ohren“ oder den lauschenden Geist, extrem vielschichtig und subtil, musik- und klangdurchtränkt, und vielstimmig sowie mehrsprachig (es erklingen neben Deutsch und Englisch auch Hebräisch, Französisch und Jiddisch), ein Klanggebilde, das bei jedem Hören neu überrascht. Die große Qualität, das Besondere und besonders Gelungene an dieser Arbeit sind die Art und Weise, wie hier Texte und Klänge, Sprachen, Musik und Stimmen miteinander verwoben sind. Anstatt von einem Klangkino zu sprechen, könnte man wohl ebenso gut auch von einer Art Hörbuch reden oder von einer sehr ungewöhnlichen Musik-CD, und all das stimmt und trifft es dennoch nicht ganz. „From My Mother’s House“ lebt jenseits aller Klassifizierung.
Ungefähr mittig auf der Platte ist das tief berührende Ono Tovo eingebaut, um das alles andere irgendwie zu kreisen scheint: Ono Tovo ist ein traditioneller, liturgisch-synagogaler Gesang (zu, wenn ich jetzt nicht ganz falsch gewickelt bin, Yom Kippur). Und der hier vorgestellten, umwerfenden Version in der Interpretation von Zahava Seewald werden sich wohl nur die Allerwenigstens verschließen können.
Zahava Seewalds beeindruckende Stimme ist ohnehin einer der ganz wichtigen Pfeiler der Platte. Manche kennen sie vielleicht bereits von Aufnahmen wie Abi Gezint bei John Zorns Label Tzadik Records oder von Ashkenaz Songs Vol. I und später dann Vol. II zusammen mit Psamim beim Label Sub Rosa. 2005 brachten Grébil und Seewald Scorched Lips heraus, ebenfalls bei Tzadik Records.
Auf „From My Mother’s House“ hören wir Seewald wieder meisterhaft singen, aber auch in verschiedenen Sprachen rezitieren (Seewald spricht tatsächlich auch all die Sprachen, die auf der Platte erklingen), und jedes Mal ist, was sie singt oder spricht, von großer Intensität, und Intimität. Die Stimmtextur, ihr Grain de la voix, das assoziative Klangmaterial, alles wird zu einem feinen, höchsteindringlichen Geflecht oder Mosaik:
« Mutter Sprache
Setzt mich zusammen
Menschmosaik ».
Musik und Worte greifen ineinander, sie greifen einer in den anderen ein, bewegen sich miteinander, trennen sich auch wieder, gehen ineinander über, voneinander aus. Durch Klang wähnt man sich mal bei jemandem zuhause, ganz privat, man lauscht einem Gespräch, es ist, wie als schnappe man etwas auf, ein Interview gar, mal ist man irgendwo draußen, und es scheint, als ginge starker Regen nieder, mal wähnt man sich kurzzeitig in einer Halle … und die Assoziationen, die all dies in einem weckt, sind ebenso vielschichtig wie das Gehörte … Die Klangbewegungen sind bisweilen abrupt, meist jedoch sehr subtil, kaum merklich webt sich alles voran, ist bereits weiter gegangen, und so kommt eins zum anderen, lässt Gehörtes vermeintlich hinter sich und hängt doch stets auch miteinander zusammen.
Neben Zahavas Stimme gibt es noch eine ganze Reihe anderer Stimmen, anderer Sprecher, auch Kinderstimmen z. Bsp., das Weiterweben der Generationen, und die Klangwelt, die Michaël Grébil hier arrangiert und komponiert hat, ist – ohne je überladen zu sein – dermaßen detail- und farben- (und auch zitaten-)reich, dass ich hier jetzt erst gar nicht versuchen möchte, zu benennen, was alles darin vorkommt. Und zudem gilt: Auch wer nichts für sich selbst Bekanntes darin wiederfinden sollte, wird – wenn er einem fordernden Hörabenteuer grundsätzlich zugetan ist – hier (bei aller Düsternis) seine helle Freude haben.
Und so ist „From My Mother’s House“ ein starkes, weil gerade so feinfühlig-fragil-fragmentarisches wie auch komplexes Werk des Gedenkens und Bewahrens und zugleich eine Hymne an das Leben. Eine Hymne, die besingt, was Ungesehen ist.
Und an dieser Stelle genau möchte ich zu „Darkling“ übergehen.
„Darkling“ ist in der amerikanischen Reihe des Luxbooks Verlags erschienen (luxbooks.americana). Es ist ein Gesang, ein vielstimmiger Gesang (ein – wie es im Klappentext des Buches heißt) „Sprachgesang“; kein „Sprechgesang“ also, aber vielleicht ein sprechender Gesang, der denen Sprache gibt, die ohne diesen Akt auf immer ohne Sprache blieben … Und auch dieser Gesang ist bruchstückhaft.
Im Zusammenhang von „Darkling“ von einem Gesang zu sprechen, drängt sich förmlich (d.h. wirklich von der Form her gesehen) auf: „Darkling“ ist ein Langgedicht bzw. eine „buchlange Sequenz“, die viele verschiedene ‚Fetzen‘ von Stimmen enthält, eine Fragment-Polyphonie; es ist ein großes Ganzes des Zerrissenen, und es ist dabei aufs Feinste durchkomponiert. Zudem stehen ihm folgende Worte voran, die es ganz klar gleich zu Beginn als Trauergesang, als Klagen- und Totenlied ausweisen:
Hab Geduld mit mir, wenn ich ihr Lied singe
Sie sind nicht hier, um zu singen
Sie wollten nicht singen
Wer singen will, weil muss, ist Rabinowitz, die Nachgekommene, die Dichterin, die mit einem Auftrag betraut ist: für sich wie für den Leser wird sie zum Sprachrohr der Ermordeten. Ihre Aufgabe ist das Benennen der verlorenen Leben, aber auch das Besingen der Leben vor der Ermordung, und dabei flicht sie in ihre eigenen Worte die wenigen überlieferten Worte von Menschen ein, die allesamt den Krieg nicht überlebt haben. Einer der Anlässe für „Darkling“ waren nämlich alte Fotos, Briefe und Postkarten von Rabinowitz‘ Vorfahren, von vor und während des Krieges. Die Autorin fand diese Dokumente auf dem Dachboden, in einem Schuhkarton ihrs Vaters, bei dessen Tod. Es sind diese Fotos und übriggebliebenen Worte und Sätze zweier jüdischer Familien, die Rabinowitz in ihr langes lyrisches Erzählstück eingeflochten hat. Sie sind ihr Ausgangspunkt und das, worum sie sich bewegt. Die Geschichten der einzelnen Personen klingen durch diese Fundstücke hindurch an, sind in dem Text durchweg präsent.
Eine zweite Besonderheiten „Darklings“ ist, dass es sich um ein Akrostichon handelt, sprich: Liest man die jeweils am äußersten linken Rand stehenden, großbuchstabigen Anfangsbuchstaben der Zeilen, so ergibt sich ein anderer Text, der „Darklings“ verstecktes Gerüst darstellt. Allerdings nur auf Englisch …
Als verborgenen Text für das Akrostichon hat Rabinowitz den zweiten wichtigen Anlass zu ihrem Text genommen, ein Gedicht von Thomas Hardy, das sie schon lange in Gedanken mit sich herumtrug: The Darkling Thrush, Die dunkelnde Drossel. Daher auch der Titel des gesamten Bandes, in dem man auch sonst – wenn man nicht wüsste, woher der Titel stammt – geneigt wäre eine Mischung aus dark und Darling zu erkennen. The Darkling Thrush ist sozusagen das alles tragende Geheimnis von Rabinowitz‘ Text.
Akrosticha sind, ganz grob gesagt, u.a. fester Bestandteil der jüdischen Tradition. Eine Variante ist der Abecedarius, wo der Anfang einer jeden Zeile dem (im Falle der jüdischen Tradition) hebräischen Alphabet folgt. Akrosticha kamen und kommen als mnemotechnische Hilfsmittel zum Einsatz, sie wurden und werden aber auch als Mittel angesehen, die Intention der Worte zu vertiefen oder ihre tiefere Bedeutung zu stützen oder auch neue, verborgene Bedeutungen zu befördern oder zu erschaffen.
Und so könnte man jetzt lange dem Wesen dieser alten Dichtkunst und Technik des Schreibens nachgehen und ebenso lange über die Übersetzungsproblematik eines solchen Textes nachdenken. Dazu fehlt hier aber natürlich der Platz.
Im Deutschen jedenfalls geht das Akrostichon von „Darkling“ verloren. Dem deutschen Leser wird allerdings sein ‚prinzipielles Vorhandensein‘ im englischen Original über das Nachwort von Rabinowitz vermittelt, allerdings im reinen ‚Trockenschwimmkurs‘, denn es fehlt ja nun mal das Wasser … Dies einfach als Feststellung, denn hätte man aus dem deutschen „Darkling“ ein Akrostichon machen wollen, die Übersetzung hätte sich (nochmal) zu etwas ganz Anderem ausgewachsen (und dabei ist jetzt noch nicht mal irgendetwas zur Machbarkeit oder Unlösbarkeit eines solchen Unterfangens überhaupt gesagt …).
Angesichts dieser nicht ganz unwichtigen Problematik wäre es allerdings umso wünschenswerter gewesen, dem Leser da a) etwas mehr entgegenzukommen, in dem über genau diese Schwierigkeit ruhig ein Wort hätte verloren werden dürfen, und b) wäre es deshalb genau auch wünschenswert gewesen, Hardys Gedicht nicht nur in deutscher Übersetzung abzudrucken, sondern ruhig auch den englischen Text in seiner vollen, vierstrophigen (also gar nicht so langen) Länge, und dazu dann einen – wenn auch sehr kurzen – Ausschnitt aus Rabinowitz‘ englischem Text, um so die große Komplexität von „Darkling“ und seinen Reichtum verständlicher, ja anschaulicher zu machen.
Um neben den im Nachwort stehenden Worten Rabinowitz‘ den deutschen Lesern eine winzige ‚akrostische Idee‘ zu vermitteln, wurde jedoch in der deutschen Ausgabe lediglich auf der Seite nach der letzten Textseite des Gedichts die letzte Zeile des Thomas Hardy-Gedichts auf Deutsch in eine Vertikale gesetzt. Dies wird jedoch sonst mit keinem Wort weiter erläutert. Das ist, mit Verlaub, recht schwach, wenn auch die Zeile selbst natürlich ihre unverkennbare Stärke hat. Sie lautet „Und ich war mir nicht bewusst“, sprich: Hardys letzte Zeile: „And I was unaware“. Irritierend nur, dass dann die abgedruckte deutsche Übersetzung von Hardys Gedicht gerade bei eben jener letzten Zeile mit einer ganz anderen (vielleicht nicht ganz so ‚glücklichen‘) Wendung aufwartet; da steht dann, aus dem Fluss dieser Übersetzung kommend: „doch von mir nie gedacht“. Dabei ist ohnehin auch nicht ganz klar, von wem nun diese deutschen Übersetzungen des Hardy-Textes stammen. Da es keine Angaben gibt, nicht zu der vertikal gesetzten Zeile noch zu der Gedichtgesamtübersetzung, geht man als Leser davon aus, dass es sich beide Male um die Übersetzung von Barbara Felicitas Tax handelt, die ja – übrigens gut (!) – das wahrlich nicht leicht zu übersetzende „Darkling“ übersetzt hat … Dann aber dem Leser kommentarlos zwei so unterschiedliche deutsche Varianten dieser Hardy-Zeile vorzusetzen und vom akrostischen Gerüst des Originals berichten zu lassen, das Englische Hardys aber und auch jedes dazugehörende englische Beispiel von Rabinowitz ganz außen vor zu lassen, und noch dazu mit keinem Wort auf die Übersetzungsproblematik einzugehen: da bleibt man als Leser leider doch ein wenig unzufrieden zurück.
Und das ist äußerst schade, denn Rabinowitz‘ Text, und zwar, wie gesagt, auch die hier vorliegende deutsche Fassung, ist jedem nur zu empfehlen, ja, sie ist vielleicht sogar ein Muss für jeden, der sich für jüdische Literatur und überhaupt Literatur des Erinnerns interessiert. Allerdings bleibt ein gewisses Sehnen nach dem englischen Original durchweg erhalten, und das wird eben durch das ungeschickte, etwas lieblose Vorgehen im Anhang des Buches noch verstärkt.
Um nun aber einen kleinen Eindruck der sehr anspruchsvollen Arbeit Anna Rabinowitz‘ mit der akrostischen Struktur zu geben, möchte ich hier nun, auf Englisch, die erste Strophe von Hardys Gedicht, die (logischerweise auch) die erste Zeile enthält, zitieren, sowie die ersten drei Worte dieser ersten Zeile ‚in Form von‘ „Darkling“:
I leant upon a coppice gate
When Frost was spectre-grey,
And Winter's dregs made desolate
The weakening eye of day.
The tangled bine-stems scored the sky
Like strings of broken lyres,
And all mankind that haunted nigh
Had sought their household fires.
Und „Darkling“ im wahrsten Sinne des Wortes darauf und damit:
Inside: a story —
inventories, incidents —
pleading to be flossed
from the teeth of silence —
Leaching congealed vowels
lately of / longing for / words —
Explanations not yet factored into claim: —
this is this —
that is that —As in first annunciations/ as in debuts
for old roles /
as if to atone:
yes, I love you —
Namers courting drifting sands,
fated to root heels,
Toes into dunes rampant with consonants of
Unreachable destinies,lonely nouns of hearts
Pilgriming to wished-for places
on the verbs
Of desire —
destinations where nothing feels
New but an aching need to shout out.
But an aching need to shout, Außer im schmerzenden Drang, aufzuschreien.
Ich sprach von der Vielschichtigkeit von „From My Mother’s House“. „Darkling“ nun ist, man erkennt es bereits, auf seine Art ebenfalls sehr, sehr vielschichtig. Der Leser erfährt nach und nach auch mal etwas längere Teile der Geschichte der ein oder anderen Person, Teile, die man sich ‚zusammenreimt‘, die sich – auch hier mosaikartig – ergeben bzw. zusammensetzen (lassen), doch auch hier bleibt, notgedrungen, alles bruchstückhaft.
wer wird die
Dinge der Dunkelheit als die eigenen anerkennen?
In diesem Satz vielleicht fasst Rabinowitz zusammen, was das Erinnern und sein Scheitern ausmacht und was es bedeutet und bewirkt: Man muss erinnern (Zwischen dem Übriggebliebenen–– / baut sich eine Geschichte auf––noch eine und noch eine––) und zugleich stößt man unweigerlich an seine Grenzen; man stößt an die Grenzen, doch ist die Durchquerung der Dunkelheit der einzige Weg.
Späte Zufluchten zwischen ausgefransten Echos
Überblendungen aus einer Reihe von Schatten––ich muss einen Weg finden durch diese unfassbare Dunkelheit, die darauf besteht, dass wir
uns ihren unermüdlichen Annäherungen hingeben.
[…]
es kann––nein!
es ist wahrer als Kunst!
Aber was ist das Leben? Und was ist die Kunst?––so große Fragen!
Leser, ich habe die Fragen zur Seite geschoben um mich darauf zu konzentrieren,
die Vergangenheit zu finden
wenn sie noch da ist.
Und dass sie noch da ist, beweist „Darkling“ bei allem benannten und zuzugestehenden ‚Unvermögen‘ auf nachdrückliche Weise!
Bevor ich nun ende – denn dies ist natürlich alles nach heutigem ‚Standard oder Ermessen der möglichen Aufmerksamkeitsspanne‘ von Internetlesern längst viel zu lang, doch wer bis hier gelesen hat, nicht wahr … – bevor ich also ende, schnell noch ein paar Worte zur Oper „Darkling“, oder vielmehr: zum Musikpart der Oper.
Man findet Ausschnitte der Inszenierung auf youtube. Dem Buch aber sind zwei CDs beigefügt, die die Musik nebst Sprecherparts der Oper bereithalten. Leider muss auch hier, in Bezug auf die CD-Präsentation im Buch, eine gewisse Lieblosigkeit oder fehlende Sorgfalt der Sache gegenüber konstatiert werden, denn die beiden CDs, die dem Buch beiliegen, sind überhaupt nicht beschriftet: kein Titel, kein Name, keine Information welcher Art auch immer, gar nichts. Sie sehen aus wie CD-Rohlinge. Es ist nicht mal vermerkt, welche der beiden CDs denn nun CD1 und welche CD2 ist …
Ansonsten ist – um auf den Anfang der Besprechung zurückzukommen – klanglich gesprochen „Darkling“ bei weitem nicht so experimentell, wie manchmal behauptet wird. Und es ist – auch wenn der Vergleich natürlich in gewisser Weise hinkt – weitaus unexperimenteller als „From My Mother’s House“, ja, es mutet sogar reichlich ‚klassisch‘ an. Ich persönlich kann dem reinen Hören der „Darkling“-CDs weniger abgewinnen als dem Lesen dieses beachtlichen Textes. Nicht, dass die Musik oder Machart oder die Aufnahme an sich schlecht wären (es kommt ja so auch das Englisch von Rabinowitz zu einem ins Haus), sie sind nur recht konventionell: viel Streicher, aber vor allem Sprecher, die bei allem gut gemachten ‚überlagerten Sprechen‘ manchmal ein wenig glatt anmuten, deren Vortrag bisweilen eben genau wie ein zu viel wollender Vortrag wirkt, etwas zu deklamatorisch, zu einstudiert vielleicht… (Und ich sage: manchmal, denn es gibt auch Momente, wo das greift.) Das mag schon auch seine Schönheit oder Faszination haben, aber es ist eben irgendwie – und gerade auch auf Dauer – einfach ‚zu schön‘ … und es fehlt dann doch die Bühnensituation, die – wie anzunehmen ist – alles im wahrsten Sinne des Wortes nochmal ganz anders aussehen ließe, die vielleicht ja im ganz positiven Sinne die Dinge auch mal zu brechen wüsste. (Und dies ist natürlich nochmal ein anderer, sehr wichtiger Themenkomplex, dem ich hier jedoch nicht weiter nachgehen kann.)
Die „Darkling“-CDs funktionieren jedenfalls ganz anders als „From My Mother’s House“, wo Intimität und Innerlichkeit geradezu Voraussetzung des Hörens sind – dort gilt: je mehr allein mit sich und dem Gehörten, umso besser. „From My Mother’s House“ ist für mich bei dieser Thematik und bei der Arbeit mit Stimme, Wort, Klang und Musik, die über CD zu einem kommt, bei der Arbeit an dem Zusammenkommen und Auseinanderklaffen von Worten und Musik, der interessantere Klang-Weg. Wer es eher ‚klassisch‘, weil bekannter mag – sowohl vom Kompositorisch-Instrumentalen als auch von der Art her, wie gesprochen wird, der hat sicher seine Freude am Hören der „Darkling“-CDs, die natürlich die Stimmen, denen sich Rabinowitz zu recht und zu unserem Glück verpflichtet fühlte, (in einer einzigen Sprache, nämlich auf Englisch) aufleben lassen und einen Resonanzraum kreieren, der eine ganz eigene Intensität entfaltet, gar keine Frage.
Und wirklich enden will ich nun mit einem Zitat aus einem Radiointerview mit Anna Rabinowitz. Als man sie zu Hardys Gedicht befragte, sagte sie, sie fühle sich (und sie bezieht sich auf die erste Zeile seines Gedichts) vielleicht ein wenig wie er, der auf das 19. Jahrhundert zurückblickt, das er für äußerst traurig erachtete, nur dass sie auf das 20. Jahrhundert zurückblickt, welches, was das Desolate angeht, das 19. Jahrhundert um Meilen übertrifft. Und dann spricht sie über das Ende von Hardys Gedicht, wo eine dürre Drossel einen Gesang anstimmt, einem Nachtgebet gleich. Es ist ein Gesang, der obendrein auch sehr nach Hoffnung klingt oder voll Hoffnung steckt. Und was Anna Rabinowitz dann sagt, ist das Nachhorchen mehr als wert – vielleicht auch gerade in unserer Kultur, wo man mit Worten wie ‚Hoffnung‘ schon längst abgeschlossen zu haben glaubt, ohne sich überhaupt noch die Mühe zu machen, auch nur darüber nachzudenken, ob und was sie vielleicht bedeuten könn(t)en, wie ihre Bedeutung mit Leben zu füllen sei.
Auf die Frage, wie das denn zusammengehen würde, all diese zerstörten, vernichteten Leben und das unendlich Traurige und Trauernde, das Unwiederbringliche und dann dieser seltsam hoffnungsvolle Drosselgesang, gibt sie zur Antwort:
„Yes, exactly, but they [all these people and their voices] are here, they are alive for a moment, they are being celebrated. Even the broken and destroyed earth needs to be celebrated. Even destroyed life needs to be remembered and honored and valorized because what is most important is our lives, that’s our gift: our lives.”
(“Ja, genau, aber sie [alle diese Menschen und ihre Stimmen] sind hier, sie sind für einen Moment lebendig, sie werden gefeiert. Selbst die gebrochene und zerstörte Erde muss gefeiert werden. Selbst zerstörtem Leben will gedacht sein und es muss geehrt und es muss ihm Wert zugemessen werden, denn das Wichtigste sind unsere Leben, das ist unser Geschenk: unsere Leben.“1 )
- 1. Die Übersetzungen aus dem Englischen der Zeilen Abraham Sutzkevers sowie des Radiozitats von Anna Rabinowitz stammen von mir.
Fixpoetry 2014
Alle Rechte vorbehalten
Vervielfältigung nur mit Genehmigung von Fixpoetry.com und der Urheber
Dieser Artikel ist ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt. Sie dürfen den Artikel jedoch gerne verlinken. Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder.









Neuen Kommentar schreiben