Flüsse sind die Lebensadern der Kulturen. Sie verbinden ganze Kontinente und an ihren Ufern hat immer schon der Austausch zwischen Menschen und Völkern stattgefunden. Auch heute noch. Das Grazer MURTON FESTIVAL erkundet diese multikulturellen Begegnungsräume entlang des Flusses, entdeckt und belebt die heißen Sommernächte mit Programmen, die quer durch die Ethnien, ihre Musik und ihre Kulturen führen.
(MURTON GRAZ 2012 Programmheft)
Die Welt am Fluss

Das erstmalig über die neue Freiluftbühne am Mariahilferplatz gehende MURTON Festival for contemporary music styles and culture lässt sowohl verwöhnte Grazer Musikliebhaber als auch Gäste der Stadt ganz schön aufhorchen.
 Es heißt, man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Beim neuen Murton Festival gestatte ich mir dieses Lob jedoch schon nach der ersten besuchten Vorstellung. Da kann nichts mehr schief gehen, außer vielleicht, dass uns der Himmel auf den Kopf fällt. Aber auch in dieser Hinsicht kann Petrus nichts anstellen, denn die neue überdachte Bühne am Mariahilferplatz trotzt jedem Regenguss.
Es heißt, man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Beim neuen Murton Festival gestatte ich mir dieses Lob jedoch schon nach der ersten besuchten Vorstellung. Da kann nichts mehr schief gehen, außer vielleicht, dass uns der Himmel auf den Kopf fällt. Aber auch in dieser Hinsicht kann Petrus nichts anstellen, denn die neue überdachte Bühne am Mariahilferplatz trotzt jedem Regenguss.
Warum sage ich das? Der für das täglich (bei freiem Eintritt!) präsentierte Hauptprogramm gewählte Platz hat sowohl jahrelange Tradition als auch ein wunderschönes Ambiente. Kopfsteinpflaster, alte Herrenhäuser, moderne Architektur, gute Infrastruktur und ist an ganz Graz sowohl über das Radwegenetz als auch die Tram gut angebunden. Die neue Bühne ist schön, hat eine hervorragende Akustik und bietet 300 sitzenden Zuhörern Platz, sowie noch weit mehr Zaungästen. Und wie eingangs erwähnt, bietet sie auch ein Dach zum Schutz gegen eventuelle Naturgewalten. Sie muss die Stadt Graz wohl Unmengen gekostet haben, wird aber sicher einer Reihe von Veranstaltungen jahrein jahraus gute Dienste leisten. Weitere Venues wie die Postgarage, GMD und das PPC ergänzen mit Nachtvorstellungen.
Vom Programm her ist ebenso ein Hörgenuss garantiert. Mein erster Abend, ein Montag. Ed Partyka, nuBox & Concept Art Orchestra (USA/Deutschland/Tschechien/Slowakei) hat mich schlichtweg umgeblasen. Die solistischen Leistungen aller Musiker waren großartig, Ed Partyka hatte keine Mühen, sich durch hunderte einzelne Seiten Partitur hindurch zu blättern und dabei zu dirigieren, und die synthetischen Einspielungen zu den „6 Movements of Sonification“ gaben dem begeisternden Orchester noch den letzten Touch. „Bigbandtronics“, ein neuer Begriff für meine Ohren. Jazz vom Feinsten.
Heute führt uns Vesna Petkovic auf den Balkan mit Gypsy Brass aus Rumänien. Nicht entgehen lassen.
Überhaupt ist das Programm sehr international, nicht immer Weltmusik im ursprünglichen Sinn, aber Musik aus aller Welt, was am Mittwoch noch in einer sogenannten „Welttafel“ münden soll, wo eine kulinarische Weltreise in 8 Gängen bevorsteht. Inklusive Tischmusik. Ich bin schon gespannt.
Abgerundet wird das Programm nach der „langen Nacht am Fluss“ noch durch einen Happen Literatur am letzten Tag, „a little alien“ im Kulturzentrum Minoriten. Der „Versuch des Ankommens in Worten“ zu Mittag geht abends in die „Spoken Poetry – Die Welt im (Rede-)Fluss“ über. Natalie Resch hat diesen Programmpunkt gestaltet, so wie zuvor schon jeder Tag von einem Kurator präsentiert wurde.
Vielleicht treffe ich irgendwo Hansjürgen Schmölzer, der im Dramaturgie und Presse Projektteam des Festivals mitarbeitet. Vor 30 Jahren haben wir gemeinsam an der Uni Graz studiert. Auch wenn sich an der Mur die Welt trifft, Graz bleibt doch ein Dorf. Wenn auch ein sehr kultiviertes und freundliches Dorf.
Das Festival läuft noch bis zum 19. August 2012. Das Programm gibt es auf www.murton.at zu sehen.

Ed Partyka, nuBox & Concept Art Orchestra © Gerald Ganglbauer.
Graz, am 14. August 2012
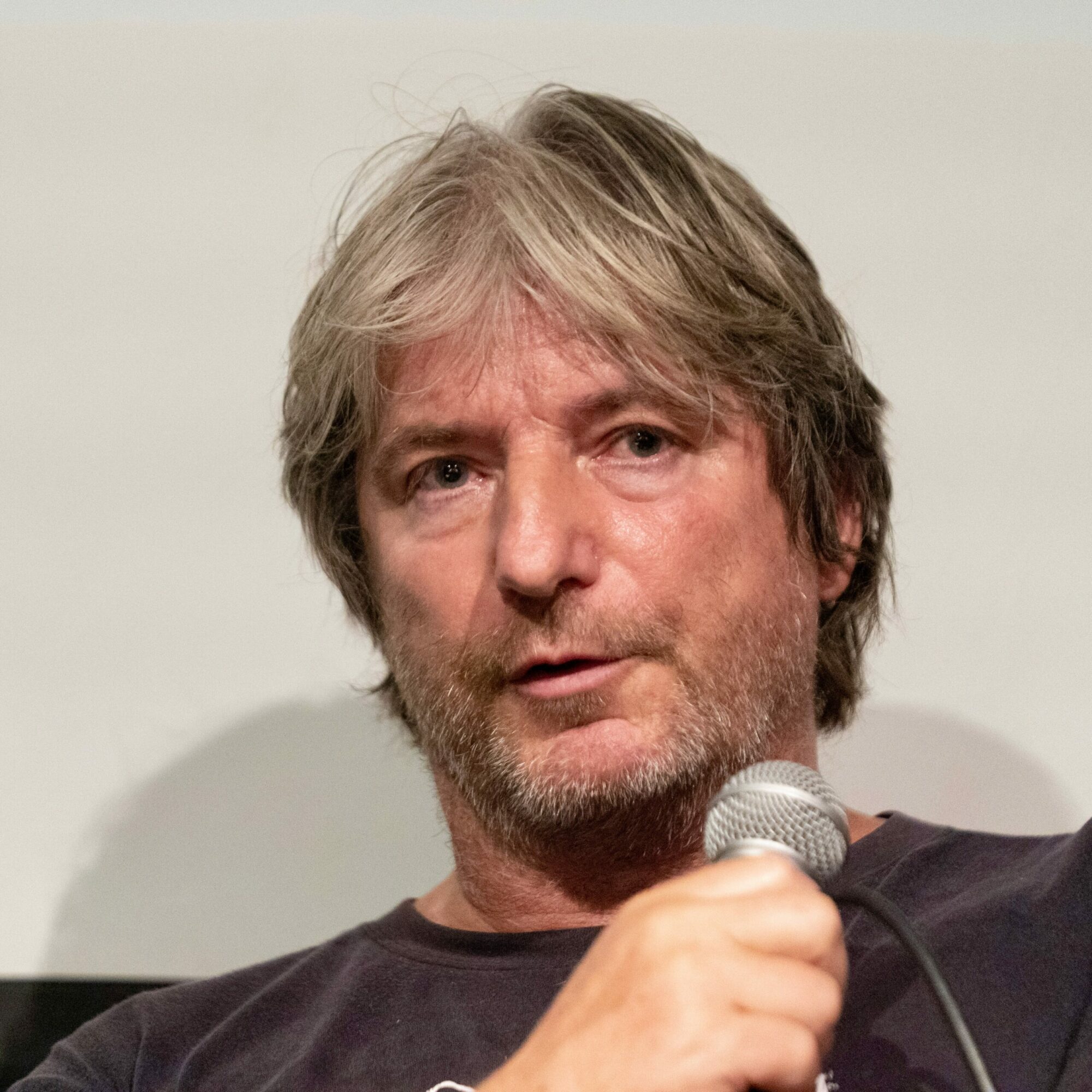
 Nach fünf Jahren stetem Wachstum, doppelt so großen Plakaten wie am Anfang und mit dem Kampfschrei „Pfui, die Literatur geht wieder auf die Straße“ habe ich schließlich das kleine Festival der Worte aufgegeben, weil ich erst nach Wien und dann nach Sydney gegangen bin. Wer weiß, wo die Grazer Straßenliteraturtage heute wären, hätte ich weiter gemacht.
Nach fünf Jahren stetem Wachstum, doppelt so großen Plakaten wie am Anfang und mit dem Kampfschrei „Pfui, die Literatur geht wieder auf die Straße“ habe ich schließlich das kleine Festival der Worte aufgegeben, weil ich erst nach Wien und dann nach Sydney gegangen bin. Wer weiß, wo die Grazer Straßenliteraturtage heute wären, hätte ich weiter gemacht. Hier nur eine kleine Auswahl an Programmpunkten vom 27. Juli bis 5. August 2012. Das gesamte Programm gibt es auf www.lastrada.at zu sehen.
Hier nur eine kleine Auswahl an Programmpunkten vom 27. Juli bis 5. August 2012. Das gesamte Programm gibt es auf www.lastrada.at zu sehen.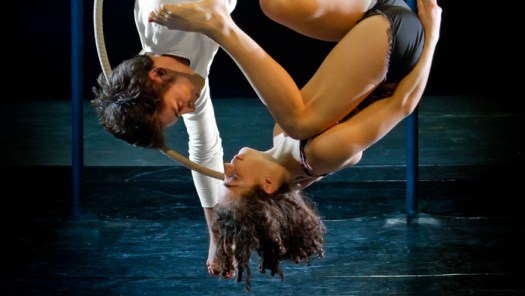


 Der Inhalt des Paketes: zwei schlichte weisse Bände im Schuber; mit zusammen rund 450 Seiten die Dokumentation eines Labor – Salon – Symposiums am Collegium Helveticum der ETH Zürich, sowie eine überarbeitete Chronik Walter Gronds, die in einer wöchentlichen NZZ-Kolumne veröffentlicht war. Grond, der seit dem Ausscheiden aus dem Grazer Forum Stadtpark in einem 400-Seelen-Dorf in Niederösterreich als Romancier und Essayist lebt, war von Fehr, dem stellvertretenden Leiter des Collegium Helveticum, im Frühjahr 2002 als ‘Writer in Residence’ nach Zürich geladen, “um gemeinsam mit anderen über das ‘Schreiben am Netz’ nachzudenken”.
Der Inhalt des Paketes: zwei schlichte weisse Bände im Schuber; mit zusammen rund 450 Seiten die Dokumentation eines Labor – Salon – Symposiums am Collegium Helveticum der ETH Zürich, sowie eine überarbeitete Chronik Walter Gronds, die in einer wöchentlichen NZZ-Kolumne veröffentlicht war. Grond, der seit dem Ausscheiden aus dem Grazer Forum Stadtpark in einem 400-Seelen-Dorf in Niederösterreich als Romancier und Essayist lebt, war von Fehr, dem stellvertretenden Leiter des Collegium Helveticum, im Frühjahr 2002 als ‘Writer in Residence’ nach Zürich geladen, “um gemeinsam mit anderen über das ‘Schreiben am Netz’ nachzudenken”.
 Unser Holden parkt als einziges Fahrzeug auf einem kleinen Parkplatz abseits der Seitenstraße, die Luft ist kühl und feucht im australischen Herbst, überhaupt hier im Süden Victorias, am 633 Meter hohen Mount Dandenong, knapp eine Autostunde von Melbourne entfernt. Freunde haben mich hierher gebracht, ohne mir viel über jenen Einsiedler zu erzählen, der hier unter meterhohen dunkelgrünen Farnen lebt: William Ricketts. Ein Bildhauer sei er, und ein Philosoph – du wirst schon sehen.
Unser Holden parkt als einziges Fahrzeug auf einem kleinen Parkplatz abseits der Seitenstraße, die Luft ist kühl und feucht im australischen Herbst, überhaupt hier im Süden Victorias, am 633 Meter hohen Mount Dandenong, knapp eine Autostunde von Melbourne entfernt. Freunde haben mich hierher gebracht, ohne mir viel über jenen Einsiedler zu erzählen, der hier unter meterhohen dunkelgrünen Farnen lebt: William Ricketts. Ein Bildhauer sei er, und ein Philosoph – du wirst schon sehen.






