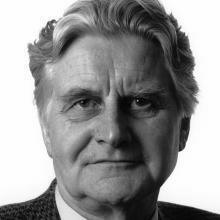|
Home Termine Autoren Literatur Blutige Ernte Quellen Politik Geschichte Philosophie Zeitkritik Sachbuch Bilderbuch Filme Töne Preisrätsel |
|||
| Glanz&Elend Literatur und Zeitkritik |
Anzeige  Glanz&Elend Glanz&ElendDie Zeitschrift kommt als großformatiger Broschurband in einer limitierten Auflage von 1.000 Exemplaren mit 176 Seiten, die es in sich haben. Ohne Versandkosten bestellen! |
||
|
Bücher & Themen Glanz & Elend empfiehlt: 50 Longseller mit Qualitätsgarantie Jazz aus der Tube u.a. Sounds Bücher, CDs, DVDs & Links |
Sprachspiel und ideale Kommunikationsgemeinschaft Karl-Otto Apel zum 90. Geburtstag Von Peter V. Brinkemper
© Suhrkamp Verlag
Jürgen Habermas machte sich aufgrund des Oxforder Mainstream der Ordinary Language Philosophy die Mittel der Präsuppositionsanalyse Austins und die klassifikatorische Sprechakt-Schematik eines Searle zunutze, um seine sozialphilosophisch ausgelegte Theorie der kommunikativen Rationalität als Zusammenspiel mehrerer Geltungsansprüche sprechakttheoretisch zu untermauern und sie durch systemtheoretische Gegengewichte der Funktionalität und Entfremdung durch Macht, Technik, Stategie und Geld zu einem posthegelianischen und kontra-luhmannianischen Paradigma gesamtgesellschaftlicher Handlungsrationalität, auf der Grenze zwischen politisch steuerbarer Lebenswelt und einem wie auch immer eigendynamischem System mit kolonisatorischen Effekten zu verwandeln.
Karl-Otto Apel dagegen
blieb in seinen frühen Aufsätzen und späteren Studien immer
philosophie-historisch und philosophisch-reflexiv: Er hielt an einer scheinbar
überschwänglich utopischen Idee der idealen Kommunikationsgemeinschaft fest,
deren transzendentalphilosophische Begründung sich aber seit den 80er Jahren bis
heute als immer bedeutsameres Paradigma erwies. Wittgensteins
Sprachspiel-Gedanke war für Apel ein immerwährendes Untergrund- und
Hintergrundmotiv. Das Konzept des Sprachspiels gab dem Verweis auf die
existentialhermeneutische Analyse des menschlichen Daseins in Heideggers "Sein
und Zeit" ein sprachanalytisches und dabei philosophiehaltiges Unterfutter, das
dem Einsamkeitspathos der deutschen Durchhaltephilosophie zwischen Sorge und Tod
die gesellschaftliche Lebendigkeit einer diskurs- und kritikfähigen Rede und
Gegenrede einhauchte. Das Sprachspielargument brachte zugleich Apels Reflexionen
zu Kants Ethik und zur Kritik an dem latent protestantisch-monologischen
Charakter des Kategorischen Imperativs und seines innerlichen Freiheitsbegriffes
auf die richtige Spur, die Universalisierung von Normen mit der Voraussetzung
einer politikrelevanten und beizeiten auch rebellisch einsetzbaren Diskursethik
zu verbinden, in der die Normenlegitimation überlieferte Ethikfiguren zwischen
Tugend, Utilität, Norm, Wert, Gesetz und Verantwortung aufgriff und integrierte,
vor allem aber gobal-universell-dialogische Form annahm, bestenfalls als offene,
ideale Argumentationsgemeinschaft zukunftsfähiger Weltbürger, denen die
Begründung und Widerlegung von Maximen, Regeln und Gesetzen kein Hinterzimmer-
oder Stammtischgespräch war, sondern ein philosophisches,
öffentlichkeitsfähiges, kooperativ-rivalisierendes Sprachspiel jenseits von
Ideologie, Macht, Herrschaft und Unterdrückung im grauen Alltag realer, noch von
einander abgegrenzter Kommunikationsgruppierungen und Parteien. Nicht zuletzt
hat die feinschrittige, unakademische und spekulativ spätromantische Semiotik
von Charles Sanders Peirce mit ihrer subtilen Verbindung von epistemologischen,
ästhetischen und ethischen Argumenten dazu geführt, Apels Ansatz zwischen
Existenz, Ethik und Sprachwerdung zu einem originellen Ansatz einer unbegrenzten
intersubjektiven Diskursivität ausreifen zu lassen, der auch heute noch den
Maßstab einer begrifflich ausformulierbaren Modernität und Aktualität abgibt,
weil er weder in die Falle der stumm-positivistischen Technokratie, noch des
emotional-hysterischen Medienbeschleunigung, oder in die Unverbindlichkeit
eines realitätsfernen Idealismus oder in die fatale Hinnahme eines Privatleute
und Staatsträger ausbeutenden Raubtierkapitalismus geht, sondern den Sinn der
Anwendung ethischer und politischer Geltungsansprüche für die Gewaltenteilung
von System und Lebenswelt überzeugend entfaltet.
|
||
|
|
|||