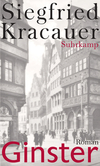|
Termine Autoren Literatur Blutige Ernte Quellen Politik Geschichte Philosophie Zeitkritik Sachbuch Bilderbuch Filme Töne Preisrätsel |
|||
|
|
Anzeige  Glanz&Elend Glanz&ElendDie Zeitschrift kommt als großformatiger Broschurband in einer limitierten Auflage von 1.000 Exemplaren mit 176 Seiten, die es in sich haben. Ohne Versandkosten bestellen! |
||
|
Bücher & Themen Artikel online seit 07.04.13 |
|
||
|
Siegfried Kracauer kommt
1889 in Frankfurt am Main zur Welt. Es ist das Gründungsjahr der Berliner
Morgen-Zeitung, in Paris eröffnet die Weltausstellung, der Eiffelturm wird
fertig gestellt und für den Publikumsverkehr freigegeben, Vincent van Gogh malt
Sonnenblumen und Friedrich Nietzsche publiziert seine Götzen-Dämmerung,
eine Art Zusammenfassung seines Denkens. Kracauers Straßen- und Städtebilder, sein außergewöhnlicher Blick auf kulturelle und soziale Phänomene, auf menschliche Verhaltensweisen und gesellschaftlichen Wandel haben ihn bei vielen geisteswissenschaftlich interessierten Lesern bekannt gemacht. Die Polemiken, Studien und Glossen, Kritiken und Reportagen dieses einzigartigen Denkers sind pures Lesevergnügen. Seine Philosophie gipfelt in dem ersten Satz seiner Schrift Das Ornament der Masse, einer Erkundung der Exotik des Alltags, 1963 bei Suhrkamp erschienen: »Der Ort, den eine Epoche im Geschichtsprozess einnimmt, ist aus der Analyse ihrer unscheinbaren Oberflächenäußerungen schlagender zu bestimmen als aus den Urteilen der Epoche über sich selbst.« Siegfried Kracauer ist allerdings auch heute noch zu entdecken: Die Theorie des Films (1960), das großartige Buch über Jacques Offenbachs Paris und das Second Empire (1937), oder jenes über die Spezies der Angestellten (1930). Die Stadt Frankfurt liest nun seinen Roman Ginster, Ende 1928 erschienen und vom Börsenblatt des deutschen Buchhandels mit den Worten angekündigt: »Auch so war der Krieg!« Der Roman ist autobiographisch komponiert, der Held wie Kracauer ein junger Architekt, in der Gesellschaft überflüssig und störend, weil er nicht mit dem Strom schwimmt und innerlich gegen die Kriegsbegeisterung seiner Zeitgenossen von 1914 rebelliert. Ginster stolpert und stottert durch eine Welt, in der das Absurde der Normalfall ist. In seinem Verhalten erinnert er ein wenig an Herman Melvilles Bartleby, den Schreiber (1853), dessen grotesk konsequente Weigerung, bestimmte Handlungen auszuführen, seine Mitwelt zur Verzweiflung bringt: »I would prefer not to« ist die immer wiederkehrende Maxime Bartlebys, der sich auch Ginster in Bezug auf den Kriegsdienst verpflichtet sieht. Der Roman ist bereits nach seinem Erscheinen Ende 1928 eine kleine Sensation. Hermann Kesten bringt die Gründe auf den Punkt: »Ginster decouvriert, er enthüllt, er deckt auf, sich, die andern, die hohlen Institutionen, die hohlen Begriffe, die hohlen Redensarten, die hohlen Konventionen, die an Stelle vernünftiger Erwägungen und vernünftiger Äußerungen treten.« Die Aktion Frankfurt liest ein Buch in diesem Frühjahr wird eine überaus positive Nebenwirkung haben: Kracauer wird einmal mehr wiederentdeckt und von vielen Zeitgenossen gelesen, die sich bis dato kaum oder gar nicht mit ihm auseinandergesetzt haben. Es ist zu hoffen, dass es nicht allein bei der Lektüre von Kracauers erstem Roman bleibt.
Ich muss zugleich
gestehen, dass mich auch ein gewisses Befremden beschleicht, wenn ich höre, dass
eine ganze Stadt ein Buch liest. Befremden vor allem gegenüber einem Publikum,
das nachliest, was andere ihm vorlesen; und Befremden darüber, dass die Masse
der Leser den Kritiker der Massen unter sich zu begraben droht. Wie immer bei
Literaturveranstaltungen für ein Massenpublikum ist da gleichsam die Gefahr,
dass ein Buch nur der Zerstreuung dient, das Event zur »hohlen Institution«
wird, also zu einem Ort, wie Kracauer selbst befürchtete, an dem die Menge keine
Wünschelruten mehr hat, sondern nur noch Wünsche. Dagegen hilft allein, über den
Ginster einen Einstieg in Kracauers vielfältiges Werk und damit in seine
faszinierende Gedankenwelt zu finden. Freilich ist das auch nur ein
Urteil der Epoche über sich selbst, und es gilt, sich ein eigenes zu bilden! |
Warum Kracauer |
||
|
|
|||