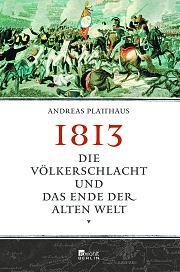|
Termine Autoren Literatur Krimi Quellen Politik Geschichte Philosophie Zeitkritik Sachbuch Bilderbuch Filme Töne Preisrätsel |
|||
|
|
Anzeige  Glanz&Elend Glanz&ElendDie Zeitschrift kommt als großformatiger Broschurband in einer limitierten Auflage von 1.000 Exemplaren mit 176 Seiten, die es in sich haben. Ohne Versandkosten bestellen! |
||
|
Bücher & Themen Artikel online seit 19.08.13 |
|
||
|
Trotz des erstaunlichen Wandels der Militärhistoriographie zu einer „Kulturgeschichte der Gewalt“ haben operationsgeschichtliche Studien weiterhin ihren unbestreitbaren Wert. Man denke nur an die bahnbrechenden Untersuchungen von Karl-Heinz Frieser vom Potsdamer Militärgeschichtlichen Forschungsamt über die „Blitzkrieglegende“ oder die brillante Arbeit des Schweden Peter Englund über die Schlacht von Poltawa (1709), ganz zu schweigen von Gordon Craigs Klassiker über die Schlacht von Königgrätz (1866). Von diesen Gipfeln der Operationsgeschichte bleibt der Feuilletonist Andreas Platthaus mit seinem Versuch über die so genannte Völkerschlacht von Leipzig (1813) allerdings weit entfernt. Aus welchem Grund er sich überhaupt mit diesem Thema befasst hat, verschweigt der Verfasser abgesehen von einigen gelegentlich eingestreuten Andeutungen. Anstelle einer Skizzierung des aktuellen Forschungsstandes (vielleicht auch vom Verlag nicht gewollt) oder wenigstens der Nennung seiner leitenden Fragestellungen startet Platthaus sogleich als „Appetizer“ mit einem reißerischen Porträt Napoleons, dessen magere Quintessenz schließlich darin besteht, dass der kriegerische Korse angeblich lieber in einem Zeltlager seine Nächte unter seinen Soldaten verbrachte als im komfortablen Malmaison. Denn schon ist der Verfasser mit einer anderen Sache beschäftigt, arbeitet hierbei mit mehr oder weniger ausführlichen Rückblenden und folgt nur mühsam dem eigentlichen Handlungsstrang. Ein erratischer Erzählstil mit häufigen Themenwechseln prägt leider das ganze Buch und verursacht alles andere als Lesefreude. Vor allem kann sich Platthaus nicht wirklich entscheiden, ob er eine konventionelle Geschichte der Schlacht aus der Perspektive der Feldherren und Monarchen schreiben oder doch lieber die Sicht der einfachen Soldaten oder der Leipziger Bürger einnehmen wollte, für die immerhin die Invasion zweier gigantischer Armeen mit mehreren Hunderttausend Kämpfern tatsächlich eine existenzielle Katastrophe bedeutete.
Als zentrale Aussage
seiner Schilderung gelangt Platthaus zu der erstaunlichen These, dass Leipzig in
der Geschichte der europäischen Kriegsführung eine Wendemarke darstellt. Während
zwar noch die Monarchen – angeblich letztmalig - auf dem sächsischen
Schlachtfeld anwesend waren, übernahmen doch schon mehr und mehr professionelle
Militärs mit ihren rasch wachsenden Stäben die Leitung der Operationen.
Abgesehen davon, dass der Verfasser erstaunlicherweise zu diesem Urteil gelangt,
ohne die komplexe operative Vorgeschichte der Schlacht von Leipzig überhaupt zu
würdigen, hatten auch bis zu diesen denkwürdigen Tagen nur wenige gekrönte
Häupter in Europa ihre Armeen auf die Schlachtfelder geführt. Karl XII. von
Schweden und Friedrich II. von Preußen bildeten hier als so genannte rois
connetables die großen Ausnahmen unter ihren Standesgenossen, während die
feldherrlichen Ambitionen des habsburgischen Erzhauses tatsächlich erst in der
Gestalt seines vorletzten Herrschers Franz Josef gut ein halbes Jahrhundert
später bei Solferino (1859) kläglich Schiffbruch erleiden sollten. Um hier ein
zutreffendes Bild zu gewinnen, hätte sich Platthaus schon etwas mehr in die
europäische Militärgeschichte mit ihren Protagonisten und wechselnden Strukturen
vertiefen müssen. Der leidenschaftliche Streit im Lager der Alliierten, ob der
Hauptstoß auf die sächsische Handelsmetropole von Süden her geführt oder ein
konzentrischer Angriff von allen Seiten gewagt werden sollte, taucht in
Platthaus‘ Schilderung überhaupt nicht auf. Ebenso wenig erwähnt er die damals
in Militärkreisen engagiert geführte Debatte über die Vor- und Nachteile eines
Kampfes auf der „Inneren Linie“, worauf sich ja Napoleons Operationsführung bei
Leipzig hauptsächlich stützte, mit keinem Wort. |
Andreas
Platthaus |
||
|
|
|||