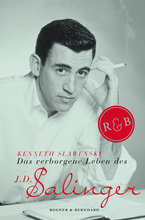|
Termine Autoren Literatur Blutige Ernte Quellen Politik Geschichte Philosophie Zeitkritik Sachbuch Bilderbuch Filme Töne Preisrätsel |
|||
|
|
Anzeige  Glanz&Elend Glanz&ElendDie Zeitschrift kommt als großformatiger Broschurband in einer limitierten Auflage von 1.000 Exemplaren mit 176 Seiten, die es in sich haben. Ohne Versandkosten bestellen! |
||
|
Bücher & Themen Artikel online seit 20.01.13 |
|
||
|
»Kein Epitaph. Ich dachte an
Holden Caulfields Abscheu vor all den Heuchlern, die Blumen auf Allies Grab
legten, doch plötzlich andere Prioritäten hatten, als es zu regnen anfing.
Salinger glaubte nicht an den Tod, das wußte ich. Ich mußte ihm einen Salut
ausbringen, der von Dankbarkeit, nicht von Trauer sprach.« (Aus dem Vorwort) Da ist seine Schwester Franny, die mit ihrem langweiligen Freund Schluss macht und dann zu Hause zusammenbricht, weil der sie und ihr Bemühen um das »Jesus-Gebet« nicht versteht und auch nicht verstehen will. Da ist ihr Bruder Zooey, der mit ihr spricht und sie dann von einem Telefon anruft, mit verstellter Stimme, und ihr als ihr Bruder Buddy den Kopf zurechtrückt, indem er ihr von Seymours Rat für ein besseres Leben erzählt. Da ist die Schwester Boo Boo, die ihren Sohn davon überzeugen muss, aus dem kleinen Boot auszusteigen, in das er sich verkrochen hat, nachdem er in der Schule beleidigt worden war, mit einem antisemitischen Schimpfwort, das er nicht einmal richtig verstanden hatte. Währenddessen unterhalten sich die Putzfrau und die Köchin des Hauses, und auch sie sind unterschwellig antisemitisch. Viele der Geschichten von Jerome David Salinger (1919 – 2010) sind autobiografisch unterfüttert, und Kenneth Slawenski unternimmt es in seiner Biografie, diesen Hintergrund zu erzählen. So erfährt man ausführlich von Salingers Vorkriegsreise nach Europa, wo er in Polen in einer Fleischfabrik Schweine zerlegte (etwas unkoscheres gibt es überhaupt nicht) und sich in Wien mit einer jüdischen Familie anfreundete, die von den Nazis später umgebracht wurden. Man liest von Salingers Zeit während des Krieges, vor allem die fürchterliche Schlacht im Hürtgenwald, die ihn nachhaltig schockiert hat – man ahnte das als Leser schon in seinen Geschichten »Für Esmé mit Liebe und Unrat« und »Kurz vor dem Krieg gegen die Eskimos«, in denen die Hauptpersonen erschütterte, instabile junge Männer sind, die mit dem Leben nicht klarkommen – so wie Holden Caulfield auch, der seine Geschichte ja aus einem Sanatorium heraus erzählt. Wie es überhaupt in vielen seiner Geschichten vor allem um Krisen, Lebenskrisen, Ehekrisen, spirituelle Krisen geht. Slawenski erzählt auch von Salingers Verhören ehemaliger Gestapo-Mitglieder und seiner seltsamer Ehe mit Sylvia, einer Deutschen, der er zur Verlobung 1945 einen gefälschten französischen Pass besorgte. Am 10. Mai 1946 nahm er sie mit nach New York – im Juli war Sylvia bereits wieder in Europa, bald danach wurde das Paar geschieden. Ausführlich geht Slawenski auf Salingers Bemühungen ein, ein berühmter Autor zu werden, seine Kontakte zu Zeitschriftenredakteuren, dem New Yorker, seine Verhandlungen mit den Verlegern, vor allem seinen Ärger mit Verlegern, die sich nicht an seine Anweisungen halten. Sehr empfindlich und auch nachtragend war Salinger und konnte dann auch mal den Kontakt abrupt und für immer abbrechen. Vor allem über Journalisten ärgerte er sich – und das gab dann auch den Anstoß für seinen völligen Rückzug Anfang der sechziger Jahre, seine völlige Verweigerung, am literarischen Leben teilzuhaben. Auch wollte er nicht der Ratgeber für eine orientierungslose Jugend sein, und man kann nur ahnen, was er dachte, als er erfuhr, dass der Mörder von John Lennon sich auf Holden Caulfield, den »Fänger im Roggen« berief. All das, auch Salingers intensive Beschäftigung mit Buddhismus und Hinduismus, erzählt Slawenski in großer Breite und mit vielen Details, die er jahrelang mühsam recherchiert hat, eine Aufgabe, für deren Erledigung man ihm dankbar sein muss. Natürlich stand auch er vor dem Dilemma, entweder möglichst viele Fakten aufzuzählen oder sich knapp zu halten. Letztlich muss jeder Leser selbst entscheiden, ob es zu viel oder zu wenig ist. Dankbar ist man ihm für die Details über all die Kurzgeschichten, die zwar einmal in Zeitschriften erschienen, aber nie als Buch gesammelt wurden und auch nie ins Deutsche übersetzt wurden. Zu viel des Guten tut Slawenski dann aber bei den überlangen Nacherzählungen der Geschichten, die seit vielen Jahren auf dem deutschen Buchmarkt präsent sind, manche jetzt auch wieder neu übersetzt. Da hätte er sich sehr viel kürzer fassen können. Was auch fehlt, sind eine Zeittafel und ein paar Fototafeln in guter Qualität. Und das letzte Geheimnis, wie viel Bücher Salinger noch geschrieben hat, kann auch Slawenski nicht lüften. Denn zwar weiß er, dass es die Manuskripte gibt, aber wie viele es sind und ob wir sie je zu sehen bekommen, das weiß auch er nicht. Und so bleibt immer noch ein letztes Geheimnis um diesen großen Mann der amerikanischen Literatur. |
Kenneth
Slawenski |
||
|
|
|||