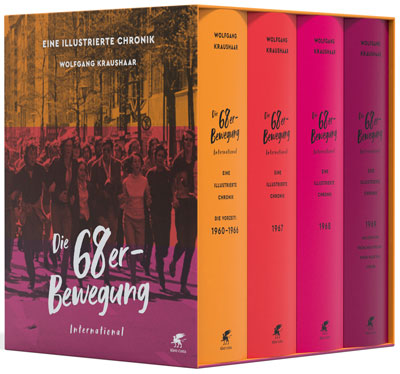|
 Die
4 (beinahe 12 kg) schweren Bände behandeln den Zeitraum von 1960 -
1980. Zentrale Jahre sind 1967 und 1968. Zahlreiche handverlesene
Fotos illustrieren Zeit, Stimmung, Orte und Personen. Das alles wird
von kenntnisreichen Texten begleitet. Die
4 (beinahe 12 kg) schweren Bände behandeln den Zeitraum von 1960 -
1980. Zentrale Jahre sind 1967 und 1968. Zahlreiche handverlesene
Fotos illustrieren Zeit, Stimmung, Orte und Personen. Das alles wird
von kenntnisreichen Texten begleitet.
Man kann mit Recht sagen, daß dies DAS Standardwerk der Geschichte
der 68-er ist, daß ihm eine jahrzehntelange akribische Recherche-
und Archivarbeit zugrundeliegt (vor allem ein Verdienst von
Kraushaar und der Hamburger Stiftung zur Förderung von Wissenschaft
und Kultur). Bemerkenswert auch, daß Kraushaar sein gesamtes
Berufsleben der Erforschung eines Abschnitts der Geschichte, an der
er selbst beteiligt war (mit all ihren Höhen und Tiefen), gewidmet
hat. Alles in allem eine einzigartige und erstaunliche Leistung.
Wenn aber jemand ein Geschichtswerk verfaßt, herausgibt oder
editiert, der am Zustandekommen der Ereignisse, über die zu
berichten ist, selbst beteiligt war, muß man vernünftigerweise von
einer nicht ganz zu vermeidenden Parteilichkeit ausgehen. Das
betrifft gleichermaßen den an den Ereignissen beteiligten
Rezensenten des Werks. Beide werden nolens volens besagte Ereignisse
nach ihrer eigenen Skala bewerten, die das Ergebnis ihrer
persönlichen Erfahrungen mit Personen und Ereignissen sein muß. Es
ist demnach für uns beide weder eine völlig unvoreingenommene
Geschichtsschreibung noch eine ebensolche Rezension möglich. Es
läuft unvermeidlich auf subjektive Bewertungen hinaus.
Im Ergebnis bewertet Kraushaar m. E. die 68-er Bewegung (bei aller
vorgebrachten und deutlichen Kritik - siehe seine Bücher zu »Die
blinden Flecken der 68-er Bewegung« - und »Die blinden Flecken der
RAF«) positiver als der Rezensent, wobei letzterer womöglich
unbefangener urteilt, eben weil die 68er-Bewegung nicht Gegenstand
seines Berufslebens war, seine Erinnerungen sich zudem durch den
mittlerweile erheblichen zeitlichen Abstand anders verändert haben
mögen als bei jemandem, der sich ein Leben lang mit dem Thema
beschäftigt hat.
Kraushaar weiß sich zudem in guter Gesellschaft, denn es gilt ja als
ausgemacht, daß unser Land sich durch das einigermaßen segensreiche
Tun der 68-er zur heutigen vorbildlichen liberalen Demokratie
gemausert habe. Nur würde ich dem glatt widersprechen und hilfsweise
(da wo tatsächlich Verbesserungen feststellbar sind) unsere
Autorenschaft bestreiten, denn wir waren - bei allem Lärm - nur ein
kleiner Bestandteil der Gesellschaft, die sich auch ohne unser Zutun
verändert hätte - und die ja mit Sicherheit auch uns selbst
verändert hat. Ebenso sinnlos ist es natürlich, die 68-er für alles
haftbar machen zu wollen, was seither schiefgelaufen ist.
Das Stöbern durch die 4 Bände ruft mir nun nicht unmittelbar eigene
Erlebnisse ins Gedächtnis. Viees davon ist mir mittlerweile fremd
geworden. Dafür weht mich beim Blättern eine Ahnung an von der
Vergeblichkeit menschlichen Tuns im Allgemeinen - und dem meiner
Generation im Besonderen, die vor allem eins, nämlich nie alt werden
wollte. »Hope to die before I get old«, wollten The Who 1965, und
Bob Dylan wünschte sich und uns 1973 »May you stay forever young«.
Das Beste an uns ist sicher unsere Musik, und die ist mir nicht
fremd geworden.
Der Startschuß fiel gewissermaßen am 2. Juni 1967 in Berlin. Er traf
den Studenten Benno Ohnesorg. Abgegeben hatte ihn ein Polizist,
hinterrücks und heimtückisch, weil Ohnesorg an einer Demonstration
gegen den Schah von Persien teilgenommen hatte. Der Schah war mir
egal, ich hätte kaum gegen ihn demonstriert (er war schließlich
geladener Gast), aber daß deutsche Polizisten einen Studenten
erschießen würden, der lediglich von seinen demokratischen Rechten
Gebrauch gemacht hatte, das war auf keinen Fall hinzunehmen. Ohne
diesen Mord wäre die 68er Bewegung in Deutschland sicher anders
verlaufen.
Kraushaars Werk beginnt aber weit früher und behandelt viel mehr:
nämlich die Aktivitäten der Studenten-, der Jugend-, der
Bürgerrechts- und Befreiungsbewegungen auf der ganzen Welt. Es wirkt
auf mich heute, als hätten die Leute damals überall echte Probleme
gehabt: in der DDR, in den USA, in Vietnam, Afrika, Griechenland,
China, im Nahen Osten, in Lateinamerika und anderswo. Wir hingegen
waren hauptsächlich solidarisch, hatten bestenfalls Phantomschmerzen
(wie den bereits verlorenen Kampf gegen Hitler, den »tausendjährigen
Muff« unter den Talaren oder den Nato-Doppelbeschluß).
Das Anziehendste an uns war zweifellos unser grandioses
Zusammengehörigkeitsgefühl, unsere Version von »Einer für Alle und
Alle für Einen«, das sich teilweise bis heute gehalten hat.
Darüberhinaus hatten wir nicht wirklich was zu bieten. Wir
propagierten mit »Aussteigen« und »Leben in Alternativwelten« zwar
sympathische Konzepte, die sich für die meisten jedoch nicht als
lebbar erwiesen, fetischisierten gleichzeitig Begriffe wie
Gerechtigkeit, Gleichheit und Kollektiv, womit wir nebenher ein
halbwegs funktionierendes Schulsystem ruinieren halfen. Wir haben
sinnlos Autorität als solche vernichtet, heute könnten wir dringend
welche brauchen. Wir wollten im Zweifel alles - am liebsten etwas
Surreales wie den freien Blick aufs Mittelmeer. Irgendwann lief das
Ganze gewaltig und gewalttätig aus dem Ruder.
Schlimmeres haben vermutlich die Grünen (sie wollten immer sehr
Reales) verhindert, was übrig blieb, ist (nicht nur) dank der
Grünen, zwar blöd genug - aber kein deutsches
Alleinstellungsmerkmal. Wir leben heute, mit Verlaub, in einer
vollkommen durchbürokratisierten, moralinsauren, humor- und
ironiefreien, uneleganten und uncharmanten Welt, die seltsamerweise
einigermaßen gut funktioniert, den tonangebenden Klugscheißern und
Bedenkenträgern zum Trotz, in der aber grundsätzlich jedem vorab
immer das Schlechteste unterstellt werden muß (vor allem Promis,
Politikern, Bankern und Managern) und diese üble Vorrede sich auch
noch als Bürgersinn ausgibt.
In dieser Welt haben wir, die Guten, immer recht, wollen, daß die
Leute gefälligst nach unserer Facon leben, ob sie dabei selig
werden, ist uns wurscht - wir handeln schließlich in höherem
Auftrag. Die Leute, die wir derart ignorieren, wählen zu unserer
Verblüffung in Massen die AfD, führen in asozialen Netzwerken einen
gemeinsam-einsamen Kampf gegen das »verhaßte System« - oder sie
rotten sich wie in Frankreich zusammen und schlagen alles kurz und
klein - es ist eine schlechte Kopie des Mai 68, die sich da und
anderswo manifestiert, weil ohne jede Vorstellung von Utopie. Unterm
Pflaster liegt nicht mehr der Strand, sondern die Kanalisation - und
sie stinkt.
Wir nehmen nicht mal zur Kenntnis, daß es hier vor allem um Respekt
geht, weswegen der Versuch, die Leute mit Almosen ruhig zu stellen,
fehlschlagen muß. Wobei besagte Leute, die Fetische unserer Jugend,
das hohe Lied von Gleichheit und Gerechtigkeit skandierend, noch
weniger als wir damals wissen, was sie eigentlich wollen, aber
gleichwohl sicher sind, daß es so nicht weitergeht. Da ist ein
Gefühl von drohendem Unheil, das zumindest mich beim Blättern durch
Kraushaars Werk beschleicht.
Viele jedoch, die damals dabei waren (und denen ihre Vergangenheit
nicht peinlich ist - da gibt es nicht wenige) werden in der riesigen
Materialsammlung von Kraushaar vor allem nach Vergewisserung,
Bekannten und Bekanntem suchen.
Alle anderen wären (wie ich sehr oft höre) gern dabeigewesen. Für
sie ist Kraushaars Chronik unserer verlorenen Zeit ein süffiger
Abenteuerroman, an den man gehen sollte wie Burt Lancaster einst an
den »Roten Korsaren«: Glaubt nur, was ihr seht – nein, glaubt nicht
einmal die Hälfte davon!
Artikel online seit 17.01.19
|
Wolfgang Kraushaar
Die 68er–Bewegung
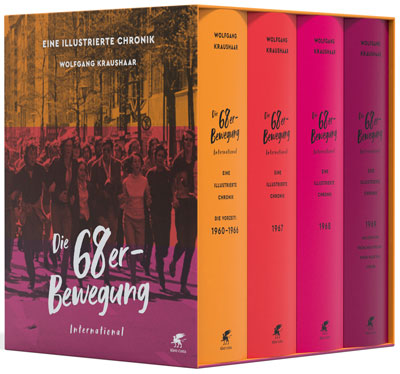
Eine illustrierte Chronik
1960 – 1969
Klett-Cotta
2000 Seiten,
199,00 €
Leseprobe
Foto: Wolfgang
Kraushaar, 2012
bei den Roemerberggesprächen in Ffm.
Creative Commons
Attribution-Share Alike 3.0 Unported |