Später bereute Rousseau diese Argumentation, sprach davon, dass das er »von dem Moment an verloren« gewesen sei, als er diesen Vortrag gehalten habe. Ist es das, was Rousseau meinte, als er in seinen Bekenntnissen die Ausschreibung der Akademie als eine Art Erweckungsmoment beschrieb: »Im Augenblick, als ich dies las, sah ich eine andere Welt, und ich wurde ein anderer Mensch«?
Dieser Satz gibt dem von Henning Ritter herausgegebenen Edelband philosophischer Briefe seinen Titel. Ich sah eine andere Welt präsentiert zwanzig ausgewählte Briefwechsel von Jean-Jaques Rousseau mit bedeutenden Persönlichkeiten seiner Zeit, die der im Juni 2013 verstorbene Ritter für Geisteswissenschaften Henning Ritter aus der mehr als 40 Bänden umfassenden Korrespondenz ausgewählt und übersetzt hat. Er will mit den Briefen, in denen sich Rousseau über Erziehungsfragen, die Aufklärung und seine Positionen zu den Religionen äußert, das »Drama der religiösen und philosophischen Spannungen« von Rousseaus Zeit nachvollziehbar werden lassen.
Der von Henning Ritter präsentierte Rousseau beweist sich an vielen Stellen als Humanist im besten Sinne. Sein Dasein begründet er darin weltlich, zeigt sich aber der Existenz gegenüber religiösen Mythen sehr offen und tolerant, ohne diesen aber eine politische Funktion zuzugestehen. So schreibt er etwa an Voltaire: »Die großartigste Vorstellung, die ich mir von der Vorsehung machen kann, die wäre, dass jedes vernünftige und empfindende Wesen im Verhältnis zu sich selbst auf die bestmögliche Weise eingerichtet ist, mit anderen Worten, dass es für den, der sein Dasein fühlt, besser ist, zu existieren als nicht zu existieren.«
Voltaire seinen naiven Glauben an eine Unsterblichkeit der Seele eingestehend macht Rousseau aber zugleich auch deutlich, dass derlei Fragen religiöser oder mystischer Positionierung des Einzelnen nicht zum allgemeinen Gut erwachsen dürfen. »Wie sie bin ich darüber erzürnt, dass der Glaube eines jeden nicht die vollkommenste Freiheit genießt und der Mensch es wagt, das Innerste des Gewissens, in das er doch nicht eindringen kann, zu überwachen, als ob es von uns abhinge, an Dinge, für die es keinen Beweis gibt, zu glauben oder nicht zu glauben, und als ob man die Vernunft jemals der Autorität unterwerfen könnte. … Wenn ein Mensch dem Staat redlich dient, schuldet er niemandem Rechenschaft darüber, wie er Gott dient.«
Die Idee eines säkularen Staates, in dem Staat und Kirche getrennt voneinander existieren, zugleich aber ein möglichst hohes Maß an weltanschaulicher Toleranz herrscht, nimmt Rousseau hier vorweg – wohl auch, weil er sich selbst nie vollkommen von einer wie auch immer gearteten Religiosität distanzierte.
Henning Ritters Zusammenstellung der Briefe ist ein literarischer Schatz des philosophischen Diskurses. Aus der Lektüre der Briefe wird das Denken, Umdenken und Neudenken von Positionen und Ansichten deutlich, wie es nur im Dialog entstehen kann. Die Auseinandersetzung mit dem Gegenüber ist es, die Rousseaus Theorien haben entstehen lassen, wobei – dies muss angemerkt sein – er sich nicht als Wendehals und Anpasser beweist, sondern als prinzipientreuer Moralist, der der Erkenntnis und der Auseinandersetzung gegenüber aufgeschlossen ist.
Es wird ein Dialog sichtbar, der sich zwischen grundsätzlicher Offenheit und persönlichem Rückzug bewegte und wie er auch schon in von Croÿs Aufzeichnungen seiner Begegnung mit Rousseau aufleuchtete. In seinen Briefen tat Rousseau genau das, was er als öffentliche Person und Schreiber nicht mehr wollte: Zeugnis ablegen. Hier greift er die Kritik an seiner Person und das Infragestellen seiner Haltungen auf und ging in die Argumentation.
So hat er etwa den Autokraten und Diktatoren in seinen Briefen an die Tugend jedes Berufen auf seinen Gesellschaftsvertrag aus der Hand genommen, als er schrieb, dass man »die bürgerliche Ordnung von ihren Missbräuchen unterscheiden« müsse. Nur weil sie missbraucht werden könne, sei sie nicht grundsätzlich schlecht.
Den religiösen Eiferern nahm er das Argument, dass der Glaube an ein göttliches Wesen notwendig sei, um Gutes zu tun. All jenen, die die religiöse Moral als unentbehrlich für ein friedliches Zusammenleben ansahen, hielt Rousseau die rote Karte vor. »Das Gesetz, Gutes zu tun, wird aus der Vernunft selbst gewonnen; und der Christ braucht nichts als Logik, um tugendhaft zu sein.«
Teilweise waren die Anlässe der Briefe profaner Natur, dabei aber nicht minder lesenswert. Dem deutschen Prinz Ludwig Eugen von Württemberg gab er brieflich Erziehungsratschläge, weil dieser seine Tochter nach den in Emile niedergelegten idealen erziehen wollte. Den Geschäftsmann Pierre-Alexandre Du Peyrou bat er um finanzielle Unterstützung, in Gegenleistung gab er Botanikstunden. Seiner großen Liebe Sophie d’Houdetot machte Rousseau briefliche Aufwartungen und Komplimente, wissend, dass es vergebens ist, aber in tiefer Verbundenheit für die gemeinsamen Stunden.

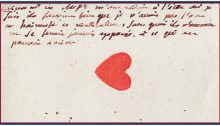
[…] dabei stets keine unwesentliche Rolle, egal ob es sich um Casanovas Geschichte meines Lebens, Jean-Jacques Rousseaus Bekenntnisse oder Catherine Millets Beichte Das sexuelle Leben der Catherine M. handelt. Jan […]
[…] nachts durch die Straßen und über Friedhöfe (parallel dazu liest er nun Jean-Jacques Rousseaus Träumereien eines einsam Schweifenden). Dabei stößt er auf seltsame Botschaften (»Die Gesellschaft existiert nicht«, »Frankreich ist […]