Die Ästhetik von Wallace galt als eine der größten Herausforderungen bei der Übersetzung von »Unendlicher Spaß«, dieses Oszillieren zwischen Sachlichkeit und Intimsprache. Worin liegt die Herausforderung an Cohens »Witz«?
Auch hier geht es um Ästhetik, aber auch um den verschwenderischen Einsatz von Ironie als sprachlichem Mittel. Um nur ein Beispiel zu nennen: es gibt eine Passage, die die alttestamentarischen Geschlechterkataloge aufgreift, also »Methusalem zeugte Lamech und Lamech zeugte Noach« und so weiter und so fort. Cohen nimmt in der Passage das Wort zeugen und permutiert es in mehreren Zeilen, wie in einem Rap. Im Biergarten am Wannsee hat er mir diese Passage vorgerappt – also auch hier die musikalische Prosa. Es sind sechs bis acht Zeilen, die etymologisch nur auf ein einziges Wort, nämlich beget, zurückgehen und auf Benjamin enden. beget und Benjamin, beide Wörter beginnen mit be-, aber was mache ich damit? Luther schreibt für beget »zeugen«, zeugen bekomme ich aber mit keiner Permutation zu Benjamin gewandelt. Das sind so Probleme, vor die mich der Roman ästhetisch stellt; und bei denen mir der Autor nicht helfen kann, es sei denn, er hätte es anders geschrieben. In »Witz« zeigt Cohen, wie sehr er mit allen Wassern der Ironie gewaschen ist und sich über das für ihn Entsetzlichste, Desaströseste und Zerstörerischste immer noch komisch auslassen kann.
Noch einmal kurz zu Wallace. Du hast bereits vor seinem Selbstmord mit der Übersetzung von »Infinite Jest« angefangen. Standst du mit ihm damals in Kontakt?
Nein, leider nicht. Wir nehmen an, dass er seinem Agenten signalisiert hat, Kontaktanfragen abzulehnen. KiWi-Verleger Helge Malchow versuchte damals erfolglos, seinen Kontakt zu Wallace auf mich auszuweiten. In einem Interview hat Wallace einmal gesagt, dass er ziemlich schlechte Erfahrungen mit einem Übersetzer gemacht hat. Marcus Ingendaay, der vor und neben mir Wallace übersetzt hat, wird es sicher nicht gewesen sein. Aber es wird an diesen schlechten Erfahrungen gelegen haben, dass Wallace danach grundsätzlich keinen Kontakt zu seinen Übersetzern wollte. Ich fand das damals sehr schade, nicht nur, weil ich verschiedene Fragen zum Text mit ihm hätte besprechen wollen, sondern vor allem, um mit ihm mal ein Bier zu trinken und über was auch immer zu reden. Ich hätte diesen Hyperintellektuellen einfach gern in einer Alltagssituation erlebt. In diesem Wunsch steckt natürlich eine Menge Neugier à la »Wie ist der Typ, wenn er nicht schreibt?«.
Helfen dir persönliche Eindrücke der Autoren beim Übersetzen ihrer Werke?
Mitunter hilft das schon, denn mein Text entsteht in dem Fall anders. Zum Beispiel höre ich aktuell »In His Own Words«, die bei Hachette erschienenen Lesungen von Wallace als Hörbuch. Das sind teilweise Mitschnitte von Livelesungen seiner späten Erzählungen, bei denen die Leute vor Lachen am Boden liegen. Ich hatte diese Geschichten gar nicht als so komisch in Erinnerung. Wallace setzt hier seine typischen Übersteigerungen ein, setzt immer noch eins drauf, und die Leute können nicht genug davon bekommen. Erst da habe ich gemerkt, dass das wenn nicht seine Intention, dann doch zumindest die Rezeption seiner Werke in den USA ist. Das war für mich ein ganz wichtiges Feedback, nicht zum Übersetzen – die Erzählungen sind ja längst erschienen –, aber für die Frage, wie verschieden man Texte auch fassen kann. Und natürlich hätte ich deshalb auch gern erlebt, wie er seine Texte lebt und liest, und wie er über sie spricht.
Im vergangen Sommer sind Joshua Cohens Erzählungen »Vier neue Nachrichten« in deiner Übersetzung erschienen. Während die Stories in den USA von der New York Times auf die Liste der besten Bücher 2012 gesetzt wurden, war die Kritik in Deutschland verhalten. Worauf führst du das zurück? Liest man hierzulande anders?
Grundsätzlich ja, wenngleich es etwas differenzierter ist. Wenn etwas in den USA rezensiert wird, dann wird das auf einem sehr hohen Niveau gemacht. In den USA gibt es hervorragende Literaturkritiker, allerdings nur sehr wenige. Hochliteratur hat in den USA einen schwierigeren Stand als in Deutschland, weil deutsche Kritiker die sogenannte anspruchsvolle Literatur anders pushen. Hochliteratur ist im deutschen Feuilleton quantitativ ganz anders präsent als in den amerikanischen Zeitungen, qualitativ aber nicht unbedingt. Die deutschsprachigen Kritiker waren mit den Erzählungen zum Teil überfordert. Sie hatten Probleme mit Cohens Ironie. Das habe ich schon einmal bei dem schwarzamerikanischen Autor Paul Beatty erlebt, der in seinem Roman »The White Boy Shuffle« [die deutsche Übersetzung von Ulrich Blumenbach ist 1999 unter dem Titel »Der Sklavenmessias« bei Rowohlt erschienen] höchst absurd und ironisch über die Konflikte der schwarzen Community mit dem weißen Rassismus schrieb. Deutsche Leser fanden hier nur schwer einen Zugang, weil die Stoßrichtung der Ironie, also gegen wen und von welcher Warte aus sie vorgetragen wurde, nicht ausreichend deutlich wurde. Das Buch war dann ein ziemlicher Flopp. Bei Cohens Erzählungen habe ich ein ähnliches Gefühl, seine Ironie ist einfach zu abgefahren. Manche Gesprächspartner sind ihm sogar im Interview auf den Leim gegangen. So stand in der Literarischen Welt, er würde ein Filmdrehbuch für Musils »Der Mann ohne Eigenschaften« für HBO schreiben. Das hat er sich einfach spontan ausgedacht, sein Gegenüber hat es aber nicht gemerkt. Cohen ist ein Typ, der dir so etwas mit einem todernsten Blick erklärt. Das ist bezeichnend, denn er schreibt manchmal auch so, weshalb man nicht immer merkt, um wie viele Ecken herum er seinen Stoff ins Ironische verschiebt.
Kritiker in Deutschland haben es in einem stärkeren Verhältnis mit Übersetzungen zu tun als die in den USA. Werden deutsche Literaturkritiker hier ihrer Verantwortung, die Übersetzungsleistung ausreichend zu würdigen oder zu kritisieren, gerecht? Können sie dieser Verantwortung überhaupt gerecht werden? Mitglieder der Jury zum Leipziger Buchpreis haben mir gegenüber ganz unumwunden zugegeben, dass niemand aus der Jury die Ausgangssprache des ausgezeichneten Romans »Judas« von Amos Oz spricht.
Rezensenten und Lektoren in den Verlagen sollten meines Erachtens die Originalsprache der zugrundeliegenden Bücher kennen, denn erst dann können sie kompetent beurteilen, was ein Übersetzer aus der Vorlage gemacht hat. Trifft die Dauerfloskel »kongenial« zu in dem Sinne, dass alle Techniken, Strategien und Anspielungen des Originals auf gleicher Ebene reproduziert worden sind? Oder ist möglicherweise an der Intention des Textes vorbeiübersetzt worden? Beim Deutschen Übersetzerfonds e.V. versuchen wir grundsätzlicher das Verständnis für die Qualität einer Übersetzung zu fördern, so dass Lesende allein durch die Lektüre ein Gespür dafür bekommen, ob sie es mit einer guten oder schlechten Übersetzung zu tun haben. Die Tolstoi-Übersetzerin Rosemarie Tietze spricht hier von der »Bringschuld« eines Textes, die die Übersetzenden plausibel in ihrer Übertragung rekonstruieren müssen, so dass der Text den Lesern selbst sagen kann, wo er hin will. Das grundlegende Problem, das Kritiker nicht alle Sprachen sprechen oder verstehen können, bleibt dennoch bestehen. Aber Rezensenten müssen in der Lage sein, immanente Kriterien der Übersetzung zu entwickeln, um zu begründen, warum eine Übertragung ihrer Ansicht nach gelungen oder nicht gelungen ist.


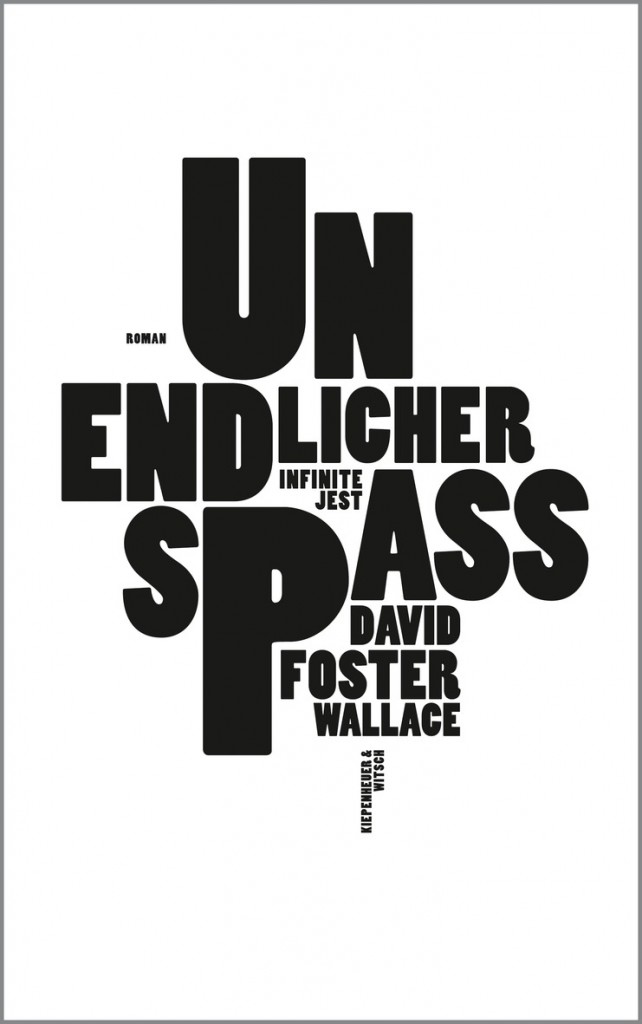

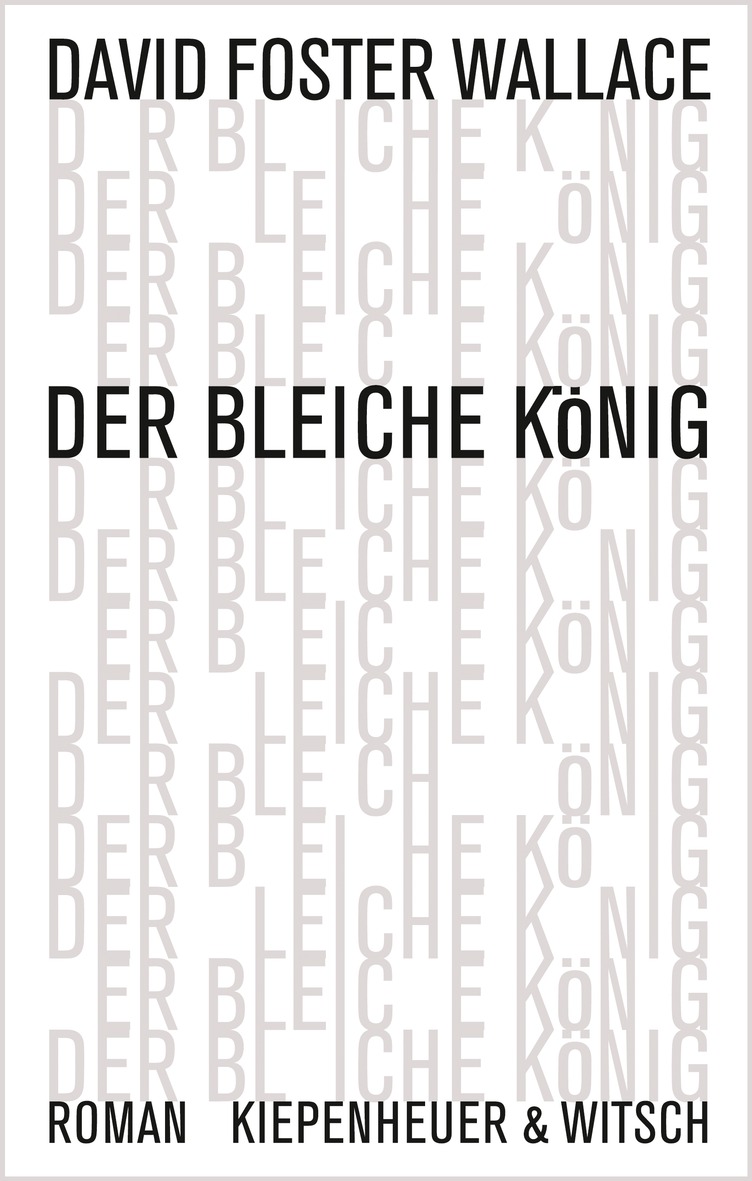
[…] Die Geheimniskrämerei um seine Person erinnert an die Mythen, die an Namen wie Thomas Pynchon und David Foster Wallace geknüpft sind. Wie wir dort von den zwei ehrgeizigen Leserforschern Eric und Jen erfahren, […]
[…] Der Traum von ewiger »Pralinen-Prosa« […]
[…] ist kein Zufall, dass der renommierte und mit dem Leipziger Übersetzerpreis bereits ausgezeichnete Ulrich Blumenbach im Gespräch die Kenntnis der Originalsprache bei Rezensenten und Lektoren einforderte, »denn erst dann können […]
[…] zuvor ein gewisser George Lucas mit dem ersten Star Wars-Film die Messlatte weit nach oben schob. David Foster Wallace schrieb in dem Essay »David Lynch bewahrt kühlen Kopf«, dass der Film dennoch wegweisend für […]
[…] sie, die Wirklichkeit, selten so gut eingefangen, wie in Pynchons komplexen Welten, der noch vor David Foster Wallace und Don DeLillo als die Ikone der postmodernen amerikanischen Literatur gilt. Dass er seit 1953 die […]