Maschinelle Intelligenz vermehrt sich explosionsartig und diese Feststellung ist der Ausgangspunkt für die Intelligenz-Revolution. Auf die Frage, ob Computer jemals so intelligent sein werden wie Menschen, antwortete der Science-Fiction-Autor und Informatiker Vernor Vinge kurz und knapp: »Ja, aber nur für kurze Zeit!«. Wir werden über kurz oder lang damit konfrontiert sein, dass fast alles, was Menschen können, Maschinen irgendwann besser können. Wir stehen vor dramatischen Veränderungen in der Arbeitswelt, in unserem Wirtschaftssystem, in unserem gesellschaftlichen Zusammenleben. Gleichheit wird nicht nur ein politisches Problem sein, sondern auch ein Problem unseres Wirtschaftssystems. Bereits jetzt ist erkennbar, dass ein Gespenst der Ungleichheit durch den globalisierten Kapitalismus schwebt. Die Reichen werden reicher, die Armen werden ärmer, dazwischen grassieren Angst und Unsicherheit. Die wachsende Ungleichheit in Besitz und Vermögen hat direkt mit dem massenhafter Einsatz digitaler Technologien zu tun. Hochqualifizierte werden produktiver, Routine-Jobs werden ersetzt, etliche müssen in schlechtbezahlte Serviceberufe ausweichen. Die Intelligenz wird neu verteilt, die Arbeitswelt gruppiert sich in folgende Kategorien: Computer übernehmen gut definierbare Jobs, Menschen übernehmen alles, was vage und komplex ist. Sensibilität, Empathie, Einfühlungsvermögen und Feinfühligkeit sind Eigenschaften des Menschen, die Computer in Kürze nicht erlernen werden. Noch werden die Sensibilitäten des Bürgertums belohnt. Was aber wird passieren, wenn auch Computer sensibel werden, wenn Computer anfangen zu träumen? Do Androids Dream of Electric Sheep?
Die Überlebensstrategie des Menschen wird sein, uns an die Maschinen anzupassen. Und die Welt an die Maschinen anzupassen. Das Ganze nennt sich dann embedded intelligence. Auch, weil Digitalität stets ewige Vorläufigkeit heißt. Nur was ständig verändert wird, bleibt bestehen. Die ständigen Veränderungen sorgen dafür, dass das, was bestehen bleibt, niemals dasselbe ist, sondern das Veränderte. Wir werden uns auf weitere Neuerungs- und Intelligenzexplosionen gefasst machen.
Ebenso auf das, was Kucklick Kontroll-Revolution nennt. Von Natur aus ist der Mensch einfach identifizierbar, weil er erwartbare, vorhersagbare Leben führt. Uns Menschen kennzeichnet ein hohes Maß an zeitlicher und räumlicher Regularität beziehungsweise eine »lebensgeschichtliche Stimmigkeit«. Daher sind unsere Identitäten auch so leicht zu entschlüsseln. Das konnte auch schon die Soziologie und die Demografie. Nicht Daten als solche sind entscheidend, sondern deren Transformation in Wissen. Mit der Digitalisierung reichen schon kleine Datenbestände, um uns in unserer Einzigartigkeit erkennbar zu machen. Wir sind zurück in jener Kontrollgesellschaft, die Gilles Deleuze Anfang der 1980er Jahre entwickelt hat. Dass im Hintergrund das Konzept der Disziplinargesellschaft von Michel Foucault, das er Mitte der 1970er Jahre beschrieben hat, hervorstrahlt, sei nur am Rande erwähnt. Allerdings ist die digitale Kontrollgesellschaft wesentlich smarter: Wir werden nicht ausgebeutet, sondern ausgedeutet, nicht mehr gezwungen, sondern moduliert, Emotionen werden nicht mehr unterdrückt, sondern gesteuert. Oder mit anderen Worten: Verführung statt Zwang, Ausdeutung statt Ausbeutung, Modulierung statt Kommandos, Beeinflussung statt Befehle. Allerdings bleibt: Menschen werden sortiert, kontrolliert, ja, und auch diskriminiert.
Die Kontroll-Revolution löst das Vertrauen auf, das wir in Unternehmen und Institutionen investieren. Vor allem die staatlichen Stellen sind auf diese Entwicklung nicht oder nur unzureichend vorbereitet. Seit geraumer Zeit können wir feststellen, dass die Institutionen der öffentlichen Hand, wie Verwaltungen, Universitäten, Schulen, Bibliotheken oder Museen, die immer noch den Geist des 18. und 19. Jahrhunderts atmen, für das 21. Jahrhundert ungenügend aufgestellt sind. Es bedarf einer dringenden Modernisierung dieser Institutionen. Mit der Digitalisierung stellt sich zudem die Frage, wie der Staat eine Gesellschaft in steter Beschleunigung, wie sie Hartmut Rosa in seiner Studie zur Veränderung der Zeitstrukturen in der Moderne oder Byung-Chul Han in seinem Bestseller Müdigkeitsgesellschaft oder seiner Topologie der Gewalt beschrieben haben, steuert? Festzuhalten ist: Differenz-, Intelligenz- und Kontroll-Revolution überfordern unsere staatlichen Strukturen. Gerade unseren Bildungseinrichtungen steht, Gott sei Dank, eine Revolution bevor. Sie ist auch dringend nötig.
Eine kritische Anmerkung in diesem Kontext. Die granulare Gesellschaft hat keine geeigneten Formen des kollektiven Protests hervorgebracht. Auch ehemals erfolgreiche Formen und Formate des Widerstands befinden sich im Status der Auflösung. Die Singularisierung durch das Netz bringt kein neues kollektives Subjekt als politischen Akteur hervor. Das Netz verbindet, es mobilisiert aber nicht. Die Arabellion ist nicht die Gegenthese, sondern die Bestätigung. Ebenso Aufstieg und Fall der Piraten-Partei. Wie ist also die Zukunft kollektiver Aktionen in der granularen Gesellschaft? Vor allem auch deswegen, weil die Regierungen die größten Nutznießer der Digitalisierung sind. Wie schon in der Moderne reagiert auch in der granularen Gesellschaft der Staat auf die zunehmende Komplexitätssteigerung mit dem Ausbau staatlicher Stellen. Kucklick macht den Staat als Zentralgefahr der granularen Gesellschaft aus. Computer sind Regierungsmaschinen, sie sind nicht nur Diener der Verwaltung, sie sind es, die den Bürger konstituieren. Ohne Daten kein Staat, ohne eigene Daten kein Mitglied der Gesellschaft. Ein neuer Gesellschaftsvertrag, ein Gesellschaftsvertrag in der digitalen Moderne ist notwendig.
Der granulare Mensch muss sich neu erfinden. Und das im Zeitalter der Kränkung. Die Liste der Sätze, die mit »Nur wir Menschen können…« anfangen, wird immer kürzer. Die Einzigartigkeit des Menschen erfährt eine permanente Relativierung. Was ist der Mensch in der granularen Gesellschaft? Kucklick stellt vier mögliche Entwicklungen vor, Ausgang ungewiss. Sicher ist aber, dass die Entwicklung auf eine Koevolution von Mensch und Maschine herausläuft. Der granulare Mensch wird sich in Netzwerken verteilen, neu gruppiert und systematisiert, durch seine Irritierbarkeit wird er jede Menge neue Anregungen und Impulse erfahren. »Und so gewinnt der granulare Mensch Kontur: Er wird spielend experimentieren, um die Maschinen zu begreifen. Er wird voller Empathie sein, um die Differenzen zu den anderen zu überbrücken. Und er wird launisch sein und unberechenbar, um die Mechanismen der gesellschaftlichen Kontrolle nach Kräften zu unterlaufen.«
Die Digitalisierung als technisch-technologische Entwicklung löst enorme Veränderungen aus, tiefgreifende Veränderungen in der Textur und in den Strukturen des gesellschaftlichen Miteinanders. Kucklick unterläuft aber nicht der Fehler, sich in technizistischen Utopien und oberflächlichen gesellschaftlichen Hypothesen zu verlieren, sondern er stellt das eigentliche Subjekt (und Objekt) der Welt in den Mittelpunkt: den Menschen. Das ist die große Stärke seines Buchs. Eine enorme intellektuelle Leistung, die man in den gängigen Digitalisierungsbüchern so vermisst. Er legt damit die Grundlage für eine Mentalitätsgeschichte des Digitalen und Zukunft des Menschen im Digitalen. An Die granulare Gesellschaft werden diejenigen, die sich ernsthaft mit Digitalisierung beschäftigen, nicht vorbeikommen. Jetzt schon ein Klassiker!
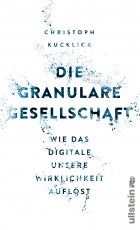 Christoph Kucklick: Die granulare Gesellschaft. Wie das Digitale unsere Wirklichkeit auflöst
Christoph Kucklick: Die granulare Gesellschaft. Wie das Digitale unsere Wirklichkeit auflöst
Ullstein Verlag 2014
272 Seiten. 18,- Euro
Hier bestellen

