Die Geschichte des Kapitalismus sei eine Erfolgsstory, die wesentlich durch die Kritik an ihm möglich wurde, meint der Historiker Jürgen Kocka. Der Philosoph und Ökonom Stefan Mekiffer hält dagegen, dass der im Kapitalismus angelegte Wachstumszwang pathologisch sei und radikale Lösungen sinnvoll mache. Eine Diskussion der Frage, ob es eine grundlegende Revision des Systems oder eher Reformen im System braucht.
In einem wundervollen, schmalen, aber inhaltsreichen Buch skizziert Jürgen Kocka die »Geschichte des Kapitalismus«. Darin geht der bekannte Sozialhistoriker und ehemalige Direktor des Wissenschaftszentrums Berlin der Frage nach, wie das kapitalistische System in die Welt kam. Und die Welt, das ist nicht nur Europa. Drei Elemente machen, so Kocka, den Kapitalismus aus: Erstens individuelle Eigentumsrechte und dezentrale Entscheidungen, zweitens die Koordinierung der wirtschaftlichen Akteure über Märkte und Preise, durch Wettbewerb und Zusammenarbeit, über Nachfrage und Angebot, durch Verkauf von Waren, und schließlich drittens Kapital, das investiert wird, mit dem Bestreben nach Profit.
Der Autor verweist auf die Leistungen dieses Wirtschaftssystems, der Kapitalismus hat die Welt reicher gemacht und viele, viele Menschen aus der Armut geführt. »Wer sich aber ernsthaft mit der Geschichte des Kapitalismus befasst und überdiese etwas Bescheid weiß über das Leben in den weiter zurückliegenden, nicht oder kaum kapitalistischen Jahrhunderten, kann gar nicht anders als von den immensen Fortschritten beeindruckt zu sein, die in großen Teilen der Welt (jedoch nicht in allen!) vor allem für die vielen Menschen, die nicht einer gut gestellten Oberschicht angehören, in Bezug auf materielle Lebensverhältnisse und Überwindung der Not, gewonnene Lebenszeit und Gesundheit, Wahlmöglichkeiten und Freiheit stattgefunden haben – Fortschritte, von denen sich rückblickend sagen lässt, dass sie ohne das dem Kapitalismus eigentümlich dauernde Wühlen, Drängen und Umgestalten vermutlich ausgeblieben wären.«
Die dunklen Flecken dieses Systems leuchtet der Historiker in gleicher Weise aus: Die Verbindung von Kapitalismus und Gewalt, die sich durch die Jahrhunderte zieht. Daraus hat sich immer wieder Kritik am Kapitalismus entwickelt. Und so schließt Kocka seinen Überblick über den Kapitalismus mit der Bemerkung: »Kapitalismuskritik ist so alt wie der Kapitalismus selbst. Sie hat seinen Siegeszug über die Welt nicht verhindert. Aber sie hat ihn beeinflusst. […] Die Reform des Kapitalismus ist eine Daueraufgabe. Dabei spielt Kapitalismuskritik eine zentrale Rolle.«
 Kritik am Kapitalismus ist im Moment en vogue. Zurecht. Der Kapitalismus in seiner bis vor kurzem gängigen Form und vulgo gerne als Neoliberalismus genannt, wird Moment von viele skeptisch gesehen bis zutiefst verdammt. Die internationale Finanzkrise von 2008 hat, so Kocka, »die intellektuelle und politische Legitimation des Neoliberalismus zutiefst erschüttert«, auch weil sie aus einer Finanzmarktkrise des Kapitalismus eine Verschuldungskrise von Staaten gemacht, mit immer noch nicht ganz absehbaren Folgen. Noch ist diese bedrohliche Situation in Gänze nicht ausgestanden. Das Perfide an der Krise von 2008 ist, dass die Institutionen, die versuchten ihrer Herr zu werden, zutiefst in Mitleidenschaft und vor allem in Misskredit gezogen wurden – Nationalstaaten, supranationale Organisationen wie die EU oder internationale Institutionen wie der Internationale Währungsfonds. Aus einer Wut, die gierigen und verantwortungslosen Bankern hätte gelten sollen, wurden und werden Politikerinnen und Politiker auf etlichen politischen Ebenen abgestraft, die mit großem Einsatz, nicht immer clever, oft mit etlichen Fehlern, aber immer mit dem Blick fürs Ganze und das Gemeinwohl agiert haben. Und wenn man so wohlwollend nicht über die politische Kaste urteilen möchte, wie ich es tue, dann sollte man ihnen zumindest einen realistischeren Blick auf die Realitäten zugestehen als ein Josef Ackermann, ehemaliger Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bank, der auf dem Höhepunkt der auch von seiner Bank verursachten Krise sagte, er würde sich schämen, wenn sein Geldhaus in der Krise Staatsgeld annehmen müsste.
Kritik am Kapitalismus ist im Moment en vogue. Zurecht. Der Kapitalismus in seiner bis vor kurzem gängigen Form und vulgo gerne als Neoliberalismus genannt, wird Moment von viele skeptisch gesehen bis zutiefst verdammt. Die internationale Finanzkrise von 2008 hat, so Kocka, »die intellektuelle und politische Legitimation des Neoliberalismus zutiefst erschüttert«, auch weil sie aus einer Finanzmarktkrise des Kapitalismus eine Verschuldungskrise von Staaten gemacht, mit immer noch nicht ganz absehbaren Folgen. Noch ist diese bedrohliche Situation in Gänze nicht ausgestanden. Das Perfide an der Krise von 2008 ist, dass die Institutionen, die versuchten ihrer Herr zu werden, zutiefst in Mitleidenschaft und vor allem in Misskredit gezogen wurden – Nationalstaaten, supranationale Organisationen wie die EU oder internationale Institutionen wie der Internationale Währungsfonds. Aus einer Wut, die gierigen und verantwortungslosen Bankern hätte gelten sollen, wurden und werden Politikerinnen und Politiker auf etlichen politischen Ebenen abgestraft, die mit großem Einsatz, nicht immer clever, oft mit etlichen Fehlern, aber immer mit dem Blick fürs Ganze und das Gemeinwohl agiert haben. Und wenn man so wohlwollend nicht über die politische Kaste urteilen möchte, wie ich es tue, dann sollte man ihnen zumindest einen realistischeren Blick auf die Realitäten zugestehen als ein Josef Ackermann, ehemaliger Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bank, der auf dem Höhepunkt der auch von seiner Bank verursachten Krise sagte, er würde sich schämen, wenn sein Geldhaus in der Krise Staatsgeld annehmen müsste.
Krisen erzeugen Kritik. Kritik verläuft sich aber gerne im Besserwisserischen und Ungefähren oder in a- und unpolitischen Ankündigungen, was sich wohl in Zukunft alles besser gestalten wird. Umso schöner, dass nun konkrete Gegenvorstellungen entwickelt werden, was denn an Stelle des Üblichen treten sollte. Eine dieser Gegenvorstellungen stammt von Stefan Mekiffer und beinhaltet bereits im Titel die These: Warum eigentlich genug Geld für alle da ist. Mekiffer ist Ökonom und Philosoph, eine Verbindung, die, ökonomisch gesprochen, Mehrwert schafft. Einer, der in der Lage ist, die unterkomplexen Modelle und Methoden der Wirtschaftswissenschaften zu hinterfragen, sie nicht als gegeben anzunehmen, und der sich andererseits nicht in normativen und ethischen Fragen verliert, die keinen Bezug zur realen Wirtschaft aufweisen. Er belegt die These, dass Wirtschaftswissenschaften zu wichtig sind, um sie lediglich Ökonomen zu überlassen. Vielmehr sollten sich mit dieser Materie wirklich kluge, reflektionsstarke und gut ausgebildete Wissenschaftler wie Historiker, Anthropologen, Soziologen und Philosophen beschäftigen.
Stefan Mekiffer ist ein sehr junger Mensch, aber einer, der nicht im jugendlichen Überschwang besserwisserisch in seiner Haltung verharrt, sondern der aktiv verändert. Sich verändert, andere verändert, andere Dinge tut, andere Wege geht, neue Wege geht. Einer wie Stefan Mekiffer, Stipendiat der Studienstiftung des Deutschen Volkes, hätte es leicht, sich innerhalb des Systems weiterzuentwickeln. Hier zu promovieren, dort zu forschen, mit einem Stipendium einer x-beliebigen Stiftung durch die Welt zu reisen. Und dabei im Ungefähren, im Unverbindlichen, im Unangreifbaren zu verbleiben. Dies tut er nicht, sondern er lebt das, was er schreibt. Ein Leben in der selbst gewählten Selbstbeschränkung, in der eigenen Zurücknahme, die so unendlich viel Freiheit schafft. Mit seinem Bruder hat er einen Hof in Nordhessen gekauft und dort eine Kommune gegründet. Er betreibt dort, wie er in seinem Buch beschreibt, einen Waldgarten. Ein nachhaltiges Ökosystem zur Selbstversorgung. Sein Verzicht auf Normales schafft Autonomie, gerade intellektuelle. Gerade deswegen sollte man sein Buch gelesen haben.
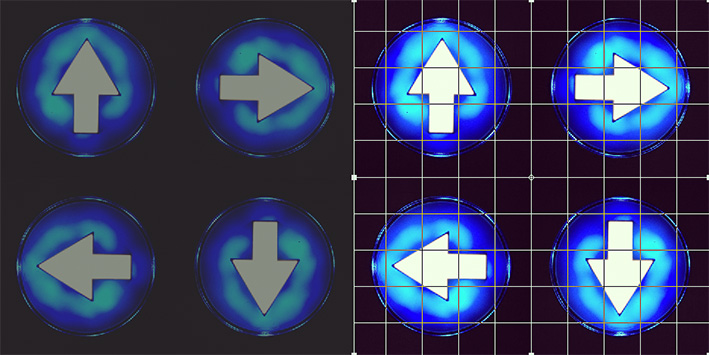 Warum eigentlich genug Geld für alle da ist ist eine Geschichte der Wirtschaft, eine Einführung in die Wirtschaftswissenschaften, ein Buch, das der Autor gerne zu Beginn seines Studiums gelesen hätte, und dem eine weite Verbreitung zu wünschen ist. Dieses Buch bringt allerhand Erhellendes hervor. Schon allein, wie es sich dem Begriff und der Entstehung von Geld nähert.
Warum eigentlich genug Geld für alle da ist ist eine Geschichte der Wirtschaft, eine Einführung in die Wirtschaftswissenschaften, ein Buch, das der Autor gerne zu Beginn seines Studiums gelesen hätte, und dem eine weite Verbreitung zu wünschen ist. Dieses Buch bringt allerhand Erhellendes hervor. Schon allein, wie es sich dem Begriff und der Entstehung von Geld nähert.
Drei Aspekte erscheinen mir dabei wesentlich. Erstens: Geld ist nicht nur aus dem Tauschhandel entstanden. Jüngst habe auch David Graeber in seinem Buch Schulden – Die ersten 5000 Jahre darauf hingewiesen. Bevor es Geld gab, wurden Waren, Erzeugnisse, Lebensmittel nicht nur getauscht, sondern auch verschenkt. Wer auf dem Land in kleinen Dörfern lebt, erfährt heute noch, wie gerade in Erntezeiten Nachbarn, Freunde und Bekannte einen mit frisch geerntetem Gemüse oder Obst bedenken. Mekiffer verweist auf eine Geschichte eines Stammes im Amazonas-Gebiet, wo einer der Stammesangehörigen befragt wird, warum er das Fleisch verschenkt und nicht aufspart, und darauf antwortet, er bewahre das Fleisch im Bauch seines Bruders auf.
Der polnische Sozialanthropologe und Begründer des Funktionalismus Bronislaw Malinowski hat in seiner Studie Argonauten des Westlichen Pazifiks, erschienen 1922, ebenfalls auf die nichtökonomische Bedeutung von Tausch und Handel verwiesen. Er beschrieb den Kula-Tausch, ein rituelles System eines Gabentausches der Bewohner der pazifischen Trobriand-Inseln, das eine verzögerte Gegenseitigkeit implizierte. Es war ein komplexer, nicht gewinnorientierter Austauschhandel, dessen Sinn darin bestand, die sozialen Bande zwischen den herrschaftsfrei miteinander verbundenen Trobriandern zu verstärken und realen Gütertausch rituell zu begleiten. Letztlich ein Wirtschaften ohne Gewinnorientierung.

